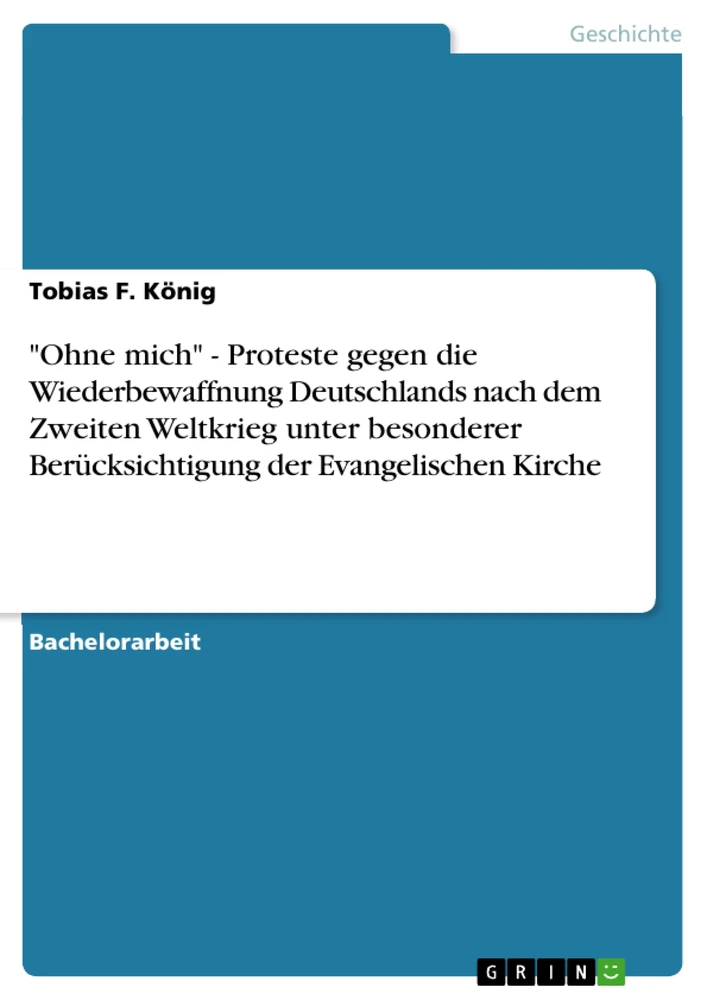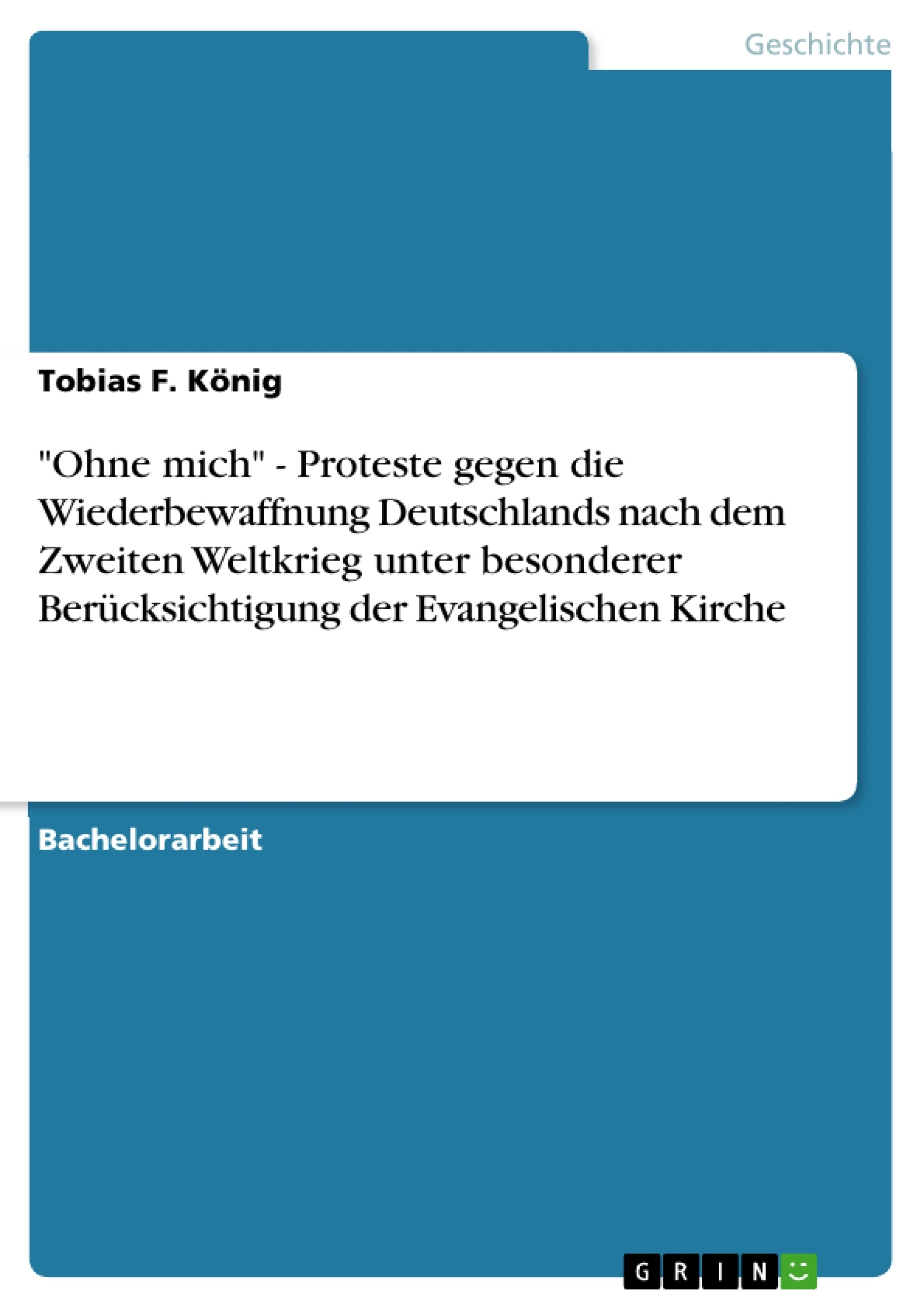Blickt man auf die jüngere Geschichte Deutschlands zurück, kann es mitunter verwunderlich
erscheinen, dass die Bundesrepublik heute ein anerkanntes und starkes
Mitglied in der Gemeinschaft der Völker ist. Vor allem die Ereignisse der ersten
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hätten aus damaliger Sicht eine Prognose, die
die heutige Stellung unseres Landes zum Inhalt gehabt hätte, als überaus unwahrscheinlich
erscheinen lassen. Jedoch gelang es Deutschland zu integrieren und es zu
einer Nation werden zu lassen, die einen festen Platz unter den Staaten dieser Welt
innehat. Dass dies kein Zufall war und von Umständen abhing, die zwar in Form des
Zweiten Weltkrieges durch Deutschland hervorgerufen worden waren, jedoch spätestens
mit der bedingungslosen Kapitulation am 07./08.05.1945 auf absehbare Zeit
nicht mehr zu beeinflussen waren, soll diese Arbeit, bezogen auf einen Teilaspekt
dieser Entwicklung, zum Inhalt haben.
Es soll der Frage nachgegangen werden, wie es dazu kam, dass Deutschland seit
1955 in Form der Bundeswehr wieder einen militärischen Waffenträger hat, der international
anerkannt ist und sich sowohl in der Gegenwart, als auch in der Vergangenheit
als verlässlicher Partner in Auslandseinsätzen unter der Leitung der Europäischen
Union (EU), der Organisation des Nordatlantikvertrags (engl. North Atlantic
Treaty Organization, NATO) und der Vereinten Nationen (engl. United Nations,
UN) erwiesen hat. Diese Entstehungsgeschichte soll im Folgenden unter der besonderen
Berücksichtigung der ‚öffentlichen Meinung’ erfolgen, da es innerhalb
Deutschlands große Widerstände und Proteste gegen die Aufstellung westdeutscher
Streitkräfte gab. Hier soll im Zuge dieser Arbeit der Fokus vor allem auf die Form
und Zielsetzung des Widerstandes gelegt werden. Dabei soll die evangelische Kirche
in Deutschland (EKD) intensiver untersucht werden. Außerdem soll der Versuch
unternommen werden, die Frage zu beantworten, weshalb es der Wiederbewaffnungsopposition
trotz ihrer quantitativen Stärke nicht gelungen ist die Remilitarisierung
Deutschlands zu verhindern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sicherheitspolitik, Westintegration und Aufrüstung
- Der Kalte Krieg als Chance für Deutschland
- Die europäische Lösung - Auf dem Weg in die EVG
- Alternative Lösung - Die BRD wird NATO-Mitglied
- Ablehnung, Protest und Widerstand zur Wiederbewaffnung
- Die „Ohne mich“-Bewegung
- Die evangelische Kirche und die Wiederbewaffnungsdebatte
- Heinemann und Niemöller - Zwei streitbare Personen
- Ablehnung, Zurückhaltung, Zustimmung
- Die EKD auf der Suche nach dem richtigen Weg
- Die katholische Kirche im Gleichschritt mit der Regierung
- Die Volksbefragungsinitiative
- Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
- Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) und Wirtschaftverbände
- Die Frankfurter Paulskirchenbewegung
- Die Internationale der Kriegsdienstverweigerer (IdK)
- Die „Notgemeinschaft für den Frieden“ und die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP)
- Weitere Gruppen und Strömungen innerhalb der Protest- und Widerstandsbewegungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Proteste gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Rolle der Evangelischen Kirche. Die zentrale Frage ist, wie es trotz erheblicher Widerstände zur Remilitarisierung kam und warum die Opposition diese nicht verhindern konnte. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Akteure und Strategien des Widerstands.
- Die „Ohne mich“-Bewegung und ihre Ziele
- Die Position der Evangelischen Kirche in der Wiederbewaffnungsdebatte
- Die Rolle weiterer gesellschaftlicher Gruppen im Widerstand (z.B. KPD, SPD, Gewerkschaften)
- Die Strategien und die Wirksamkeit des Widerstands
- Die Ursachen für das Scheitern der Wiederbewaffnungsgegner
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den überraschenden Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland zu einem starken Mitglied der internationalen Gemeinschaft nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Sie führt die Forschungsfrage ein: Wie kam es zur Wiederbewaffnung Deutschlands mit der Bundeswehr trotz erheblicher öffentlicher Widerstände, und welche Rolle spielte dabei die Evangelische Kirche? Der Fokus liegt auf der Form und Zielsetzung des Widerstands gegen die Remilitarisierung.
Sicherheitspolitik, Westintegration und Aufrüstung: Dieses Kapitel analysiert den geopolitischen Kontext der Wiederbewaffnung, insbesondere den Kalten Krieg und die Optionen der Westintegration. Es beleuchtet die Debatte um die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) als eine mögliche Lösung und den späteren Beitritt der Bundesrepublik zur NATO als Alternative. Der Fokus liegt auf den sicherheitspolitischen Überlegungen und den damit verbundenen strategischen Entscheidungen.
Ablehnung, Protest und Widerstand zur Wiederbewaffnung: Dieses Kapitel beschreibt umfassend die verschiedenen Formen des Widerstands gegen die Wiederbewaffnung. Es analysiert die „Ohne mich“-Bewegung und ihre Strategien. Ein Schwerpunkt liegt auf der differenzierten Rolle der Evangelischen Kirche, einschließlich der Positionen von Persönlichkeiten wie Heinemann und Niemöller. Zusätzlich werden die Haltungen anderer gesellschaftlicher Gruppen und Parteien (KPD, SPD, Gewerkschaften etc.) sowie die verschiedenen Strategien des Protests beleuchtet. Die Kapitel fasst die vielfältigen Akteure und Protestformen zusammen und analysiert die Gründe für den letztendlich erfolglosen Widerstand.
Schlüsselwörter
Wiederbewaffnung, Bundesrepublik Deutschland, Kalter Krieg, Evangelische Kirche, Protestbewegung, „Ohne mich“-Bewegung, Westintegration, NATO, Remilitarisierung, Widerstand, öffentliche Meinung, Friedensbewegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Proteste gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Evangelischen Kirche. Sie analysiert die verschiedenen Akteure und Strategien des Widerstands und fragt, wie es trotz erheblicher Widerstände zur Remilitarisierung kam und warum die Opposition diese nicht verhindern konnte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Sicherheitspolitik der Nachkriegszeit, die Westintegration Deutschlands (inkl. der Debatte um die EVG und den NATO-Beitritt), die verschiedenen Formen des Widerstands gegen die Wiederbewaffnung (z.B. die „Ohne mich“-Bewegung), die Positionen der Evangelischen Kirche (inkl. der Rollen von Heinemann und Niemöller), die Haltung anderer gesellschaftlicher Gruppen (KPD, SPD, Gewerkschaften etc.), und die Gründe für das Scheitern des Widerstands.
Welche Akteure werden analysiert?
Die Arbeit analysiert eine Vielzahl von Akteuren, darunter die Evangelische Kirche (mit ihren internen Differenzen), die katholische Kirche, die „Ohne mich“-Bewegung, die KPD, die SPD, der DGB, Wirtschaftsverbände, die Frankfurter Paulskirchenbewegung, die Internationale der Kriegsdienstverweigerer (IdK), die „Notgemeinschaft für den Frieden“, die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP) und weitere Gruppen und Strömungen innerhalb der Protest- und Widerstandsbewegungen.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie kam es trotz erheblicher öffentlicher Widerstände zur Wiederbewaffnung Deutschlands mit der Bundeswehr, und welche Rolle spielte dabei die Evangelische Kirche?
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Sicherheitspolitik und Westintegration, zu den Protesten und dem Widerstand gegen die Wiederbewaffnung, und ein Fazit. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wiederbewaffnung, Bundesrepublik Deutschland, Kalter Krieg, Evangelische Kirche, Protestbewegung, „Ohne mich“-Bewegung, Westintegration, NATO, Remilitarisierung, Widerstand, öffentliche Meinung, Friedensbewegung.
Welche Rolle spielte die Evangelische Kirche?
Die Arbeit untersucht die differenzierte Rolle der Evangelischen Kirche in der Wiederbewaffnungsdebatte, inklusive der Positionen von Persönlichkeiten wie Heinemann und Niemöller. Sie analysiert die internen Auseinandersetzungen und die verschiedenen Haltungen innerhalb der Kirche.
Welche Strategien des Widerstands wurden eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Strategien des Widerstands, die von der „Ohne mich“-Bewegung bis hin zu den Aktionen anderer gesellschaftlicher Gruppen reichten. Die Wirksamkeit und die Gründe für das letztendliche Scheitern dieser Strategien werden analysiert.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im gegebenen Text nicht explizit zusammengefasst, jedoch wird die Arbeit die Ursachen für das Scheitern des Widerstands gegen die Wiederbewaffnung untersuchen.)
- Quote paper
- Tobias F. König (Author), 2010, "Ohne mich" - Proteste gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung der Evangelischen Kirche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179031