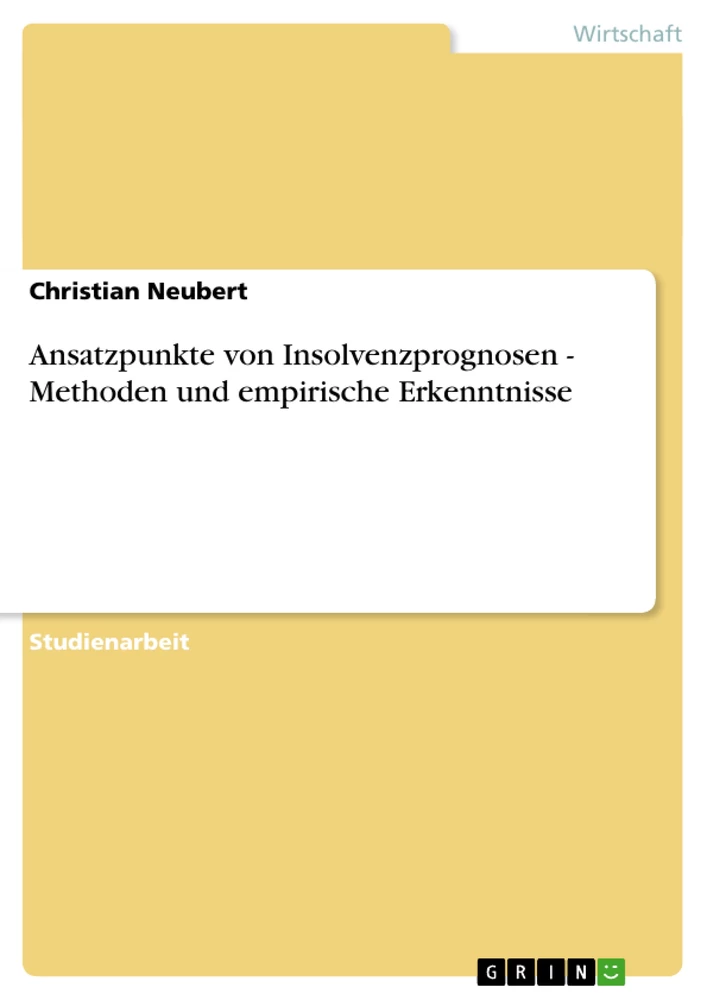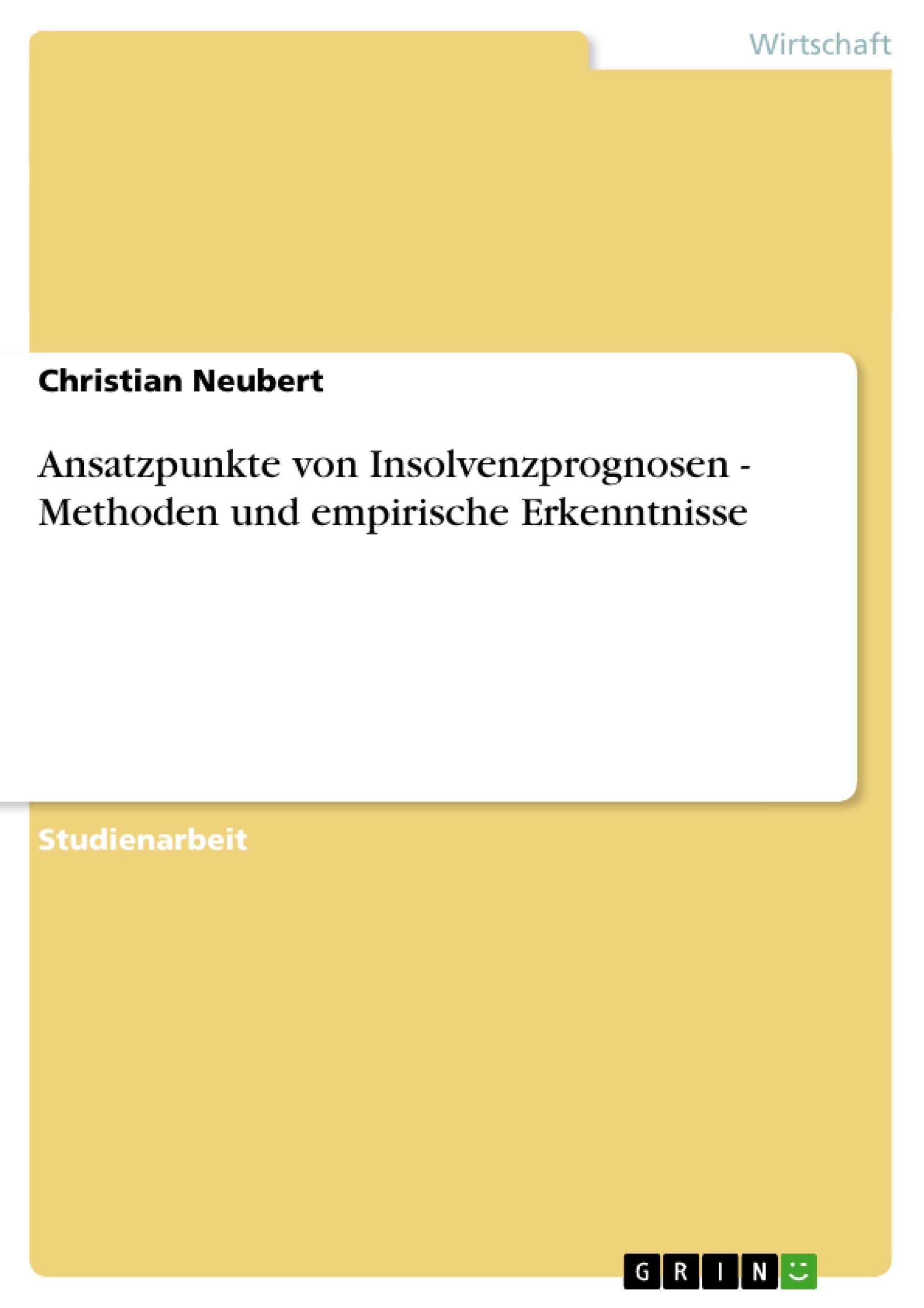Im ersten Halbjahr 2003 haben die deutschen Amtsgerichte 49515 Insolvenzen
gemeldet, 19953 entfielen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
auf Unternehmen. Damit lag die Gesamtzahl der Insolvenzen
um 24,8 von Hundert (v. H.), die der Unternehmensinsolvenzen um 9,1 v.
H. höher als im ersten Halbjahr 2002. Die Gerichte bezifferten die offenen
Forderungen der Insolvenzgläubiger im ersten Halbjahr 2003 mit 22,2
Mrd. Euro. Bei den Unternehmen waren zu dem Zeitpunkt, als über deren
Insolvenzantrag von den Gerichten entschieden wurde, rund 110000 Arbeitnehmer
beschäftigt.1 Vor dem Hintergrund dieses Anstiegs2 an Insolvenzen
ist das Interesse an einem Frühwarnsystem hinsichtlich negativer
Unternehmensentwicklungen begründet, da die Entwicklung eines Unternehmens
insbesondere für Eigentümer und Gläubiger, wie auch für Arbeitnehmer,
Konkurrenz, Kunden und Lieferanten von hoher Bedeutung
ist. Im rechtlichen Sinne ist die Insolvenz ein Oberbegriff für Zahlungsunfähigkeit,
drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie die Vorstadien
dieser Insolvenzgründe, die für die Bankrottdelikte der §§ 283 ff.
StGB von Bedeutung sind.3 Ein Insolvenzverfahren ist zu eröffnen, wenn
ein Schuldner oder ein schuldnerisches Unternehmen in eine wirtschaftliche
Notlage gelangt, die es dem Betroffenen unmöglich macht, sämtliche
Gläubiger in vollem Umfang zu befriedigen. Ziel des Verfahrens ist es „die
Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das
Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem
Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird.“4 Einheitlicher Hauptzweck des Insolvenzverfahrens
ist demnach die gemeinschaftliche Verwirklichung der Vermögenshaftung.
5 [...]
1 vgl. Tabelle 1 [Insolvenzprognosen in Deutschland im Jahr 2003] 11.
2 vgl. Tabelle 2 [Insolvenzprognosen in Deutschland im Jahr 2002] 11.
3 vgl. Braun/Uhlenbruck [Unternehmensinsolvenz] 7.
4 vgl. § 1 S. 1 Insolvenzordnung.
5 vgl. Balz/Landfermann [Insolvenzgesetze] 20.
Inhaltsverzeichnis
- A. Fast 20.000 Insolvenzen im ersten Halbjahr 2003.
- B. Die Begriffe Insolvenz und Prognose..
- I. Abgrenzung von Insolvenz und Insolvenzrecht..
- 1. Gesetzliche Grundlagen der Insolvenzverordnung
- 2. Gründe für die Insolvenz
- II. Merkmale von Prognosen
- I. Abgrenzung von Insolvenz und Insolvenzrecht..
- C. Ausgewählte Analyseverfahren der Insolvenzprognose
- I. Systematisierung und Anforderungen der Verfahren .......
- II. Die Diskriminanzanalyse als statistisches Verfahren
- 1. Die univariate Diskriminanzanalyse......
- 2. Die multivariate Diskriminanzanalyse....
- III. Unternehmensbeurteilung mit Hilfe Künstlicher Neuronaler Netze....
- 1. Biologische und künstliche Neuronen
- 2. Verknüpfung von künstlichen Neuronen zu Netzen............
- 3. Lernen in Künstlichen Neuronalen Netzen.
- I. Die Untersuchung von Odom und Sharda
- II. Die Untersuchung von Erxleben und anderen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit dem Thema der Insolvenzprognose im Kontext von Klein- und Mittelbetrieben. Es soll einen Überblick über die Methoden der Insolvenzprognose geben und empirische Erkenntnisse aus ausgewählten Studien beleuchten.
- Die Abgrenzung der Begriffe Insolvenz und Insolvenzrecht.
- Die Merkmale und Anforderungen von Insolvenzprognosen.
- Die Anwendung statistischer Verfahren wie der Diskriminanzanalyse.
- Die Verwendung Künstlicher Neuronaler Netze zur Unternehmensbeurteilung.
- Die Berücksichtigung von qualitativen Aspekten bei der Insolvenzprognose.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Referat beginnt mit einer Darstellung der aktuellen Entwicklung der Insolvenzen in Deutschland. Anschließend werden die Begriffe Insolvenz und Prognose abgegrenzt und die rechtlichen Grundlagen der Insolvenzverordnung erläutert. Die verschiedenen Merkmale von Prognosen werden im Detail beleuchtet.
Im weiteren Verlauf werden ausgewählte Analyseverfahren der Insolvenzprognose vorgestellt, darunter die Diskriminanzanalyse und Künstliche Neuronale Netze. Die univariate und multivariate Diskriminanzanalyse werden als statistische Verfahren zur Insolvenzprognose erläutert. Es wird zudem die Funktionsweise von Künstlichen Neuronalen Netzen in der Unternehmensbeurteilung beschrieben.
Der letzte Teil des Referats befasst sich mit empirischen Studien, die sich mit der Insolvenzprognose befassen. Die Untersuchungen von Odom und Sharda sowie Erxleben und anderen werden vorgestellt und ihre Ergebnisse diskutiert.
Schlüsselwörter
Insolvenz, Insolvenzrecht, Insolvenzprognose, Diskriminanzanalyse, Künstliche Neuronale Netze, empirische Studien, qualitative Aspekte.
- Quote paper
- Christian Neubert (Author), 2003, Ansatzpunkte von Insolvenzprognosen - Methoden und empirische Erkenntnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17804