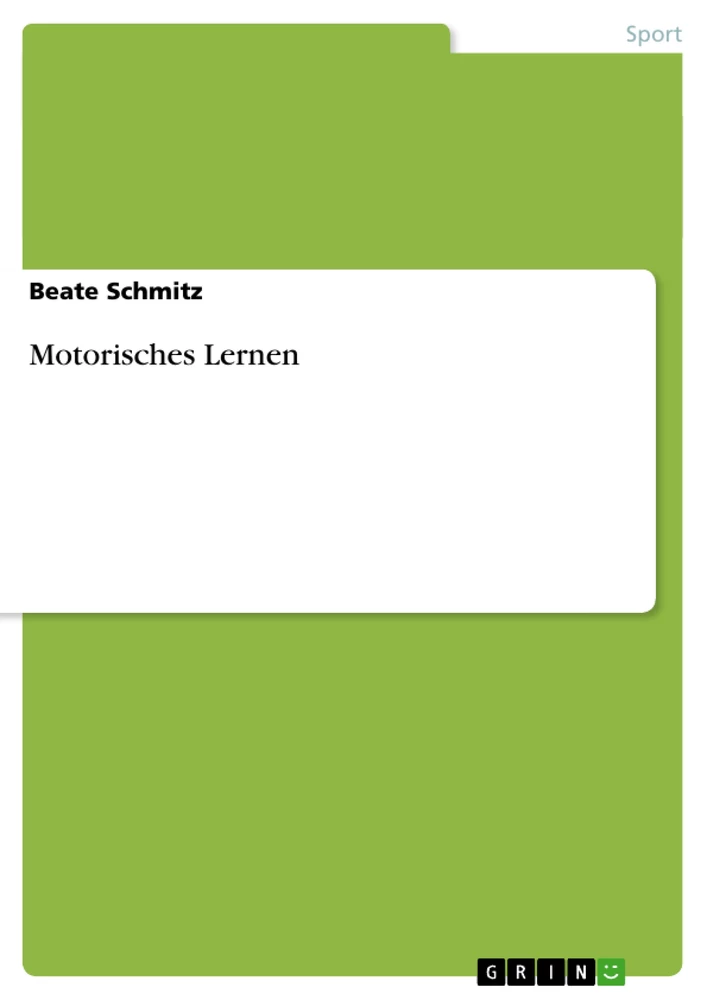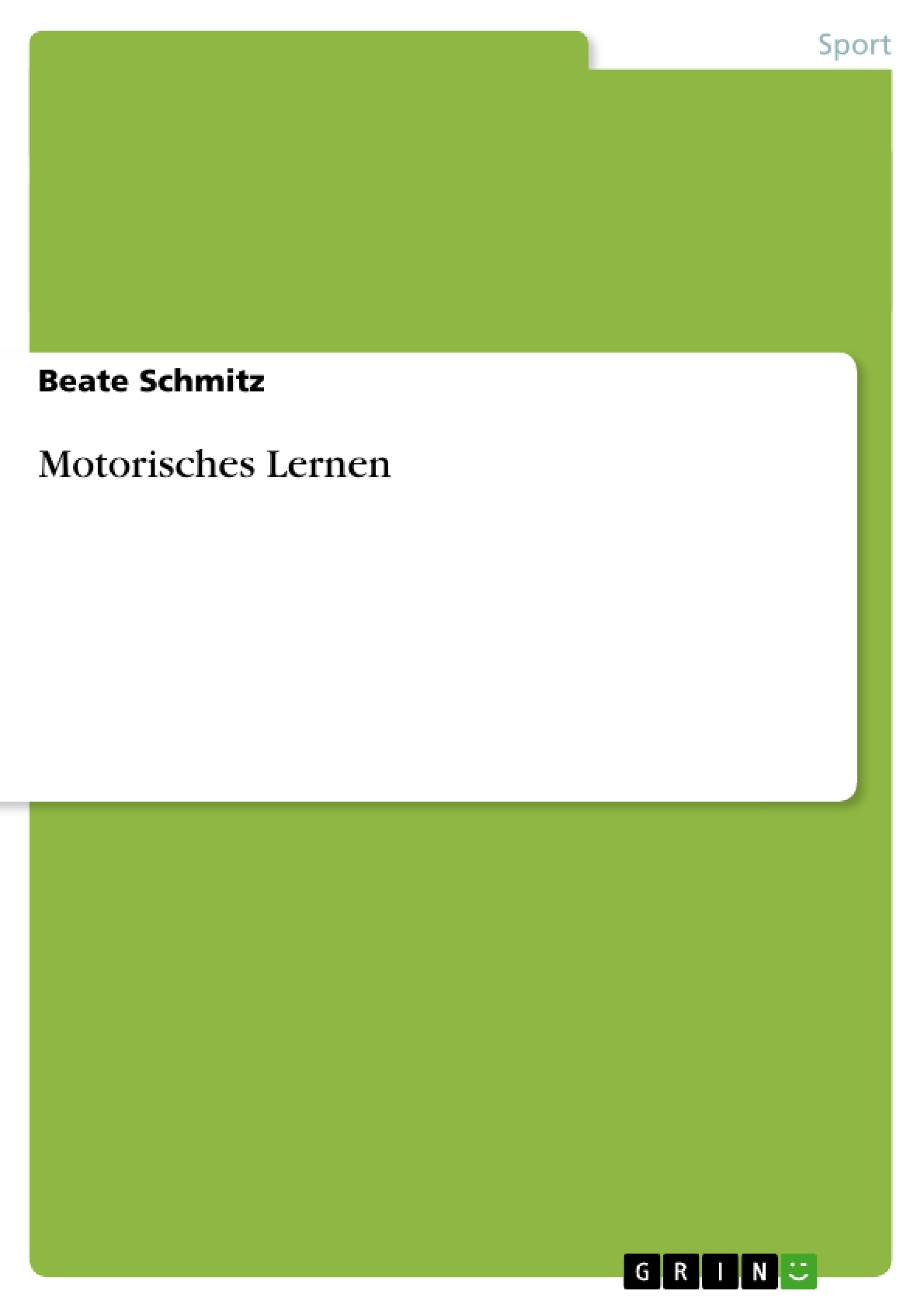Mit dem Bildungsauftrag der Schule wird in erster Linie das Lernen verbunden. Es umfasst hauptsächlich mentales und motorisches Lernen. Beide Arten von Lernen spielen eine große Rolle in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung. Sie hängen eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Im Sportunterricht steht das motorische Lernen im Vordergrund. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Grundvorgänge des Lernprozesses genauer und verdeutlicht die Rolle der Lehrkraft in diesem Zusammenhang.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. MOTORISCHES LERNEN
- 2.1 Phasenmodell
- 2.2 Regelkreis
- 3. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die Grundvorgänge des motorischen Lernens im Kindesalter und verdeutlicht die Rolle der Lehrkraft im Lernprozess. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Lernprozesses und der methodischen Gestaltung des Sportunterrichts.
- Phasenmodell des motorischen Lernens nach Meinel und Schnabel
- Bedeutung der Rückinformation im motorischen Lernprozess
- Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung des Lernprozesses
- Methodische und didaktische Gestaltung des Sportunterrichts
- Optimierung des Lernprozesses durch Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung betont die Bedeutung von mentalem und motorischem Lernen für die Persönlichkeitsentwicklung und hebt die zentrale Rolle des motorischen Lernens im Sportunterricht hervor. Sie führt in das Thema ein und kündigt die detailliertere Betrachtung der Grundvorgänge des Lernprozesses und die Rolle der Lehrkraft an. Die enge Verknüpfung beider Lernarten und deren wechselseitige Beeinflussung werden angedeutet, was die Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem motorischen Lernen bildet.
2. MOTORISCHES LERNEN: Dieses Kapitel definiert den Begriff "motorisches Lernen" und differenziert ihn von Reifungsprozessen und Krankheit. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt, die sich im Wesentlichen ähneln und den Fokus auf die Veränderung des motorischen Verhaltens legen, sofern diese nicht durch äußere Faktoren verursacht ist. Die Begriffe "Üben" und "Trainieren" werden abgegrenzt und in Beziehung zum motorischen Lernen gesetzt. Anschließend wird das Phasenmodell von Meinel und Schnabel detailliert erläutert, beginnend mit der Grobkoordination, über die Feinkoordination bis hin zur Stabilisierung der Feinkoordination und variablen Verfügbarkeit. Der Regelkreis im motorischen Lernen wird vorgestellt und die Bedeutung der Rückinformation für den Lernprozess sowie die Aufgaben der Lehrkraft in diesem Zusammenhang hervorgehoben. Der Prozess der Rückmeldung, sowohl von Seiten der Lehrkraft als auch der Selbstregulation des Lernenden, wird detailliert beschrieben.
3. SCHLUSSFOLGERUNG: Die Schlussfolgerung fasst die Kernaussagen der Arbeit zusammen und betont die Bedeutung des Verständnisses der Grundvorgänge des motorischen Lernens für Sportlehrkräfte. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer methodisch und didaktisch wertvollen Unterrichtsgestaltung, die die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt. Die Schlussfolgerung gibt praktische Hinweise zur Unterrichtsplanung und -gestaltung, wie z.B. die Berücksichtigung des motorischen Ausgangsniveaus, des Interesses der Kinder, sowie die Vermeidung einer Überforderung der Lernkapazität. Es werden Empfehlungen zur Fehlerkorrektur und zum Anknüpfen an bereits bekannte Bewegungsmuster gegeben, sowie die Wichtigkeit der Förderung der inneren Rückmeldung durch Anregungen zur selbstständigen Korrektur. Die Notwendigkeit regelmäßiger Rückmeldungen durch die Lehrkraft an jedes Kind wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Motorisches Lernen, Phasenmodell, Grobkoordination, Feinkoordination, variable Verfügbarkeit, Rückinformation, Regelkreis, Lehrkraft, Sportunterricht, Unterrichtsgestaltung, Lernprozess, methodisch-didaktische Gestaltung, individuelles Lernniveau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Motorisches Lernen im Kindesalter"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das motorische Lernen im Kindesalter. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Motorisches Lernen, Schlussfolgerungen) und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Grundvorgänge des motorischen Lernens und der Rolle der Lehrkraft im Lernprozess.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind das Phasenmodell des motorischen Lernens nach Meinel und Schnabel (Grob- und Feinkoordination, variable Verfügbarkeit), die Bedeutung der Rückinformation und des Regelkreises im Lernprozess, die Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung des Lernprozesses (methodisch-didaktische Gestaltung des Sportunterrichts), die Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen und die Optimierung des Lernprozesses.
Was ist das Phasenmodell des motorischen Lernens nach Meinel und Schnabel?
Das Kapitel "Motorisches Lernen" erläutert detailliert das Phasenmodell von Meinel und Schnabel. Es beschreibt die einzelnen Phasen der motorischen Entwicklung, beginnend mit der Grobkoordination, über die Feinkoordination bis hin zur Stabilisierung der Feinkoordination und variablen Verfügbarkeit. Der Prozess wird Schritt für Schritt erklärt.
Welche Rolle spielt die Rückinformation im motorischen Lernprozess?
Die Rückinformation spielt eine zentrale Rolle. Das Dokument betont die Bedeutung der Rückmeldung sowohl von der Lehrkraft als auch durch Selbstregulation des Lernenden. Der Regelkreis im motorischen Lernen wird detailliert beschrieben, und die Aufgaben der Lehrkraft in Bezug auf die Rückmeldung werden hervorgehoben.
Wie sollte der Sportunterricht methodisch und didaktisch gestaltet werden?
Das Dokument betont die Notwendigkeit einer methodisch und didaktisch wertvollen Unterrichtsgestaltung, die die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt. Es gibt praktische Hinweise zur Unterrichtsplanung und -gestaltung, wie z.B. die Berücksichtigung des motorischen Ausgangsniveaus, des Interesses der Kinder, sowie die Vermeidung einer Überforderung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments am besten?
Die Schlüsselwörter umfassen: Motorisches Lernen, Phasenmodell, Grobkoordination, Feinkoordination, variable Verfügbarkeit, Rückinformation, Regelkreis, Lehrkraft, Sportunterricht, Unterrichtsgestaltung, Lernprozess, methodisch-didaktische Gestaltung, individuelles Lernniveau.
Welche praktischen Hinweise zur Unterrichtsgestaltung gibt das Dokument?
Das Dokument gibt Hinweise zur Berücksichtigung des motorischen Ausgangsniveaus, des Interesses der Kinder und zur Vermeidung von Überforderung. Es werden Empfehlungen zur Fehlerkorrektur, zum Anknüpfen an bekannte Bewegungsmuster und zur Förderung der inneren Rückmeldung durch Anregungen zur selbstständigen Korrektur gegeben. Die Notwendigkeit regelmäßiger Rückmeldungen der Lehrkraft wird ebenfalls hervorgehoben.
Was ist die zentrale Aussage der Schlussfolgerung?
Die Schlussfolgerung betont die Bedeutung des Verständnisses der Grundvorgänge des motorischen Lernens für Sportlehrkräfte und unterstreicht die Notwendigkeit einer methodisch und didaktisch wertvollen Unterrichtsgestaltung, die die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt.
- Quote paper
- Beate Schmitz (Author), 2007, Motorisches Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177527