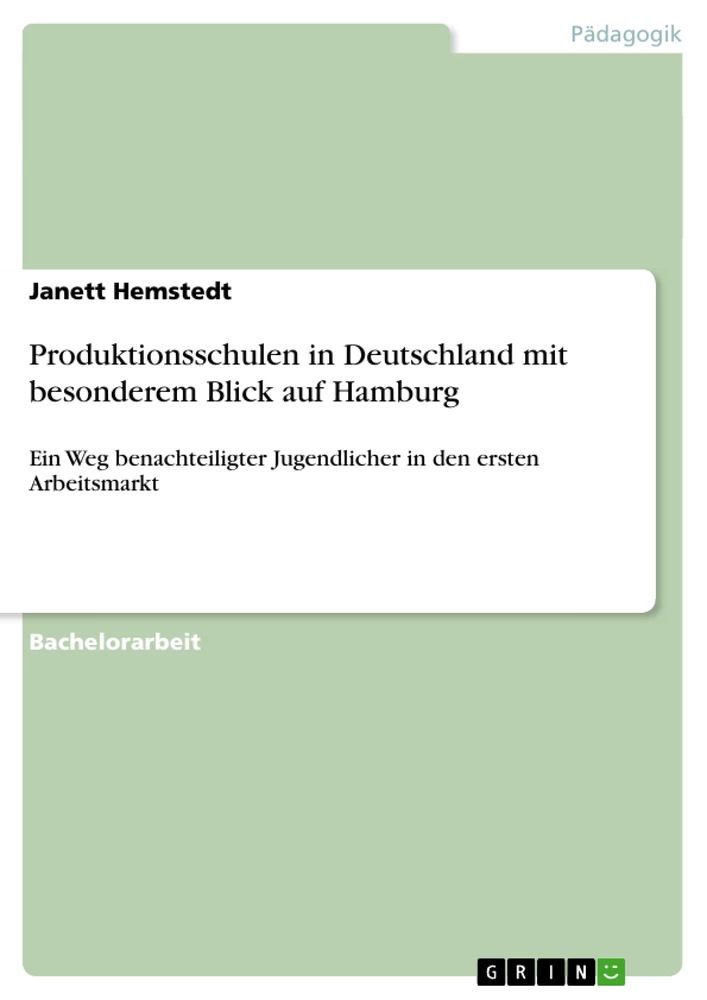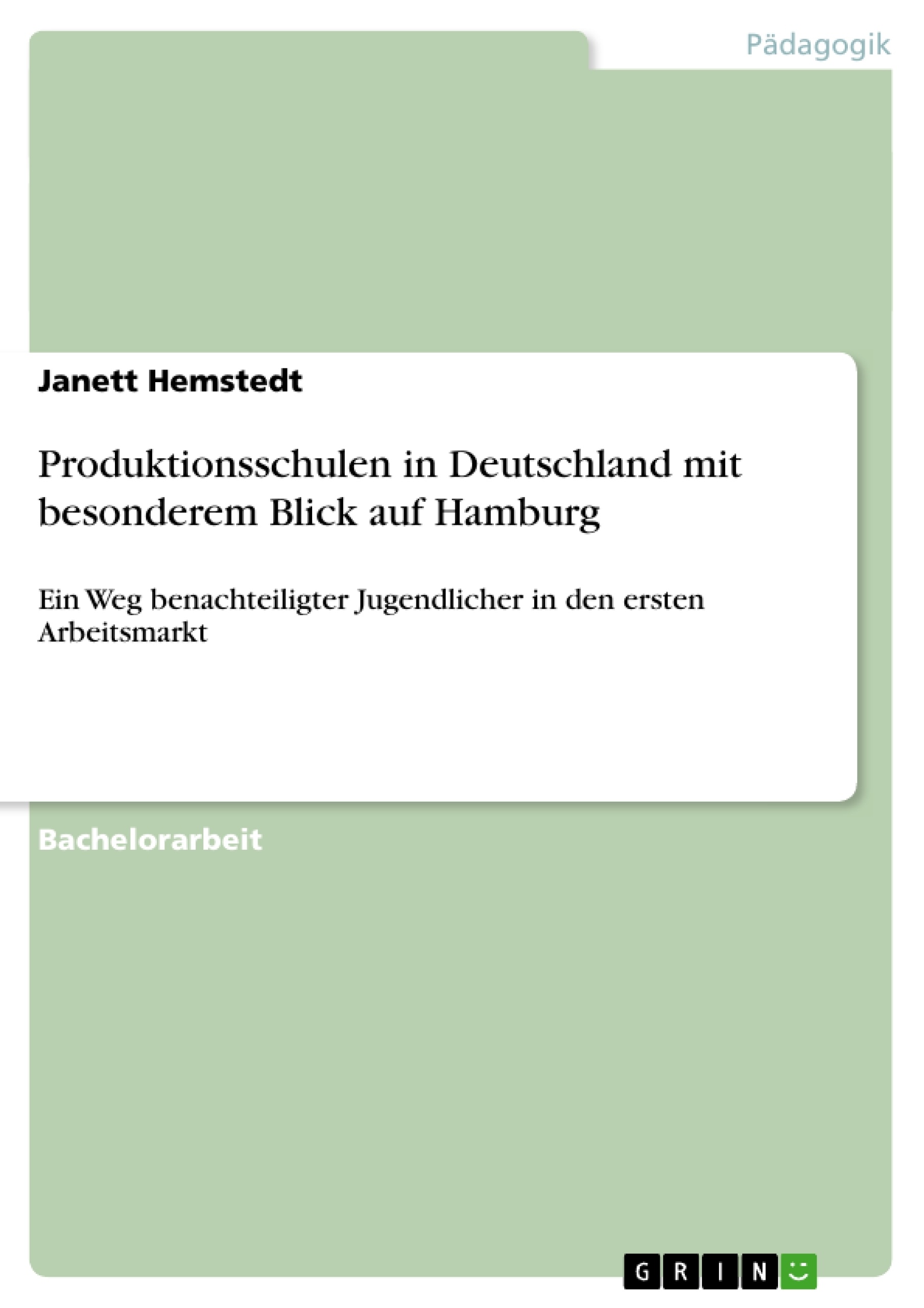Die Benachteiligtenförderung in der Bundesrepublik Deutschland ist seit etwa 1980 in einer Dauerkrise, denn „die milliardenteuren Kurse zur beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen sind einer Studie zufolge oft nicht ihr Geld wert. Außerdem sei das Wirrwarr der zahllosen Angebote selbst für Fachleute kaum zu überblicken“ , heißt es in der Frankfurter Rundschau vom 13. Januar 2011.
So kann man auch die Ergebnisse einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und der Bertelsmann-Stiftung zum Stand beruflicher Qualifizierungs-maßnahmen zusammenfassen: Etwa 350.000 Jugendliche konnten in Deutschland nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2009 eine Berufsausbildung nicht unmittelbar anschließen. Gelder und Personal für Übergangsmaßnahmen sollten optimierter eingesetzt werden, sind sich 89 Prozent der 500 befragten Berufsbildungsexperten einig.
Weiterhin ...
Die sozialen Folgen und Folgekosten sind unüberschaubar. Daraus lässt sich ableiten, dass die Qualifizierung auch schwächerer Jugendlicher in einer modernen Wissensgesellschaft auch aus finanziellen Gründen immer wichtiger wird. Für die Bundesrepublik Deutschland ist damit Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit verbunden. Für das Individuum bedeutet Berufsbildung die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Qualifizierung und Bildung sind daher in vielfacher Sicht von großer Bedeutung. Dem steht jedoch entgegen, dass das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland von einem selektiven Charakter geprägt ist und nicht allen Jugendlichen die gleichen Chancen vermittelt. Der Bildungserfolg von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in hohem Maße von der sozialen und nationalen Herkunft des Einzelnen abhängig. Für die Heranwachsenden hat dies fehlende berufliche Perspektiven, ein erhöhtes Risiko für Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit, schlechte Arbeitsbedingungen und somit ein geringeres Einkommen zur Folge. Die berufliche Bildung stellt aus diesem Grund eine zentrale Komponente der Bildungspolitik dar, wenn es um das Vorhaben der Bundesregierung geht, Deutschland zu einer Bildungsrepublik zu machen. Der demografische Wandel, wirtschaftliche Veränderungen, fortschreitende technologische Erkenntnisse, Fachkräftemangel, erhöhte Qualifikations-anforderungen und (Jugend-) Arbeitslosigkeit erfordern ein zeitgemäßes Umdenken im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Wichtig auf der Reformagenda seien nach Meinung des BMBF „in den nächsten Jahren neben der Fachkräftesicherung ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Benachteiligte Jugendliche
- Begriffsbestimmungen
- Benachteiligung
- Benachteiligtenförderung
- Ursachen der Benachteiligung
- Soziale Faktoren
- Individuelle Faktoren
- Marktbezogene Faktoren
- Folgen für die Gesellschaft
- Begriffsbestimmungen
- Das Produktionsschulmodell
- Historischer Rückblick
- Vorbild Dänemark
- Zielgruppe
- Besonderheiten des Konzepts
- Produktionsschulen in Deutschland
- Rahmenbedingungen und Entwicklung
- Definitionsversuch
- Wann sind Produktionsschulen erfolgreich?
- Produktionsschulen in Hamburg
- Einführung und Entwicklung
- Allgemeine Merkmale bestehender Einrichtungen
- Produktionsschule Altona (PSA)
- Besuch der Einrichtung
- Konzeptionelle Merkmale
- Kritik
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der Produktionsschulen in Deutschland, insbesondere in Hamburg, und analysiert die Rolle dieser Einrichtungen bei der Integration benachteiligter Jugendlicher in den ersten Arbeitsmarkt. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen und Folgen der Benachteiligung, die Entwicklung des Produktionsschulmodells und dessen Wirksamkeit sowie die Besonderheiten der Produktionsschulen in Hamburg.
- Benachteiligung von Jugendlichen und deren Ursachen
- Das Produktionsschulmodell in Deutschland und Dänemark
- Die Rolle der Produktionsschulen in der Integration benachteiligter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt
- Die Situation von Produktionsschulen in Hamburg
- Die Wirksamkeit und Kritik des Produktionsschulmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die Relevanz von Produktionsschulen für die Integration benachteiligter Jugendlicher. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Benachteiligung, untersucht die Ursachen und Folgen für die Gesellschaft. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Produktionsschulmodell, seinen historischen Wurzeln, den Besonderheiten des dänischen Modells und der Entwicklung in Deutschland.
Das vierte Kapitel fokussiert auf Produktionsschulen in Hamburg, analysiert deren Entwicklung, Merkmale und die Kritik an diesen Einrichtungen. Die Schlussbetrachtung und der Ausblick fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Benachteiligte Jugendliche, Produktionsschulen, Integration, Arbeitsmarkt, Hamburg, Deutschland, Dänemark, Bildung, Beruf, Sozialpädagogik, Berufsvorbereitung.
- Quote paper
- Janett Hemstedt (Author), 2011, Produktionsschulen in Deutschland mit besonderem Blick auf Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177221