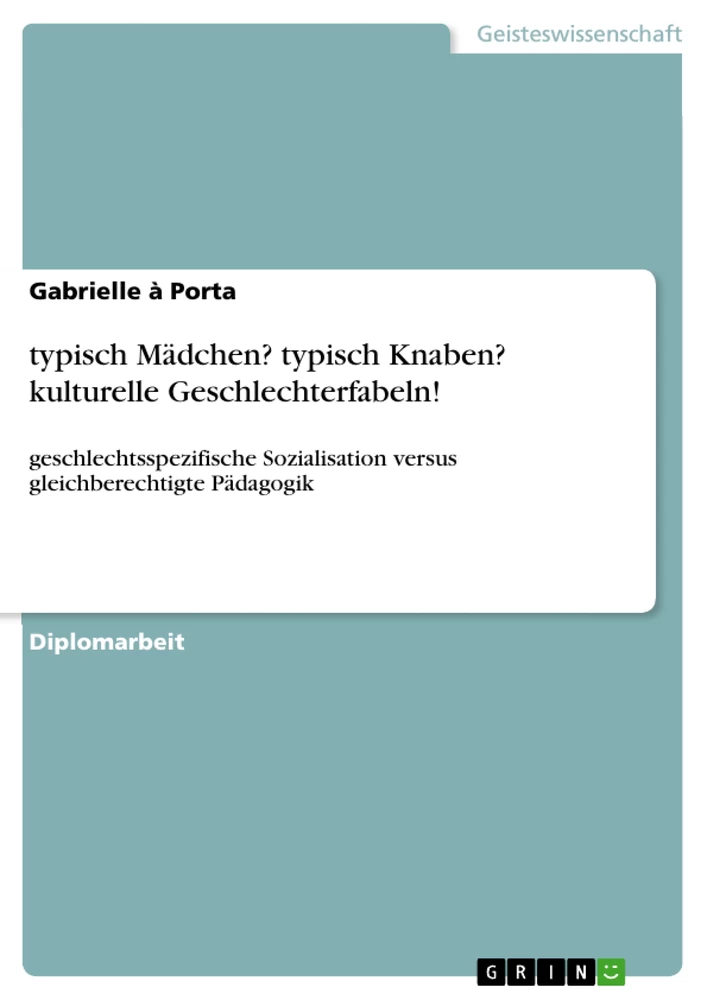Ich werde oft gefragt, ob Gleichstellung denn heute überhaupt noch ein Problem sei. Die Geschlechterrollen sind zunehmend weniger starr und Mädchen und Frauen sind heute dem Gesetz nach gleichberechtigt. Viel ist schon erreicht worden und dies nicht zuletzt dank der neuen Frauenbewegung, die sich seit den 70er Jahren für die Anliegen der Frauen und Mädchen stark macht. Tatsächlich gilt meine „Sorge“ auch den Knaben: Wirft man/frau einen Blick in geschlechtsspezifische Untersuchungen, so sind die Forschungsergebnisse höchst beunruhigend. Durch diese Konfrontation habe ich mich mit diversen Fragestellungen auseinandergesetzt und meine Arbeit mittels dieser Ausgangsfragen in vier Teile gegliedert.
Fragestellung 1: Hat das Geschlecht eine Geschichte? Oder hat jedes Geschlecht eine andere Geschichte bzw. andere Geschichten? Durch welche Einflüsse haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte die Geschlechterrollen gewandelt? Fragestellung 2: Kann über biologische Differenzen auf naturgegebene, geschlechtsspezifische Wesens-und Charaktereigenschaften geschlossen werden? Oder sind „typisch männli-che" und "typisch weibliche" Eigenschaften eher Fehlbenennungen, welche in Umlauf gebracht wurden und sich etabliert haben? Was bedeuten die Begriffe „Geschlecht / Geschlechtsidentität“ und „sex / gender“ überhaupt? Fragestellung 3: Wenn die „Kultur“, die Geschlechtsidentität „konstruiert“, ist diese dann nicht ebenso determiniert und festgelegt wie nach der Formel: „Biologie ist Schicksal“? Nur hätte hier die Kultur an Stelle der Biologie die Rolle des Schicksals eingenommen. Ist „Weiblich- oder Männlich-Sein“ eine kulturelle Performanz? Wie und wo vollzieht sich die Kon-struktion der Geschlechtsidentität? Welche Auswirkung respektive Folgen hat die geschlechtsspezifische Sozialisation für Mädchen/Frauen und Knaben/Männer? Fragestellung 4: Die einen fordern die stärkere Trennung der Geschlechter, die anderen ein besseres Miteinander, manche betonen die Verschiedenheit, andere möchten sie vor allem aufheben: Wie kann pädagogisches Handeln der geschlechtlichen und individuellen Verschiedenheit gerecht werden? Wie kann Pädagogik dabei das demokratische Prinzip der Gleichberechtigung verwirklichen?
Es ist zu hoffen, dass sowohl Untersuchungen als auch Debatten über Geschlechterfragen solange Thema bleiben, bis sie kein Thema mehr sind. Auch wenn wir diesbezüglich schon viel getan haben, wir sind erst am Anfang...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Exkurs in die Geschichte
- Geschlechterrollen im Wandel historischer Epochen
- Ursprung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
- Strukturwandel in der „Institution Familie”
- Geschichte geschlechtsspezifischer Bildung und Erziehung > Koedukation
- Theorie und Geschichte von Gleichheit und Verschiedenheit
- Geschichte der Frauen >,,Her-Story”
- Persönliches Fazit
- Geschlechterrollen im Wandel historischer Epochen
- Teil II: Theoretische Grundlagen
- Sozialisation aus soziologischer Perspektive
- Sozialisationseinflüsse
- Sozialisationsphasen
- Sozialisation, Lernen und Erziehung
- Normen, Erwartungen und soziale Rollen
- Biologisches und soziales Geschlecht
- Geschlecht: eine alltägliche Erfahrung
- Geschlecht als soziale Kategorie
- Die Polarisierung der Geschlechter
- Persönliches Fazit
- Sozialisation aus psychoanalytischer Perspektive
- Psychosexuelle Entwicklung und Geschlechtsidentität
- Theorie der Objektbeziehungen
- Persönliches Fazit
- Sozialisation aus pädagogischer Perspektive
- Die Bildung von Geschlechtscharakteren in der Pädagogik
- Die übergangene Geschlechterdifferenz
- Pädagogik der Gleichstellung
- Androgynitätspädagogik
- Persönliches Fazit
- Sozialisation aus soziologischer Perspektive
- Teil III: Gender Studies/Geschlechterforschung
- Geschlechterdifferenz und Differenztheorien
- Konstuktivismus-Theorie
- Feministischer Dekonstruktivismus
- Persönliches Fazit
- Wahrnehmung, Denken und Sprache
- „weiblich“ und „männlich“: Wahrnehmung und Denkstrukturen
- Sprache: Linguistische Geschlechterforschung
- Persönliches Fazit
- Einflüsse der Medien - Mediensozialisation
- Das Mädchen- und Jungenbild im Fernsehen
- Geschlechtsspezifische Medienpräferenzen
- Persönliches Fazit
- Geschlechtsspezifische Sozialisation und Statistik
- Physischer und psychischer Gesundheitszustand im Geschlechtervergleich
- Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Knaben
- Delinquentes Verhalten im Geschlechtervergleich
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in Ausbildung und Berufsfindung
- Persönliches Fazit
- Geschlechterdifferenz und Differenztheorien
- Teil IV: Schlussfolgerung
- Konsequenzen für die (sozial-) pädagogische Praxis
- Praxisbeispiele
- Thesen
- Pädagogische Möglichkeiten und Grenzen als weibliche Sozialpädagogin
- Schlusswort
- Konsequenzen für die (sozial-) pädagogische Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Unterschieden zwischen Mädchen und Jungen, Männern und Frauen, deren Entstehungsgeschichte und deren Verankerung in Gedanken, Empfindungen und Wahrnehmungen der Individuen. Dabei wird der jeweilige Anteil des biologischen Körpers, der Erziehung, des Umfelds, der Kultur und der Einstellung der Erwachsenen untersucht.
- Geschlechterrollen im Wandel der Zeit
- Einflüsse der Sozialisation auf die Geschlechtsidentität
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in Bildung und Berufsfindung
- Die Bedeutung von Gleichstellung in der Pädagogik
- Gender Studies und ihre Auswirkungen auf die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Diplomarbeit vor und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie geht auf die aktuelle Diskussion um Gender und Gleichstellung ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der pädagogischen Praxis.
Teil I: Exkurs in die Geschichte: Dieser Teil behandelt die geschichtliche Entwicklung von Geschlechterrollen und die Entstehung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Er beleuchtet den Strukturwandel der „Institution Familie“ und analysiert die Geschichte geschlechtsspezifischer Bildung und Erziehung, inklusive der Entwicklung der Koedukation. Weiterhin werden die Theorie und Geschichte von Gleichheit und Verschiedenheit sowie die „Her-Story“ der Frauen thematisiert.
Teil II: Theoretische Grundlagen: Dieser Teil beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Sozialisation aus unterschiedlichen Perspektiven, wie z.B. der Soziologie und der Psychoanalyse. Es werden verschiedene Einflussfaktoren auf die Sozialisation, wie z.B. Erziehung, Umfeld und Kultur, sowie Phasen der Sozialisation und die Bedeutung von Normen, Erwartungen und sozialen Rollen untersucht. Weiterhin werden die Konzepte des biologischen und sozialen Geschlechts und die Rolle des Geschlechts als soziale Kategorie betrachtet.
Teil III: Gender Studies/Geschlechterforschung: Dieser Teil widmet sich den Gender Studies und den verschiedenen Theorien, die sich mit Geschlechterdifferenz auseinandersetzen. Er beleuchtet den Konstruktivismus und den feministischen Dekonstruktivismus, untersucht die Auswirkungen von Wahrnehmung, Denken und Sprache auf die Geschlechterrollen und analysiert die Mediensozialisation und ihre Einflussfaktoren auf die Geschlechtsidentität. Zudem werden statistische Daten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf Gesundheit, sexuelle Ausbeutung, delinquentes Verhalten und Bildung betrachtet.
Teil IV: Schlussfolgerung: Dieser Teil beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse der Diplomarbeit und die Ableitung von Konsequenzen für die (sozial-)pädagogische Praxis. Es werden Praxisbeispiele und Thesen vorgestellt sowie die pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit mit Mädchen und Knaben aus der Perspektive einer weiblichen Sozialpädagogin beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Themen Gender, Gleichstellung, Geschlechterrollen, Sozialisation, Bildung, Erziehung, Mediensozialisation, Gender Studies und Geschlechtsspezifische Unterschiede. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Geschlechterrollen sowie die Einflussfaktoren, die zur Konstruktion und Wahrnehmung von Geschlecht beitragen. Dabei stehen Themen wie die Gleichstellung von Mädchen und Jungen sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten der pädagogischen Praxis im Vordergrund.
- Quote paper
- Sozialpädagogin HFS Gabrielle à Porta (Author), 2003, typisch Mädchen? typisch Knaben? kulturelle Geschlechterfabeln! , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/177123