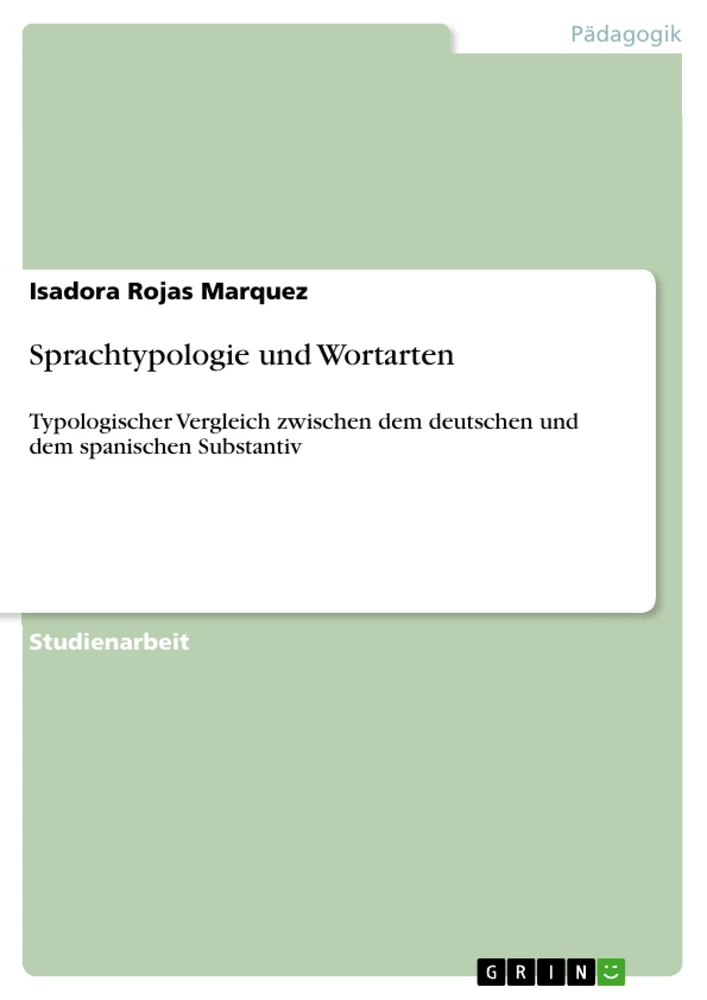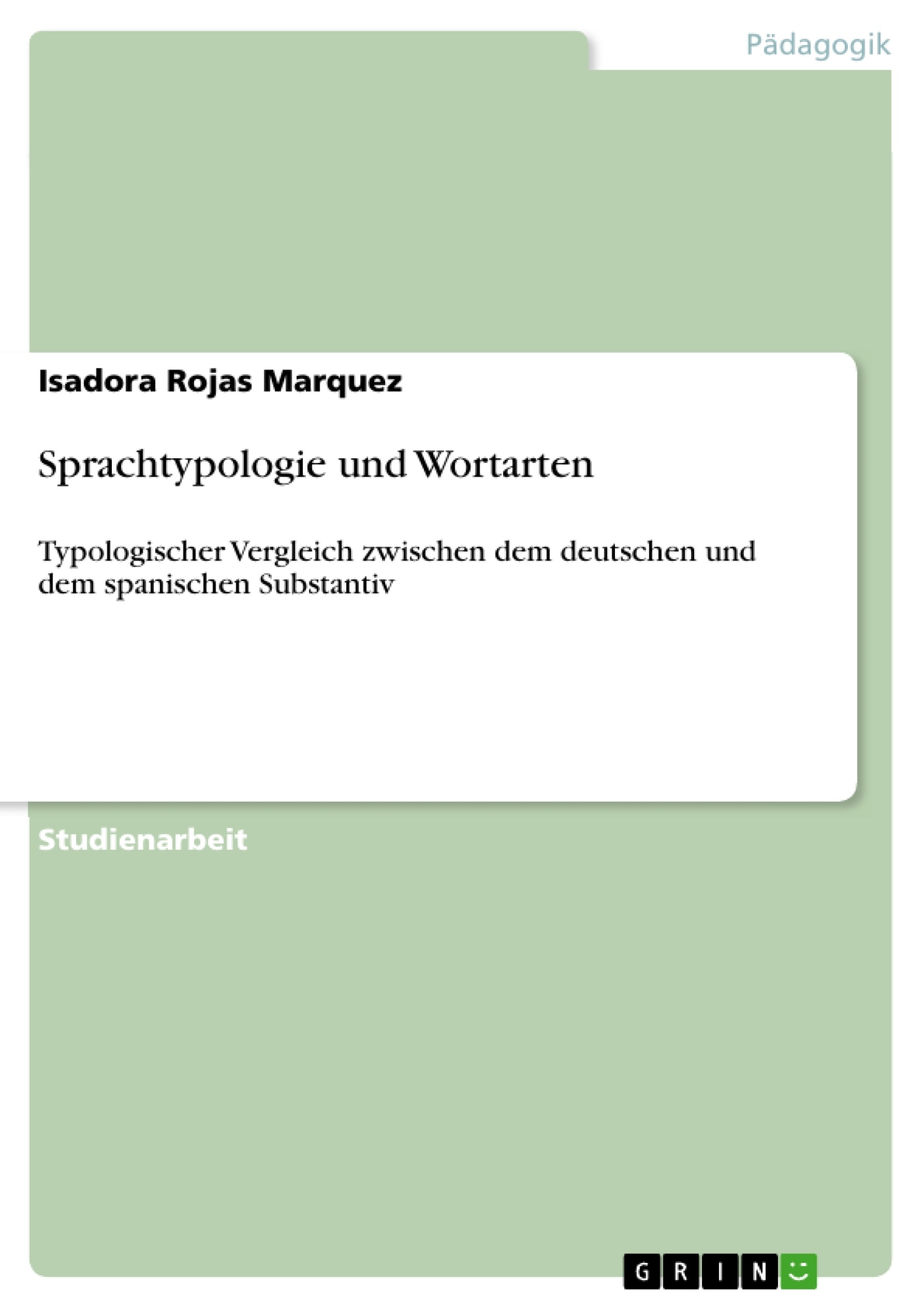Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich das deutsche- und das spanische Substantiv in ihrer Typologie unterscheiden. Aufgrund der komplexen Numerus- und Kasusmarkierung des Nomens im Deutschen ist zu erwarten, dass die deutsche Sprache eine flektierende Sprache ist. Da jede Sprache nicht nur einer Typologie entspricht, sondern eine Gesamtheit von Merkmalen verschiedener Sprachtypen beinhaltet, wird in dieser Arbeit analysiert, welche Charakteristika das Substantiv beider Sprache enthält.
In dieser Hausarbeit werden die Flexionsparadigmen des deutschen Substantivs mit dem spanischen verglichen. Zuerst soll auf die Grundlagen der Sprachtypologie, die Klassifikationskriterien der Wortarten und auf allgemeines zur Flexionsmorphologie und zur Paradigmenbildung eingegangen werden. Im Anschluss wird die Flexionsmorphologie der Substantive beider Sprachen behandelt. Es soll erklärt werden, welche morphologischen Paradigmen des Substantivs im Deutschen und im Spanischen es gibt, wie diese Wortformen in der jeweiligen Sprache in Flexionsparadigmen organisiert sind, wie sich diese Wortformen innerhalb des bestimmten Paradigmas formal zueinander verhalten, wie die Substantive in den jeweiligen Sprachen dekliniert werden und wie sie sich unterscheiden. Schließlich wird analysiert, wie das Substantivische Paradigma im Deutschen und im Spanischen in der Nominalphrase aufgebaut ist.
Des Weiteren soll das spanische Nomen untersucht und dem deutschen gegenübergestellt werden. Anhand der Sprachtypologie werden dann die spanischen und deutschen Substantive verschiedenen Klassen zugeordnet. Dort wird erklärt, welcher typologische Zug bzw. zu welcher Typologie das deutsche Substantiv und das spanische Substantiv gehören.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachtypologie
- Der isolierende Typ
- Der agglutinierende Typ
- Der flektierende Typ
- Der introflexive Typ
- Der polysynthetische Typ
- Sprachtypologie und Wortarten
- Flexionsmorphologie und Paradigmenbildung
- Paradigmenbildung
- Hierarchien in Flexionsparadigmen
- Ikonismus und morphologische Formmittel
- Flexionsparadigmen des Substantivs im Deutschen
- Flexionsparadigmen des Substantivs im Spanischen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die typologischen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem spanischen Substantiv. Ausgehend von der komplexen Numerus- und Kasusmarkierung im Deutschen wird die flektierende Natur des Deutschen beleuchtet. Da Sprachen jedoch Mischformen verschiedener Typologien aufweisen, analysiert die Arbeit die charakteristischen Merkmale der Substantive in beiden Sprachen.
- Typologischer Vergleich des deutschen und spanischen Substantivs
- Analyse der Flexionsparadigmen beider Sprachen
- Untersuchung der morphologischen Organisation von Wortformen
- Klassifizierung der Substantive anhand der Sprachtypologie
- Vergleich des Aufbaus des Substantivischen Paradigmas in Nominalphrasen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: einen typologischen Vergleich des deutschen und spanischen Substantivs. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Flexionsparadigmen beider Sprachen und deren Vergleich beinhaltet, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die Substantive typologisch zu klassifizieren. Die Arbeit betont den mehrtypologischen Charakter von Sprachen und kündigt die Untersuchung der morphologischen Organisation der Wortformen an.
Sprachtypologie: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Sprachtypologie, basierend auf Ähnlichkeiten und Unterschieden in der Grammatik verschiedener Sprachen. Es beschreibt den Ansatz der modernen Typologieforschung, die grammatische Einheiten und Teilsysteme auf ihre typologische Struktur hin untersucht und klassifiziert. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der fünf morphologischen Sprachtypen nach Skalička: isolierend, agglutinierend, flektierend, introflexiv und polysynthetisch. Die Kapitel verdeutlicht, dass Sprachen oft Merkmale mehrerer Typen aufweisen.
Sprachtypologie und Wortarten: Dieses Kapitel setzt sich wahrscheinlich mit den Kriterien auseinander, die für die Klassifizierung von Wortarten in der Sprachtypologie relevant sind. Es legt vermutlich die Grundlage für die spätere Analyse der Substantive, indem es die theoretischen Rahmenbedingungen und die methodischen Ansätze definiert, die für die typologische Einordnung der Substantive im Deutschen und Spanischen entscheidend sind. Der genaue Inhalt ist aufgrund des unvollständigen Textes nicht präzise rekonstruierbar.
Flexionsmorphologie und Paradigmenbildung: Dieses Kapitel dürfte sich eingehend mit der Flexionsmorphologie und der Paradigmenbildung beschäftigen. Es wird vermutlich detailliert auf die Konzepte der Paradigmenbildung, der Hierarchien in Flexionsparadigmen und den Aspekt des Ikonismus in morphologischen Formmitteln eingegangen sein. Die Diskussion konzentriert sich auf die theoretischen Grundlagen, um die spätere Analyse der Flexionsparadigmen der Substantive im Deutschen und Spanischen zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Sprachtypologie, Substantiv, Deutsch, Spanisch, Flexion, Morphologie, Paradigmenbildung, Kasus, Numerus, Isolierend, Agglutinierend, Flektierend, Typologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachtypologischen Untersuchung des deutschen und spanischen Substantivs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die typologischen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem spanischen Substantiv. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Flexionsparadigmen beider Sprachen und deren typologischer Einordnung. Die Arbeit berücksichtigt, dass Sprachen oft Merkmale mehrerer Typologien aufweisen.
Welche Sprachtypologie wird behandelt?
Die Arbeit behandelt die fünf morphologischen Sprachtypen nach Skalička: isolierend, agglutinierend, flektierend, introflexiv und polysynthetisch. Es wird erläutert, dass Sprachen oft Merkmale mehrerer dieser Typen kombinieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Sprachtypologie, Sprachtypologie und Wortarten, Flexionsmorphologie und Paradigmenbildung, Flexionsparadigmen des Substantivs im Deutschen, Flexionsparadigmen des Substantivs im Spanischen und Schluss. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der typologischen Analyse der Substantive.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen typologischen Vergleich des deutschen und spanischen Substantivs durchzuführen. Sie analysiert die Flexionsparadigmen beider Sprachen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die Substantive typologisch zu klassifizieren. Die morphologische Organisation der Wortformen spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Aspekte der Morphologie werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Flexionsmorphologie und die Paradigmenbildung, einschließlich der Hierarchien in Flexionsparadigmen und des Ikonismus in morphologischen Formmitteln. Die Analyse konzentriert sich auf die Numerus- und Kasusmarkierung und den Aufbau des substantivischen Paradigmas in Nominalphrasen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachtypologie, Substantiv, Deutsch, Spanisch, Flexion, Morphologie, Paradigmenbildung, Kasus, Numerus, Isolierend, Agglutinierend, Flektierend, Typologie.
Wie wird der typologische Vergleich durchgeführt?
Der typologische Vergleich erfolgt durch die Analyse der Flexionsparadigmen des deutschen und spanischen Substantivs. Die Arbeit untersucht die morphologische Organisation der Wortformen und klassifiziert die Substantive anhand der Kriterien der Sprachtypologie.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Analyse der Flexionsparadigmen beider Sprachen und deren Vergleich beinhaltet. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und die Substantive typologisch zu klassifizieren. Die Untersuchung der morphologischen Organisation der Wortformen ist ein wichtiger Bestandteil der Methodik.
- Quote paper
- Isadora Rojas Marquez (Author), 2010, Sprachtypologie und Wortarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/176781