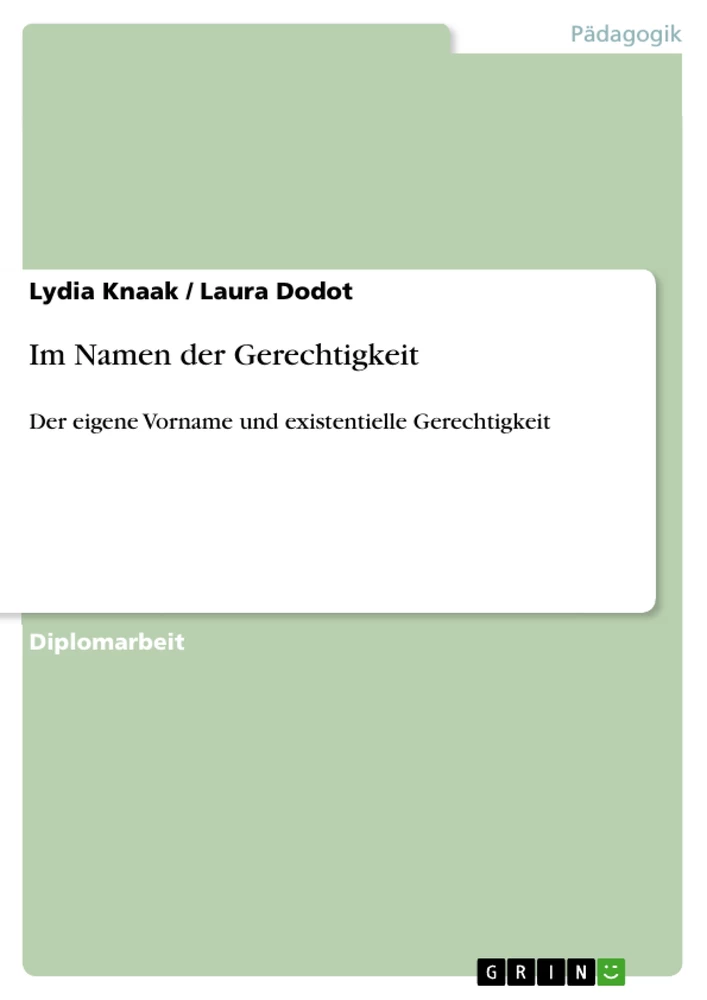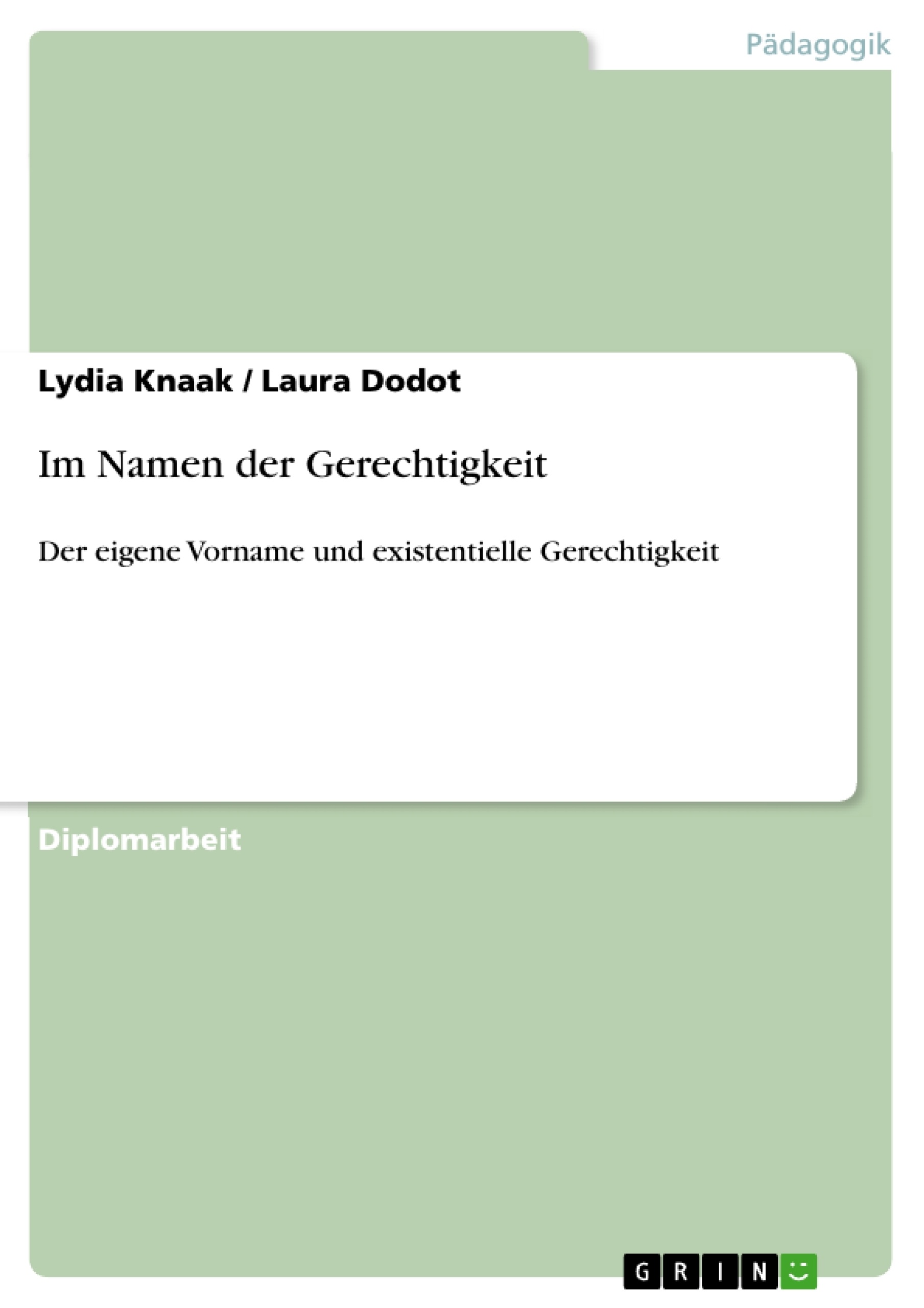Nomen est omen. Der Name ist Programm.
Sowohl früher wusste als auch heute weiß man, dass der Name nicht nur Schall und Rauch ist, sondern durchaus zur Individualität eines Menschen beiträgt.
Aufmerksam geworden auf die Thematik, sind wir durch ein Abonnement der Zeitschrift Psychologie Heute. Der bisher nur rar ergründete Bereich der Vornamenforschung war daher für uns die Anregung zur Verfassung einer Diplomarbeit über Gerechtigkeit und Vornamen.
Angefertigt wurde die Diplomarbeit im Studiengang Pädagogik mit dem Langfach der Pädagogischen Psychologie unter Leitung von Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Maes an der Universität der Bundeswehr München.
Die vorliegende Arbeit ist eine selbstentwickelte Studie, welche die tatsächlichen Einflussfaktoren eines individuellen Gerechtigkeitsempfindens aufgrund des gegebenen Vornamens darstellen soll. Ein Zusammenhang zwischen den Ursachenzuschreibungen des eigenen Vornamens und der damit verbundenen Veränderung der subjektiven existentiellen Gerechtigkeit wird somit aufgedeckt.
Darüber hinaus soll diese Niederschrift als Grundlagenmaterial für später anschließende Forschungen in diesem Bereich dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Vorname als Forschungsgegenstand
- Onomastik
- Geschichte des Vornamens
- Namensrechte
- Formelles Vornamensrecht
- Materielles Vornamensrecht
- Rechtslagen zur Namensänderung
- Kevin und Chantal - Von Klischees und Vorurteilen
- „Status Quo“ der Namensforschung
- Soziale Wahrnehmung von Vornamen
- „Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose!“
- Der Vorname als gesellschaftliches Gut
- Schichtspezifische Faktoren der Vornamensgebung
- Geschlechtsspezifische Faktoren
- Vorname und Identität
- Was ist schon gerecht?
- Theorie des Gerechte-Welt-Glaubens
- Ungerechtigkeitsempfinden/Ungerechtigkeitssensibilität
- Umgang mit Ungerechtigkeit
- Verteilungsprinzipien
- Das Leistungsprinzip
- Das Gleichheitsprinzip
- Das Bedürftigkeitsprinzip
- Das übersinnliche Verteilungsprinzip
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem eigenen Vornamen und dem individuellen Gerechtigkeitsempfinden. Ziel ist es, tatsächliche Einflussfaktoren des Gerechtigkeitsempfindens aufgrund des Vornamens aufzudecken und einen möglichen Zusammenhang zwischen Ursachenzuschreibungen zum eigenen Vornamen und der damit verbundenen Veränderung der subjektiven existentiellen Gerechtigkeit zu belegen. Die Arbeit soll zudem als Grundlage für zukünftige Forschungen in diesem Bereich dienen.
- Der Vorname als soziales Konstrukt und seine Bedeutung für die Identität
- Die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens und ihr Bezug zum Gerechtigkeitsempfinden
- Unterschiedliche Verteilungsprinzipien von Gerechtigkeit
- Der Einfluss von Vornamen auf die soziale Wahrnehmung und Vorurteile
- Schichtspezifische und geschlechtsspezifische Faktoren der Vornamensgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den Vornamen als Forschungsgegenstand etabliert. Es beleuchtet die Onomastik, die Geschichte des Vornamens, das Namensrecht (formal, materiell und Rechtslagen zur Namensänderung), Klischees und Vorurteile im Zusammenhang mit bestimmten Vornamen, den aktuellen Stand der Namensforschung (soziale Wahrnehmung und Vorurteile), und die gesellschaftliche Bedeutung des Vornamens (schichtspezifische und geschlechtsspezifische Faktoren). Es wird der Zusammenhang zwischen Vorname und Identität hergestellt und die Relevanz der Thematik für die Untersuchung des Gerechtigkeitsempfindens begründet.
Was ist schon gerecht?: Dieses Kapitel befasst sich mit dem zentralen Konzept der Gerechtigkeit. Es präsentiert die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens, erläutert das Ungerechtigkeitsempfinden und den Umgang damit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Diskussion verschiedener Verteilungsprinzipien (Leistung, Gleichheit, Bedürftigkeit, übersinnliches Prinzip), die das Verständnis von Gerechtigkeit prägen und im Kontext der Vornamenforschung relevant sind. Die Kapitel legen die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung dar.
Schlüsselwörter
Vorname, Gerechtigkeitsempfinden, Gerechter-Welt-Glaube, Namensforschung, soziale Wahrnehmung, Vorurteile, Identität, Verteilungsprinzipien, Schichtspezifische Faktoren, Geschlechtsspezifische Faktoren, Onomastik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vorname und Gerechtigkeitsempfinden
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem eigenen Vornamen und dem individuellen Gerechtigkeitsempfinden. Es wird analysiert, ob und wie der Vorname das Empfinden von Gerechtigkeit beeinflusst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Onomastik (Wissenschaft der Eigennamen), die Geschichte und das Recht der Vornamen, Klischees und Vorurteile im Zusammenhang mit bestimmten Vornamen, die soziale Wahrnehmung von Vornamen, schichtspezifische und geschlechtsspezifische Faktoren der Vornamensgebung, sowie die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens und verschiedene Verteilungsprinzipien von Gerechtigkeit (Leistung, Gleichheit, Bedürftigkeit, übersinnliches Prinzip).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, tatsächliche Einflussfaktoren des Gerechtigkeitsempfindens aufgrund des Vornamens aufzudecken und einen möglichen Zusammenhang zwischen Ursachenzuschreibungen zum eigenen Vornamen und der damit verbundenen Veränderung der subjektiven existentiellen Gerechtigkeit zu belegen. Die Arbeit soll zudem als Grundlage für zukünftige Forschungen dienen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einführung, die den Vornamen als Forschungsgegenstand etabliert und den aktuellen Stand der Namensforschung beleuchtet, und einem Kapitel, das sich mit dem Konzept der Gerechtigkeit, der Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens und verschiedenen Verteilungsprinzipien auseinandersetzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vorname, Gerechtigkeitsempfinden, Gerechter-Welt-Glaube, Namensforschung, soziale Wahrnehmung, Vorurteile, Identität, Verteilungsprinzipien, schichtspezifische Faktoren, geschlechtsspezifische Faktoren, Onomastik.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Vorname und Gerechtigkeit untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Vornamens auf die soziale Wahrnehmung, Vorurteile und die individuelle Identität, um so einen möglichen Einfluss auf das Gerechtigkeitsempfinden aufzuzeigen. Die theoretischen Grundlagen werden durch die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens und verschiedene Verteilungsprinzipien gelegt.
Welche Bedeutung hat die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens in der Arbeit?
Die Theorie des Gerechten-Welt-Glaubens dient als theoretisches Gerüst, um das Gerechtigkeitsempfinden und den Umgang mit Ungerechtigkeit zu verstehen. Sie hilft, die möglichen Auswirkungen des Vornamens auf das Empfinden von Gerechtigkeit zu analysieren.
Welche Verteilungsprinzipien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert das Leistungsprinzip, das Gleichheitsprinzip, das Bedürftigkeitsprinzip und ein übersinnliches Verteilungsprinzip im Kontext des Gerechtigkeitsempfindens und deren möglicher Beziehung zum Vornamen.
- Arbeit zitieren
- Lydia Knaak (Autor:in), Laura Dodot (Autor:in), 2011, Im Namen der Gerechtigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/176497