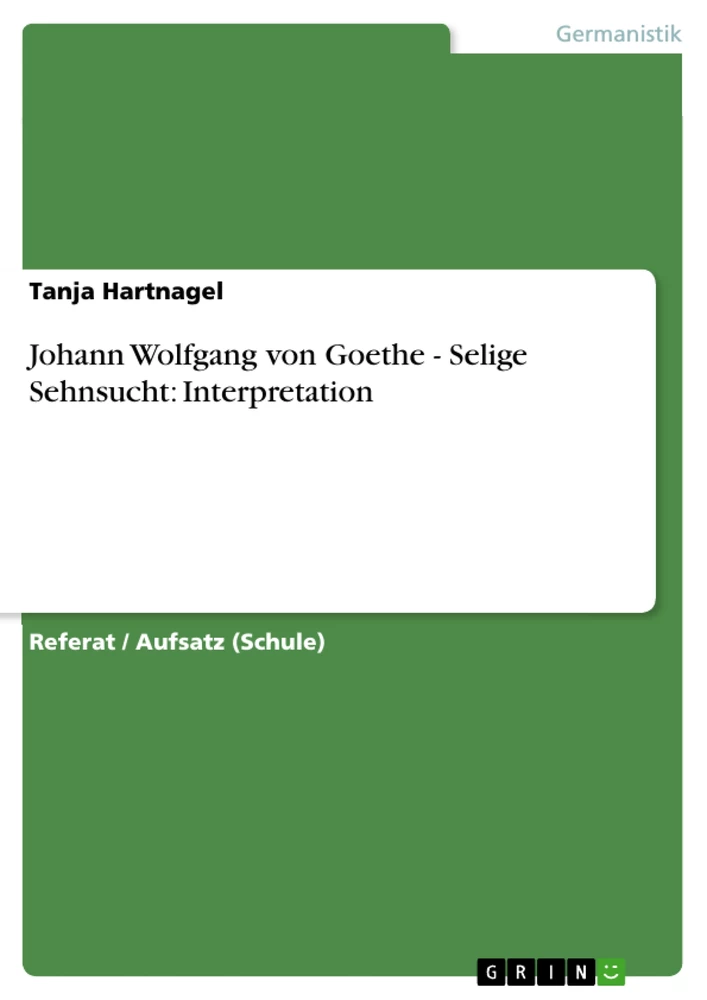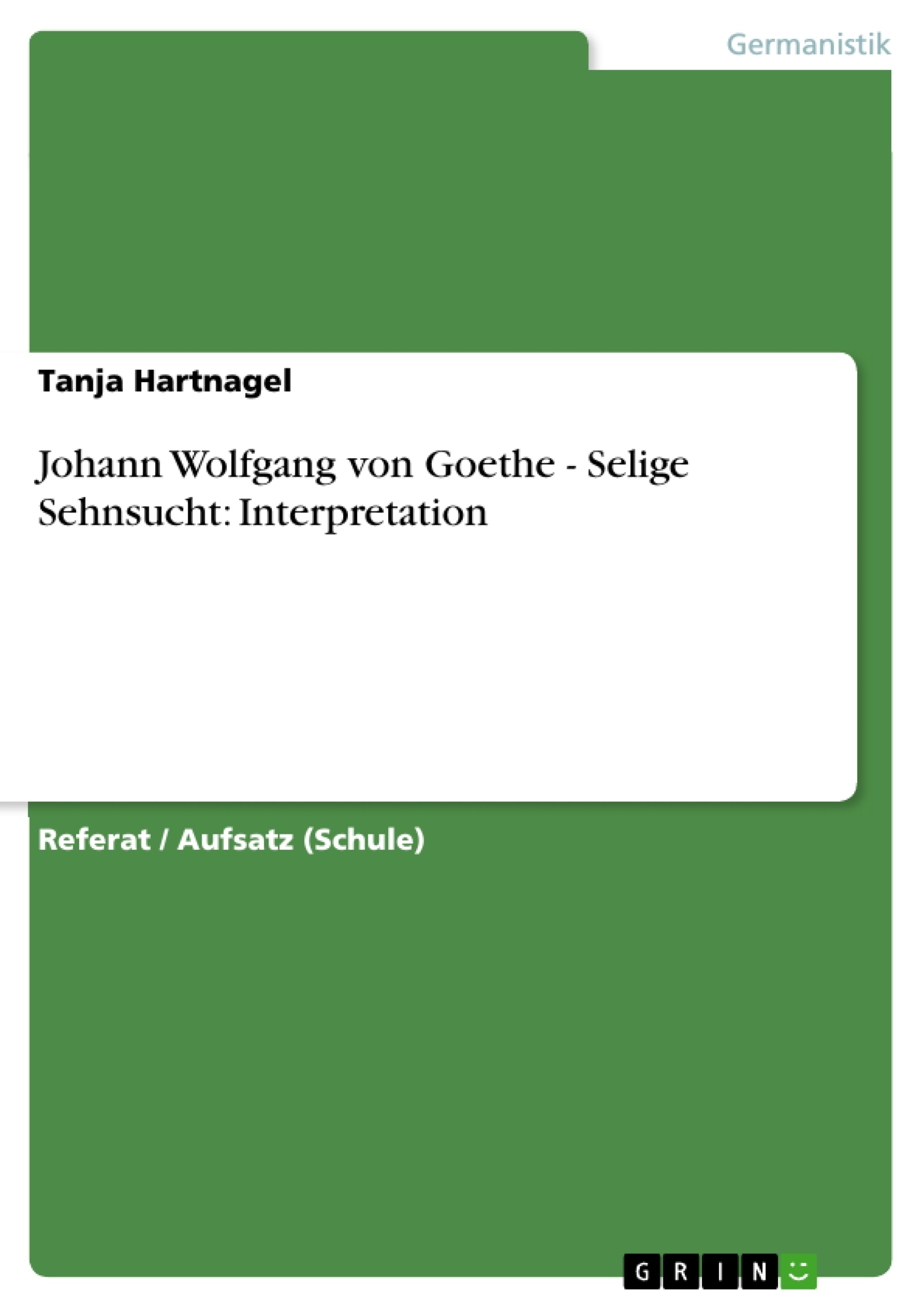Johann Wolfgang von Goethe: „Selige Sehnsucht“
Menschen haben vor vielem Angst, sei es vor Prüfungen, vor Tieren wie Schlangen oder Spinnen oder vor der Armut. Die meisten Menschen haben aber vor allem Angst vor Krankheiten, Unfällen oder dem Verlust eines lieben Menschen – kurz gesagt, sie haben Angst vor dem Tod. Diese Angst vor dem Tod greift Johann Wolfgang von Goethe in seinem Gedicht „Selige Sehnsucht auf“, das lyrische Ich in seinem Gedicht behauptet allerdings, dass es sich nach dem Tod sehnt, was die große Allgemeinheit aber nicht verstehen könne, weil sie davor Angst haben.
[...]
Das Gedicht lässt sich inhaltlich in zwei Teile gliedern. Die Strophen 1 und 5 bilden eine Art Rahmenhandlung, in dem sich das lyrische Ich an den Leser wendet. In den Strophen 2-4 redet das lyrische Ich mit einem Schmetterling und erzählt dessen Schicksal. Der Schmetterling führt zu Beginn noch ein normales Leben, doch dann entdeckt er eine brennende Kerze und nähert sich ihr aus Verlangen, bis sie ihn verbrennt und er somit stirbt.
Bereits in der Überschrift spiegelt sich das Verlangen, die „Sehnsucht“ nach etwas wieder. „Selige Sehnsucht“ weist auch darauf hin, dass nicht das Erreichen von etwas Bestimmten einen glücklich macht, sondern dass bereits die Sehnsucht nach etwas zu einem Zustand des vollkommenen Glückes führen kann.
Gleich zu Beginn des Gedichts, in den ersten beiden Versen betont das lyrische Ich, dass das, was es zu sagen hat, nur „den Weisen“ gesagt werden soll, weil es „die Menge gleich verhöhnet“. Daraus wird zum einen ersichtlich, dass sich das lyrische Ich selbst für weise hält, und zum anderen, dass es voraussetzt, dass der Leser auch weise genug ist, um seine Gedanken nachzuvollziehen. „Die Menge“, also die überwiegende Allgemeinheit, wird aber im selben Augenblick als ignorant oder nichtswissend dargestellt, denn sie würde das lyrische Ich schließlich nur dann verhöhnen, wenn sie nicht verstehen würde, was es ausdrücken will.
Erst nach dieser Ermahnung an den Leser folgt in den Versen 3 und 4 die Aussage, die die Allgemeinheit nicht verstehen würde: Das lyrische Ich erklärt, dass es „das Lebendge“ preisen will, das sich „nach Flammentod“ sehnt. Dieser Ausdruck, dass das Leben gepriesen werden soll, das sich nach dem Tode sehnt scheint zunächst ein offensichtlicher Widerspruch zu sein später im Gedicht wird aber klar, dass es sich hier um ein Paradoxon handelt.
[...]
Johann Wolfgang von Goethe: „Selige Sehnsucht“
Menschen haben vor vielem Angst, sei es vor Prüfungen, vor Tieren wie Schlangen oder Spinnen oder vor der Armut. Die meisten Menschen haben aber vor allem Angst vor Krankheiten, Unfällen oder dem Verlust eines lieben Menschen – kurz gesagt, sie haben Angst vor dem Tod. Diese Angst vor dem Tod greift Johann Wolfgang von Goethe in seinem Gedicht „Selige Sehnsucht auf“, das lyrische Ich in seinem Gedicht behauptet allerdings, dass es sich nach dem Tod sehnt, was die große Allgemeinheit aber nicht verstehen könne, weil sie davor Angst haben.
„Selige Sehnsucht“ besteht aus 5 Strophen mit je 4 Versen. Das Reimschema besteht aus einem Kreuzreim pro Strophe, wobei sich immer der 1. und der 3. Vers und der 2. und 4. reimen. Weibliche Kadenzen sind in dem Gedicht vorrangig, auffällig sind jedoch die vier männlichen Kadenzen in den Versen 14, 16, 17 und 19. Das verwendete Metrum ist meist ein 4-hebiger Trochäus, in den Versen 18 und 20 ist es aber ein 3-hebiger Trochäus. Durch die Änderungen in den Kadenzen und im Metrum wird vor allem die letzte Strophe von den anderen stilistisch abgehoben.
Das Gedicht lässt sich inhaltlich in zwei Teile gliedern. Die Strophen 1 und 5 bilden eine Art Rahmenhandlung, in dem sich das lyrische Ich an den Leser wendet. In den Strophen 2-4 redet das lyrische Ich mit einem Schmetterling und erzählt dessen Schicksal. Der Schmetterling führt zu Beginn noch ein normales Leben, doch dann entdeckt er eine brennende Kerze und nähert sich ihr aus Verlangen, bis sie ihn verbrennt und er somit stirbt.
Bereits in der Überschrift spiegelt sich das Verlangen, die „Sehnsucht“ nach etwas wieder. „Selige Sehnsucht“ weist auch darauf hin, dass nicht das Erreichen von etwas Bestimmten einen glücklich macht, sondern dass bereits die Sehnsucht nach etwas zu einem Zustand des vollkommenen Glückes führen kann.
Gleich zu Beginn des Gedichts, in den ersten beiden Versen betont das lyrische Ich, dass das, was es zu sagen hat, nur „den Weisen“ gesagt werden soll, weil es „die Menge gleich verhöhnet“. Daraus wird zum einen ersichtlich, dass sich das lyrische Ich selbst für weise hält, und zum anderen, dass es voraussetzt, dass der Leser auch weise genug ist, um seine Gedanken nachzuvollziehen. „Die Menge“, also die überwiegende Allgemeinheit, wird aber im selben Augenblick als ignorant oder nichtswissend dargestellt, denn sie würde das lyrische Ich schließlich nur dann verhöhnen, wenn sie nicht verstehen würde, was es ausdrücken will.
Erst nach dieser Ermahnung an den Leser folgt in den Versen 3 und 4 die Aussage, die die Allgemeinheit nicht verstehen würde: Das lyrische Ich erklärt, dass es „das Lebendge“ preisen will, das sich „nach Flammentod“ sehnt. Dieser Ausdruck, dass das Leben gepriesen werden soll, das sich nach dem Tode sehnt scheint zunächst ein offensichtlicher Widerspruch zu sein später im Gedicht wird aber klar, dass es sich hier um ein Paradoxon handelt. Goethe hat diese beiden Verse mithilfe einer Anapher auch sprachlich eng miteinander verbunden. Das Lebewesen, das sich nach dem Tod in den Flammen sehnt, wird in den folgenden drei Strophen durch das Bild eines Schmetterlings symbolisiert, der in den Flammen einer Kerze umkommt. Dass das beschriebene Lebewesen ein Schmetterling ist, wird aber erst in Vers 16 enthüllt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Selige Sehnsucht“?
Das Gedicht thematisiert die Sehnsucht nach dem Tod, die im Gegensatz zur allgemeinen Angst vor dem Tod steht. Das lyrische Ich preist das Lebendige, das sich nach dem Flammentod sehnt, und wird durch das Bild eines Schmetterlings symbolisiert, der in einer Kerze verbrennt.
Wie ist das Gedicht aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus 5 Strophen mit je 4 Versen. Das Reimschema ist ein Kreuzreim pro Strophe. Das Metrum ist meist ein 4-hebiger Trochäus, wobei die letzte Strophe stilistisch durch Änderungen in Kadenzen und Metrum hervorgehoben wird. Inhaltlich kann das Gedicht in eine Rahmenhandlung (Strophen 1 und 5) und die Schilderung des Schmetterlingsschicksals (Strophen 2-4) unterteilt werden.
Was bedeutet der Titel „Selige Sehnsucht“?
Der Titel deutet an, dass nicht das Erreichen eines Ziels glücklich macht, sondern bereits die Sehnsucht selbst zu einem Zustand des Glücks führen kann. Das Verlangen nach etwas, hier dem Tod, ist zentral.
Wen spricht das lyrische Ich im Gedicht an?
Das lyrische Ich wendet sich in erster Linie an „die Weisen“, da es davon ausgeht, dass „die Menge“ seine Gedanken nicht verstehen und es verhöhnen würde. Es setzt also ein gewisses Verständnis und eine intellektuelle Reife beim Leser voraus.
Welche sprachlichen Mittel werden verwendet?
Das Gedicht verwendet sprachliche Mittel wie Kreuzreim, Trochäus, Anapher und Paradoxon. Besonders die Anapher in den Versen 3 und 4 betont die Verbindung zwischen Leben und dem Verlangen nach dem Tod.
Was symbolisiert der Schmetterling im Gedicht?
Der Schmetterling symbolisiert das Lebewesen, das sich nach dem Tod in den Flammen sehnt. Sein Schicksal, die Annäherung an die brennende Kerze bis zum Tod, illustriert die im Gedicht beschriebene Sehnsucht.
- Quote paper
- Tanja Hartnagel (Author), 2009, Johann Wolfgang von Goethe - Selige Sehnsucht: Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/175139