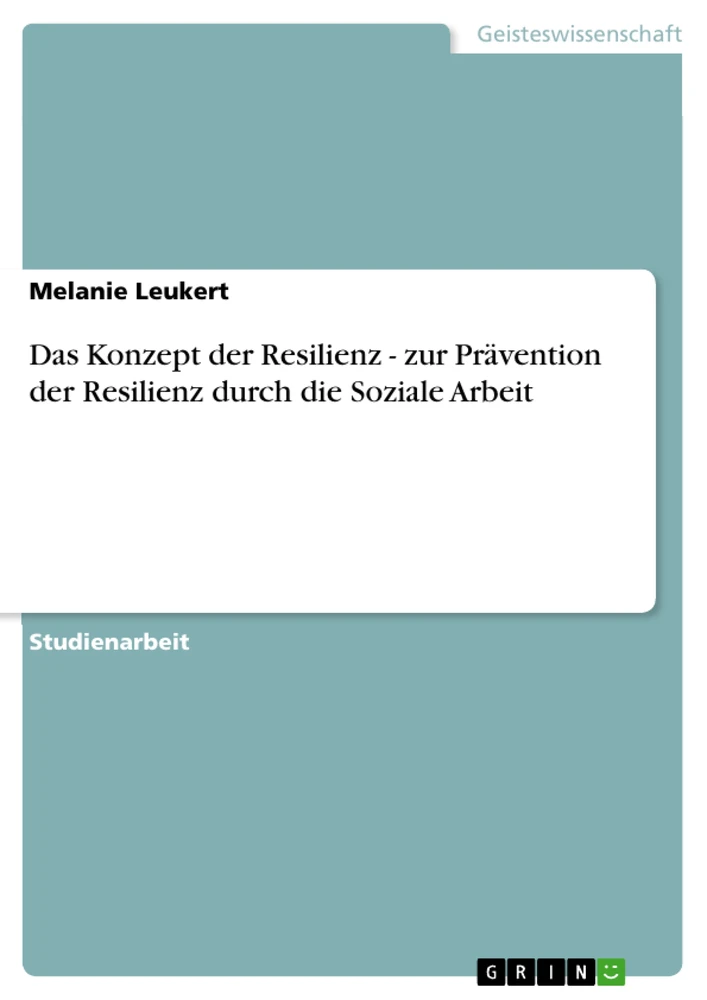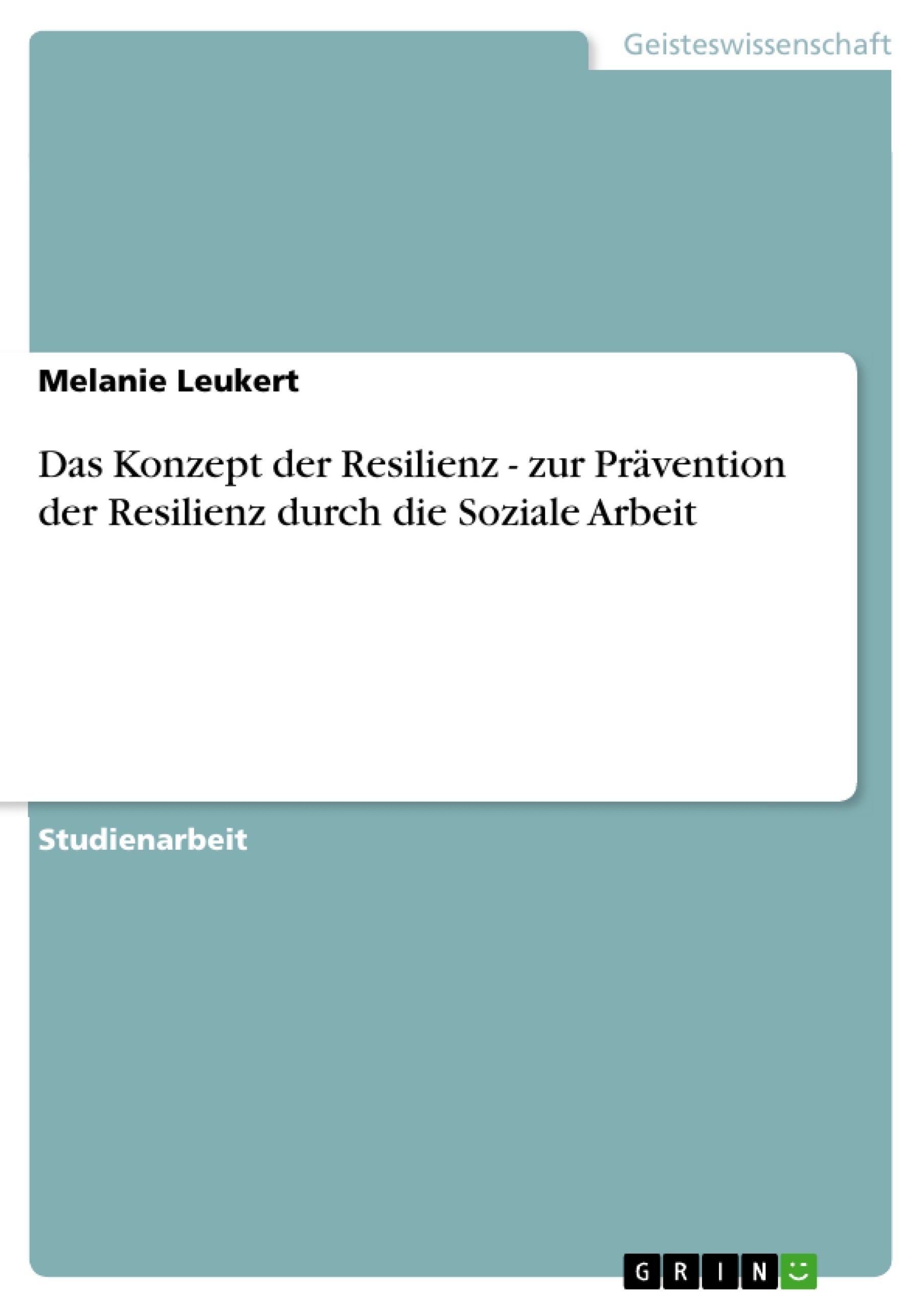Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Problemaufriss 1
1.2 Zentrale Fragestellungen 1
1.2 Methodische Vorgehensweise 2
2 Definitionen 2
2.1 Geschichte des Resilienzbegriffs 2
2.1.1 frühe Definition von Resilienz 3
2.1.2 heutige Definition von Resilienz 4
2.2 Soziale Arbeit nach dem International Federation of Social Workers 4
2.3 Frühförderung und Prävention 5
3 Studien der Resilienzforschung 5
3.1 Emmy E. Werner – Kauai-Längsschnittstudie 5
3.2 Die „Mannheimer Risikokinderstudie“ von Laucht et al 7
3.3 Forschungsergebnisse 8
3.3.1 personale Ressourcen 9
3.3.2 soziale Schutzfaktoren 9
4 Resilienzkonzepte und Modelle 10
4.1 Risikofaktorenkonzept 10
4.2 Schutzfaktorenkonzept 12
4.3 Modell der Kompensation 14
4.4 Modell der Herausforderung 14
5 Frühförderung von Resilienz und Umsetzung in die 15
sozialarbeiterische Praxis 15
6 Zusammenfassung 17
Quellenverzeichnis 20
Anhang 22
Eidesstattliche Erklärung 24
1 Einleitung
„Aus pädagogischer Sicht lässt sich das Aufwachsen von Kindern als Abfolge
manchmal mehr, manchmal weniger gelingender Entwicklungsschritte betrachten,
und vor allem die weniger erfolgreichen Entwicklungsschritte erfahren
traditionellerweise die größte Aufmerksamkeit.“ (Wustmann 2004, 9). Corina
Wustmann spricht ein Phänomen an, welches sowohl aktuell als auch historisch
betrachtet Lebensläufe von Menschen beeinflusst. Noch heute berichten
Holocaustopfer von dramatischen Erlebnissen in Konzentrations- und
Arbeitslagern. In den Nachrichten häufen sich Beiträge über misshandelte und
vernachlässigte Kinder. Naturkatastrophen vernichten die Existenzen tausender
Bürger. Viele Jungen und Mädchen leben heute in Multiproblemfamilien. Die
Dynamik der sich wandelnden Gesellschaft fordert daher auch eine immer
schnellere Anpassung und Vermittlung von Kompetenzen an die Kinder.
1.1 Problemaufriss
Die Meinung der Öffentlichkeit tendierte lange Zeit dahin, dass – teilweise durch
die Medien verbreitet – die Kindheit einen prägenden Einfluss auf das gesamte
Leben hat. Wachsende Belastungen, denen Kinder heute vermehrt ausgesetzt
sind, galten in früherer Zeit als Ursache dramatischer Beeinträchtigungen.
Erstaunlich ist, dass es eine große Zahl von Heranwachsenden gibt, welche sich
ungeachtet schwieriger Bedingungen unauffällig, positiv und gesund entwickelten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemaufriss
- Zentrale Fragestellungen
- Methodische Vorgehensweise
- Definitionen
- Geschichte des Resilienzbegriffs
- frühe Definition von Resilienz
- heutige Definition von Resilienz
- Soziale Arbeit nach dem International Federation of Social Workers
- Frühförderung und Prävention
- Studien der Resilienzforschung
- Emmy E. Werner – Kauai-Längsschnittstudie
- Die „Mannheimer Risikokinderstudie“ von Laucht et al
- Forschungsergebnisse
- personale Ressourcen
- soziale Schutzfaktoren
- Resilienzkonzepte und Modelle
- Risikofaktorenkonzept
- Schutzfaktorenkonzept
- Modell der Kompensation
- Modell der Herausforderung
- Frühförderung von Resilienz und Umsetzung in die sozialarbeiterische Praxis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Resilienz und dessen Prävention durch Soziale Arbeit. Sie zielt darauf ab, die Entwicklung von Resilienz bei Kindern zu analysieren und aufzuzeigen, wie Heranwachsende mit Hilfe von Sozialarbeiter*innen Risikofaktoren minimieren und Schutzfaktoren stärken können.
- Geschichte und Definition des Resilienzbegriffs
- Studien und Forschungsergebnisse zur Resilienz
- Resilienzkonzepte und -modelle, insbesondere das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept
- Frühförderung von Resilienz und deren Umsetzung in der sozialarbeiterischen Praxis
- Bedeutung von Präventionsmaßnahmen für die Arbeit mit Kindern in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Resilienz ein und beschreibt die zentrale Problematik der Entwicklung von Kindern in schwierigen Lebensumständen. Sie stellt die wichtigsten Fragestellungen der Arbeit vor und erläutert die methodische Vorgehensweise.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Definitionen und der Geschichte des Resilienzbegriffs. Es beleuchtet frühere und heutige Definitionen und betrachtet die Entwicklung des Begriffs in verschiedenen Disziplinen.
Im dritten Kapitel werden Studien der Resilienzforschung vorgestellt, darunter die Kauai-Längsschnittstudie von Emmy E. Werner und die Mannheimer Risikokinderstudie von Manfred Laucht et al. Es werden die zentralen Forschungsergebnisse zusammengefasst, insbesondere die Bedeutung von personalen und sozialen Ressourcen für die Resilienzentwicklung.
Das vierte Kapitel behandelt verschiedene Resilienzkonzepte und -modelle, wobei der Fokus auf dem Risiko- und Schutzfaktorenkonzept liegt. Es werden die unterschiedlichen Ansätze zur Analyse und Förderung von Resilienz dargestellt.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frühförderung von Resilienz und deren Umsetzung in die sozialarbeiterische Praxis. Es werden konkrete Maßnahmen und Interventionen beschrieben, die Sozialarbeiter*innen einsetzen können, um die Resilienzentwicklung von Kindern zu fördern.
Schlüsselwörter
Resilienz, Frühförderung, Prävention, Risiko- und Schutzfaktoren, Soziale Arbeit, Kinder, Entwicklung, Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Kompetenzentwicklung, Handlungsbefähigung, Interventionsstrategien, Sozialpädagogische Praxis.
- Quote paper
- Melanie Leukert (Author), 2011, Das Konzept der Resilienz - zur Prävention der Resilienz durch die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/174953