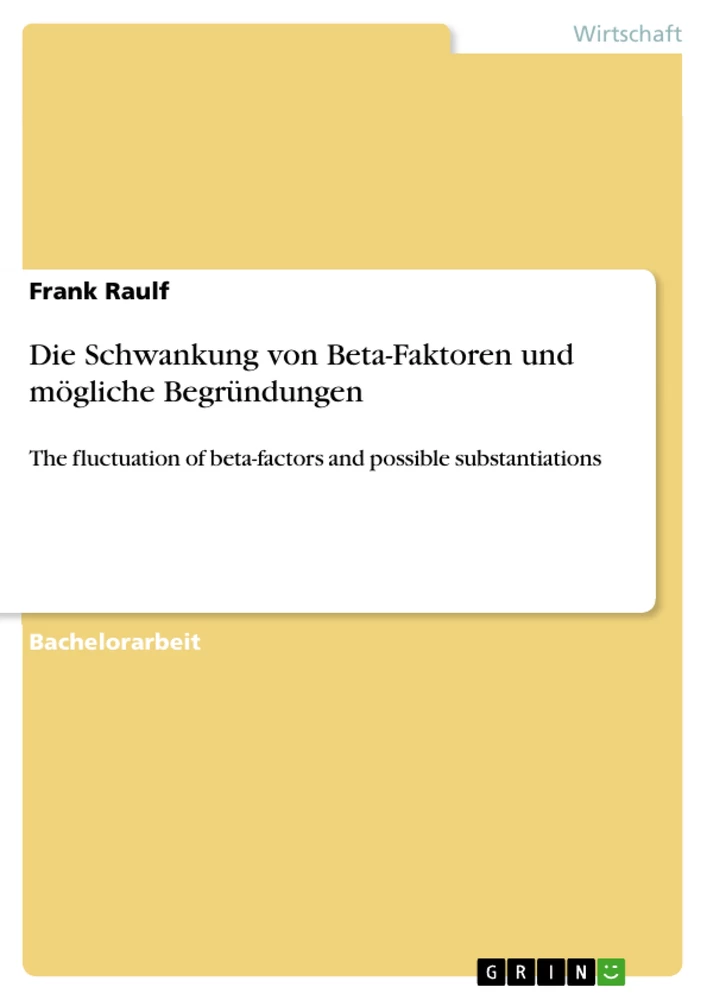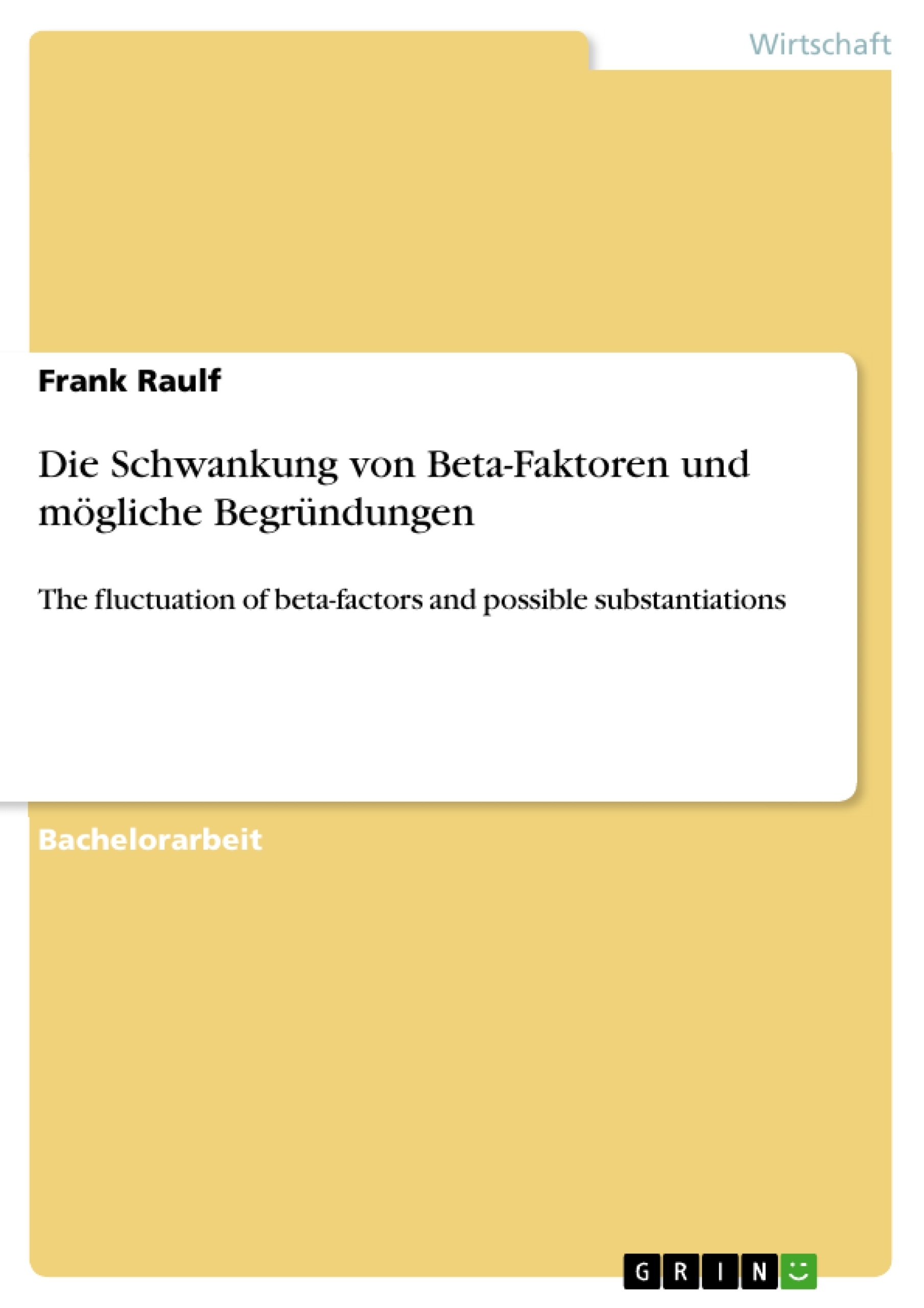Die Schwankung des relativen systematischen Risikos eines Unternehmens wird in diesem Buch von ökonomischen als auch ökonometrischen Blickwinkeln betrachtet. Die Methoden der Ökonometrie im Bezug auf die Fragestellung: "Warum schwanken Betafaktoren überhaupt?" werden auf einfache Weise erklärt. Zuerst wird der Betafaktor und die optimale Portfoliogewichtung durch Beispiele vorgestellt, um dann anhand zweier Berechnungszeitfenster auf die mathematischen Gründe, die auch ökonomisch erklärt werden, einzugehen. Letztendlich wird ein Faktormodell zur Klärung der Einflussfaktoren der Betafaktorenvariation aufgestellt auf das zum Schluss ein Resümee folgt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Der Betafaktor β
- 1.1 Das effiziente Portfolio (Tangentialportfolio)
- 1.2 Risikoprämie, Subadditivität und CAPM
- 2. Die Empire
- 2.1 Datenerhebung
- 2.2 Validität
- 2.3 Konklusion
- 3. Betafaktorenschwankung
- 3.1 Tägliche Schwankung
- 3.2 Ökonometrische Begründung der Schwankung
- 3.2.1 Varianzdekomposition
- 3.2.2 Konklusion
- 4. Die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität
- 4.1 Aufspaltung des systematischen Risikos
- 4.2 Das Faktormodell von BMW
- 4.2.1 Die Orthogonalisierung
- 4.2.2 Konklusion und Ausblick
- 4.3 Das Faktormodell von e.on
- 4.3.1 Konklusion
- 5. Warum ist β (Versorger) manchmal >1?
- 5.1 Betaadjustierung
- 6. Zusammenfassung und Fazit der Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Schwankungen von Betafaktoren und deren mögliche Ursachen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Betafaktoren und ihrer Volatilität zu entwickeln und ökonometrische sowie ökonomische Erklärungen für diese Schwankungen zu liefern.
- Der Betafaktor als Maß für das systematische Risiko
- Die Schwankung von Betafaktoren über die Zeit
- Ökonometrische Modellierung der Betavolatilität
- Ökonomische Faktoren, die die Betavolatilität beeinflussen
- Anwendung der Modelle auf Fallstudien von BMW und e.on
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Betafaktoren und ihrer Schwankungen ein. Sie stellt den historischen Kontext der Portfoliotheorie dar, beginnend mit frühen Ansätzen bis hin zum Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM). Es werden verschiedene Risikodefinitionen und deren Relevanz im Kontext der Investitionsentscheidungen diskutiert. Die Market-Efficiency-Hypothesis (MEH) wird vorgestellt und die Bedeutung des systematischen Risikos im Zusammenhang mit Betafaktoren hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Frage nach dem Ursprung der Betafaktorenschwankungen und ob konjunkturelle Einflüsse hierfür verantwortlich sind.
2. Die Empire: Dieses Kapitel beschreibt den empirischen Teil der Arbeit. Es erläutert die Datenerhebungsmethoden, die zur Bestimmung der Betafaktoren für ausgewählte Unternehmen verwendet wurden, und diskutiert die Validität der gewonnenen Daten. Die Konklusion dieses Kapitels fasst die wichtigsten Ergebnisse der empirischen Analyse zusammen und dient als Grundlage für die weiteren Kapitel.
3. Betafaktorenschwankung: In diesem Kapitel wird die tägliche Schwankung der Betafaktoren analysiert. Die ökonometrische Begründung der Schwankungen wird mittels einer Varianzdekomposition untersucht. Die Ergebnisse der Varianzdekomposition werden interpretiert, und die Konklusion fasst die gewonnenen Erkenntnisse über die Ursachen der Betafaktorenschwankungen zusammen.
4. Die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität: Dieses Kapitel untersucht die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität. Es beginnt mit der Aufspaltung des systematischen Risikos in verschiedene Einflussfaktoren. Anschließend werden Faktormodelle für BMW und e.on entwickelt und analysiert. Die Orthogonalisierung der Faktoren wird erläutert, und die jeweilige Konklusion fasst die Bedeutung der identifizierten Faktoren für die Betavolatilität zusammen. Ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen wird gegeben.
5. Warum ist β (Versorger) manchmal >1?: Dieses Kapitel befasst sich mit der scheinbaren Paradoxie, dass Betafaktoren von Versorgerunternehmen manchmal größer als 1 sind. Es wird die Betaadjustierung erläutert und mögliche Erklärungen für dieses Phänomen diskutiert.
Schlüsselwörter
Betafaktor, Betavolatilität, systematisches Risiko, CAPM, Varianzdekomposition, Faktormodell, BMW, e.on, Konjunktur, Risikoprämie, Portfoliotheorie, Ökonometrie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Betafaktorenschwankungen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Schwankungen von Betafaktoren und deren Ursachen. Sie zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Betafaktoren und ihrer Volatilität zu entwickeln und ökonometrische sowie ökonomische Erklärungen für diese Schwankungen zu liefern. Die Arbeit beinhaltet eine empirische Analyse anhand von Fallstudien (BMW und e.on).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Betafaktor als Maß für das systematische Risiko, die Schwankung von Betafaktoren über die Zeit, ökonometrische Modellierung der Betavolatilität, ökonomische Faktoren, die die Betavolatilität beeinflussen und die Anwendung der Modelle auf Fallstudien von BMW und e.on. Darüber hinaus wird die scheinbar paradoxe Situation, dass Betafaktoren von Versorgern manchmal größer als 1 sind, untersucht und erklärt.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl ökonometrische als auch ökonomische Methoden. Im ökonometrischen Teil wird eine Varianzdekomposition eingesetzt, um die Betavolatilität zu analysieren. Im ökonomischen Teil werden Faktormodelle entwickelt und angewendet, um die Ursachen der Betavolatilität zu untersuchen. Die Datenerhebung und die Validität der Daten werden ebenfalls detailliert beschrieben.
Welche Fallstudien werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Betafaktoren und deren Schwankungen anhand von Fallstudien der Unternehmen BMW und e.on. Die Ergebnisse der Analyse dieser Unternehmen dienen dazu, die entwickelten Modelle zu illustrieren und zu validieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik, Portfoliotheorie, CAPM, systematisches Risiko und die Market-Efficiency-Hypothesis), Die Empire (empirische Analyse, Datenerhebung und -validität), Betafaktorenschwankung (tägliche Schwankung und ökonometrische Begründung mittels Varianzdekomposition), Die ökonomischen Ursachen der Betavolatilität (Aufspaltung des systematischen Risikos, Faktormodelle für BMW und e.on), Warum ist β (Versorger) manchmal >1? (Erklärung der scheinbar paradoxen Situation) und Zusammenfassung und Fazit der Untersuchung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Betafaktor, Betavolatilität, systematisches Risiko, CAPM, Varianzdekomposition, Faktormodell, BMW, e.on, Konjunktur, Risikoprämie, Portfoliotheorie, Ökonometrie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Betafaktoren und ihrer Volatilität zu entwickeln und ökonometrische sowie ökonomische Erklärungen für diese Schwankungen zu liefern.
- Quote paper
- Frank Raulf (Author), 2011, Die Schwankung von Beta-Faktoren und mögliche Begründungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/174938