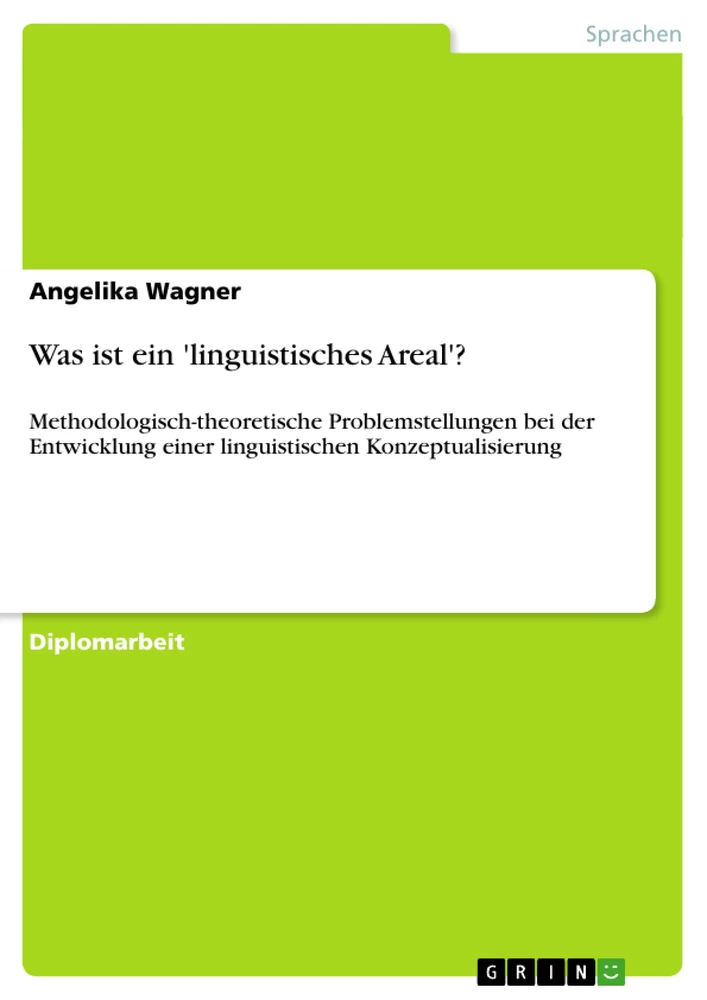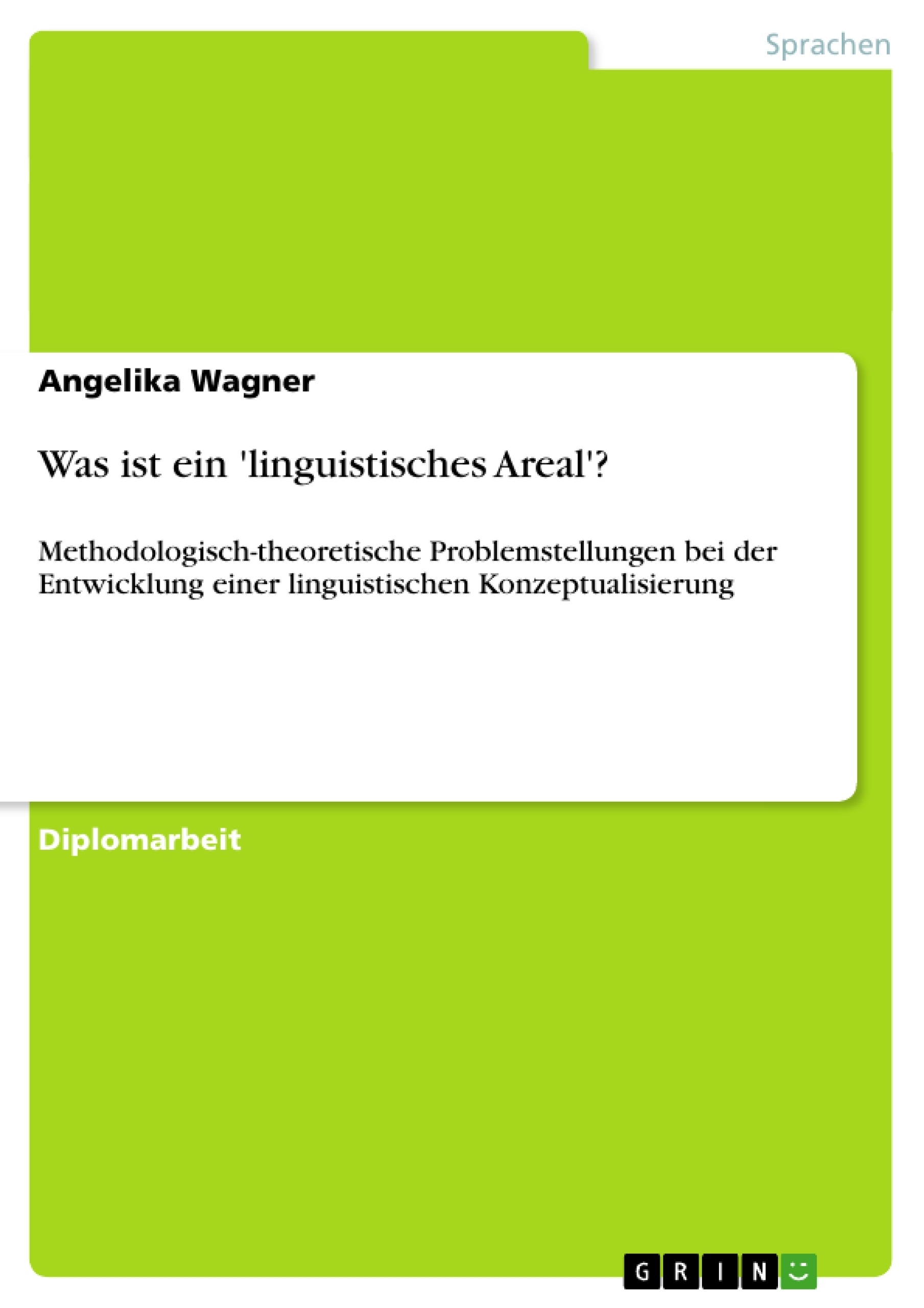Ein 'linguistisches Areal' (bzw. der synonyme Begriff 'Sprachbund') bezeichnet, im gängigen Verständnis, ein geographisches Gebiet, in dem in benachbarten, genetisch nicht oder nicht nah verwandten Sprachen aufgrund von vergangenem und/oder anhaltendem intensiven Sprachkontakt eine konvergente Entwicklung stattgefunden hat. Dies bedeutet, die betroffenen Sprachen weisen neben Ähnlichkeiten in ihrer Lexik auch gemeinsame grammatikalische Strukturen auf, die durch Entlehnung Verbreitung fanden. Der Begriff bzw. das Konzept des 'Sprachbunds' wurde bis heute auf mehr als ein Dutzend geographische Gebiete der Erde 'angewandt', u. a. am Balkan, in Indien (Südasien) und Mesoamerika, aber auch in Europa ('Standard Avarage European'). Das Konzept ist jedoch nicht unumstritten. Die Frage nach einheitlichen Konstitutions- bzw. Definitionskriterien innerhalb der Areallinguistik ist bis heute nicht geklärt. Ich möchte in dieser Arbeit anhand der vier schon erwähnten Areale den problematischen Aspekten dieses linguistischen Forschungsfeldes auf den Grund gehen. Es wird die methodologische und theoretische Vorgehensweise der jeweils wichtigsten Autoren der behandelten Areale verglichen. Am Ende der Arbeit gehe ich auf die Frage ein, wieviel die zeitgenössischen Verwendungen bzw. Interpretationen der zwei Begriffe 'Sprachfamilie' und 'Sprachbund', welche Nikolai S. Trubetzkoy erstmals 1928 als zwei Typen von 'Sprachgruppen' unterschied, mit jener ihres Urhebers noch zu tun haben. Ziel meiner Arbeit ist es nicht, mögliche Antworten auf die vorliegenden methodologisch-theoretischen Problemstellungen zu geben. Vielmehr soll sie überblicksmäßig Einblick in einen (sprach-)wissenschaftlichen Diskurs gewähren, der sich seit Jahrzehnten um die Definition und Verwendung eines Begriffs dreht, dessen Bedeutung von Anfang an verschieden interpretiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- (Areal-)Typologie: Historische Entwicklung und Überblick über den Gegenstands- bereich
- Sprachverwandtschaft und Sprachkontakt
- Vom Stammbaum zum Typ
- Wellen, Substrat und Dialekt
- Der Übergang ins 20. Jahrhundert: die Sapir-Boas Debatte, Trubetzkoys 'Sprach- bund' und Joseph F. Greenberg
- Arealtypologie: Abgrenzung zu Typologie und Sprachgeographie (Dialektologie)
- Theoretische und methodologische Problemstellungen
- Welche Sprachen können ein linguistisches Areal konstituieren?
- Wieviele Merkmale? Welche Merkmale?
- Samplingprobleme in (areal-)typologischen Untersuchungen am Beispiel des WALS
- Exemplarische Betrachtung von vier Sprachbünden
- Balkan
- Indien/Südasien
- Mesoamerika
- Europa (SAE)
- Konklusion/Kritik
- Anzahl und Verhältnis der Arealsprachen
- Isoglossen(-bündel)
- Strukturelle Unterschiede der Merkmale innerhalb der Areale
- Abgrenzung von entlehnten/genetischen/typologischen Merkmalen
- Exkurs zum Schluss: Trubetzkoy (1930) revisited
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Definition und Untersuchung des Konzepts des "linguistischen Areals". Sie analysiert die historische Entwicklung des Begriffs sowie die damit verbundenen methodologischen und theoretischen Herausforderungen. Die Arbeit strebt danach, die Kriterien zur Identifizierung und Abgrenzung von Sprachbünden aufzuzeigen und die komplexen Zusammenhänge zwischen genetischer Verwandtschaft, sprachlichem Kontakt und arealtypologischen Merkmalen zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Konzepts des Sprachbunds und seine Abgrenzung von anderen sprachwissenschaftlichen Konzepten wie Typologie und Dialektologie.
- Die methodologischen Probleme bei der Definition und Identifizierung von linguistischen Arealen, insbesondere die Unterscheidung zwischen genetischen und durch Sprachkontakt erworbenen Merkmalen.
- Die Untersuchung von vier exemplarischen Sprachbünden (Balkan, Indien/Südasien, Mesoamerika, Europa) hinsichtlich ihrer konstituierenden Merkmale, ihrer sprachlichen Diversität und ihrer methodischen Besonderheiten.
- Die kritische Reflexion der bestehenden Konzepte und Methoden der arealtypologischen Forschung.
- Die Bedeutung des Sprachbunds als Konzept für das Verständnis der sprachlichen Diversität und der sprachlichen Entwicklung in verschiedenen Regionen der Welt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser in das Thema der Arbeit ein und stellt das Konzept des Sprachbunds vor. Sie beleuchtet die aktuelle Forschung im Bereich der arealtypologischen Untersuchungen und verdeutlicht die zentralen Problemstellungen der Arbeit.
- (Areal-)Typologie: Historische Entwicklung und Überblick über den Gegenstands-bereich: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung des Begriffs "Sprachbund" und beschreibt die verschiedenen Ansätze in der arealtypologischen Forschung. Es beleuchtet die Debatte zwischen Stammbaum- und Wellentheorie und stellt die wichtigsten Konzepte der Sprachverwandtschaft und des Sprachkontakts vor.
- Theoretische und methodologische Problemstellungen: Dieses Kapitel widmet sich den methodischen und theoretischen Herausforderungen bei der Definition und Abgrenzung von Sprachbünden. Es behandelt Themen wie die Identifizierung der konstituierenden Merkmale eines Areals, die Unterscheidung zwischen genetischen und durch Sprachkontakt erworbenen Merkmalen sowie die Problematik des Samplings in arealtypologischen Untersuchungen.
- Exemplarische Betrachtung von vier Sprachbünden: Dieses Kapitel untersucht vier exemplarische Sprachbünde (Balkan, Indien/Südasien, Mesoamerika, Europa) und analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es beleuchtet die sprachlichen Besonderheiten jedes Areals und diskutiert die jeweiligen methodischen Ansätze und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Konzepten der arealtypologischen Forschung, darunter Sprachbund, linguistisches Areal, Sprachverwandtschaft, Sprachkontakt, genetische Merkmale, entlehnte Merkmale, typologische Merkmale, Isoglossen, Sprachfamilie, Sprachentwicklung, Arealtypologie, Methodologie, Sampling, Balkanismus, südasiatischer Sprachbund, mesoamerikanischer Sprachbund, europäischer Sprachbund.
- Quote paper
- Angelika Wagner (Author), 2010, Was ist ein 'linguistisches Areal'?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/174541