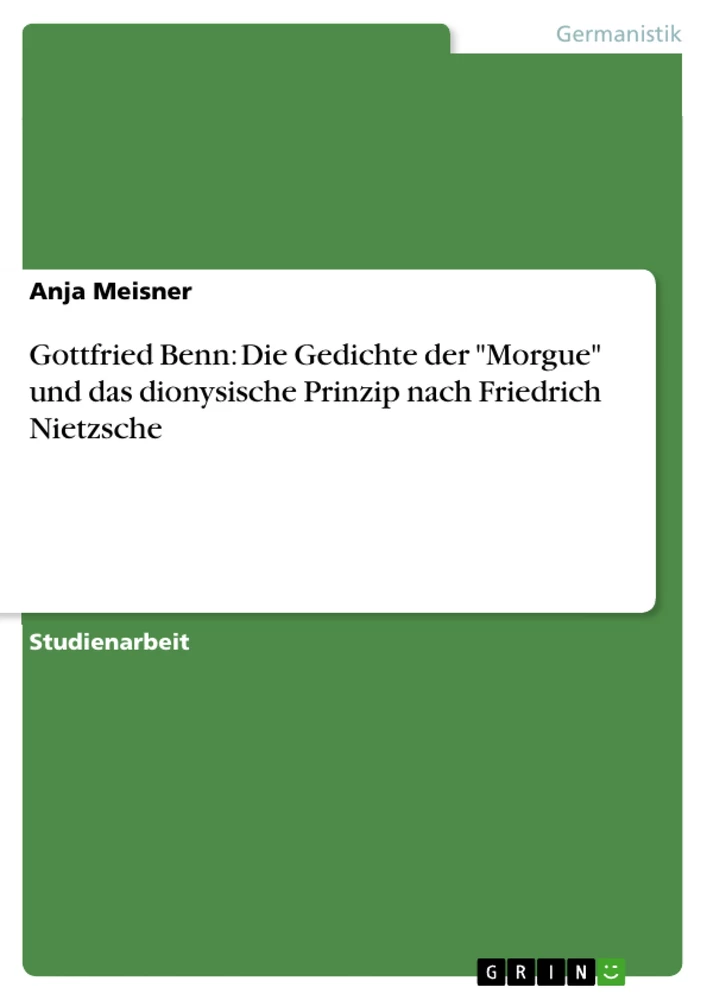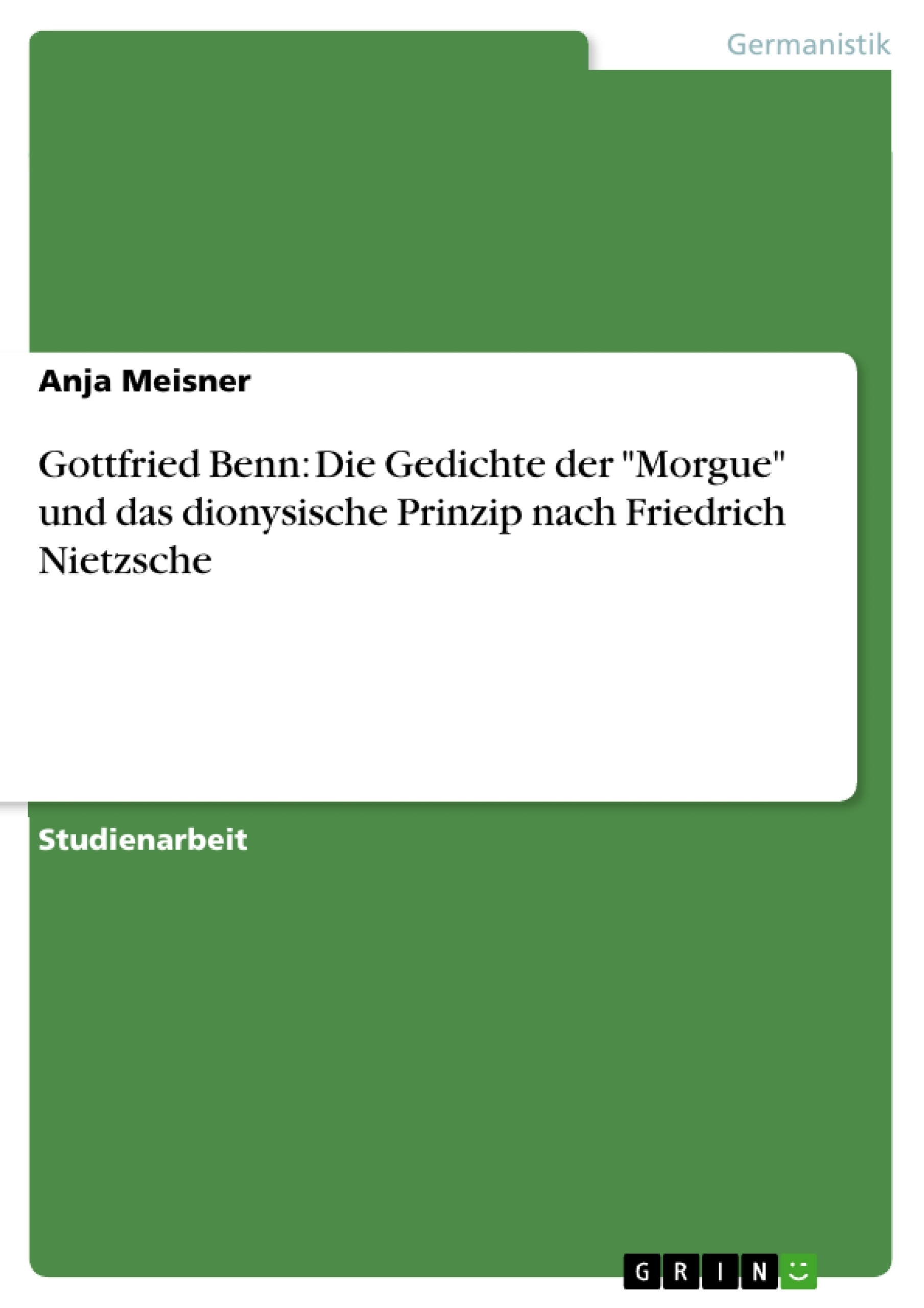Gottfried Benn schreibt über Nietzsche: „Eigentlich hat alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinanderdachte, man kann sagen: erlitt, man kann auch sagen: breittrat - alles das hatte sich bereits bei Nietzsche ausgesprochen und erschöpft, definitive Formulierung gefunden, alles Weitere war Exegese.[...] Er ist, wie sich immer deutlicher zeigt, der weitreichende Gigant der nachgoetheschen Epoche.[...] Er als Mensch war arm, makellos, rein - ein großer Märtyrer und Mann. Ich könnte hinzufügen, für meine Generation war er das Erdbeben der Epoche und seit Luther das größte deutsche Sprachgenie.“ Dieses Zitat verdeutlicht die Bewunderung Benns für Nietzsche, und deutet auf eine starke Identifikation mit seinen Gedanken hin, auch wenn sie als Identifikation „seiner“ Generation genannt ist. Auf diese Aussage gestützt, wird der Gedichtszyklus „Morgue“ unter dem Aspekt eines dionysischen Lebensgefühls betrachtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorverständigung
- Das Dionysische
- „Morgue“
- „Kleine Aster“/ „Schöne Jugend“
- „Kreislauf“
- „Negerbraut“
- „Requiem“
- Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der vorliegende Text analysiert Gottfried Benns Gedichtzyklus „Morgue“ unter dem Aspekt des dionysischen Lebensgefühls. Er untersucht die Beziehung zwischen Benn und Nietzsche, insbesondere Benns Bewunderung für Nietzsche und seine Identifikation mit dessen Gedanken. Der Text zielt darauf ab, eine neue Perspektive auf die Gedichte in „Morgue“ zu eröffnen und die oft übersehenen Elemente des Schönen und Positiven hervorzuheben.
- Dionysisches Lebensgefühl in den Gedichten Benns
- Einfluss von Nietzsche auf Benns Werk
- Bedeutung der „Morgue“ als Gedichtzyklus
- Analyse der unterschiedlichen Bilder und Motive in den Gedichten
- Spannungsfeld zwischen Schönheit und Hässlichkeit in den Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel „Vorverständigung“ beleuchtet Benns Bewunderung für Nietzsche und seine Interpretation der „Morgue“ als Ausdruck des dionysischen Prinzips. Es wird die These aufgestellt, dass die Gedichte in „Morgue“ nicht nur den Ekel und Hass, sondern auch Schönheit und Positivität widerspiegeln.
Das zweite Kapitel „Das Dionysische“ befasst sich mit dem Ursprung des Begriffs „Dionysisches“ in der griechischen Mythologie und beschreibt die Rolle von Dionysos als Gott der Ekstase, des Weines und der Fruchtbarkeit. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des dionysischen Prinzips für Nietzsche und stellt die Frage nach seiner Relevanz für die Analyse von Benns Gedichten.
Das dritte Kapitel „„Morgue““ analysiert verschiedene Gedichte aus dem Zyklus, darunter „Kleine Aster“/ „Schöne Jugend“, „Kreislauf“, „Negerbraut“ und „Requiem“. Es werden die jeweiligen Bilder und Motive beleuchtet, die den Aspekt des Schönen und Positiven in den Gedichten widerspiegeln.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Gedichtzyklus „Morgue“ von Gottfried Benn unter dem Aspekt des dionysischen Prinzips nach Friedrich Nietzsche. Die Kernthemen umfassen die Interpretation des dionysischen Prinzips in Benns Werk, die Analyse der Bilder und Motive in den Gedichten, den Einfluss von Nietzsche auf Benn sowie die Frage nach Schönheit und Hässlichkeit in den Gedichten.
- Quote paper
- Anja Meisner (Author), 1999, Gottfried Benn: Die Gedichte der "Morgue" und das dionysische Prinzip nach Friedrich Nietzsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/174026