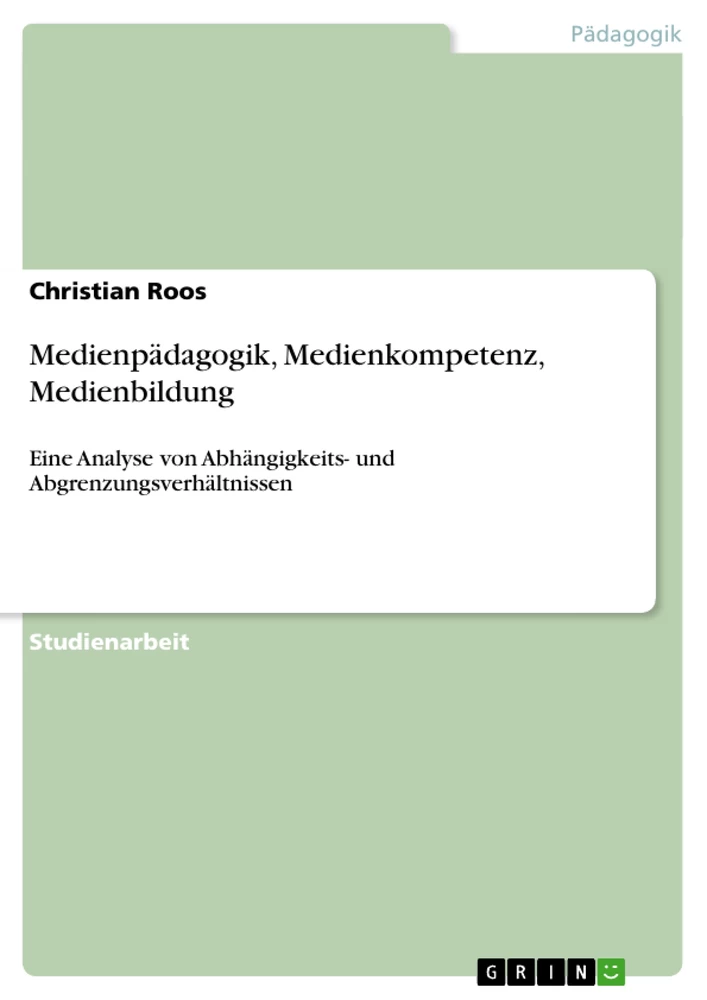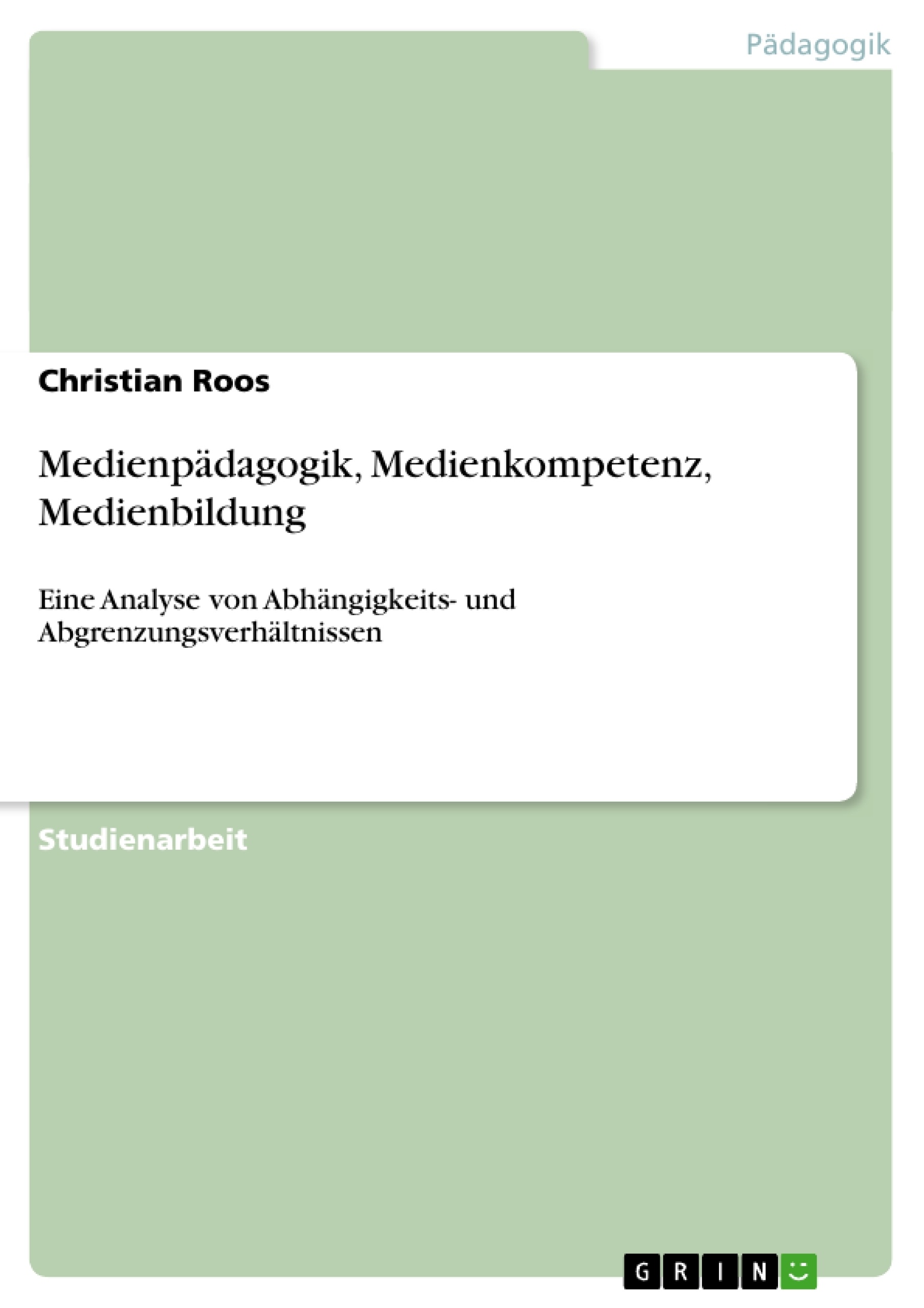„Medienpädagogen sind eine Art eierlegende Wollmilchsau. Sie sind für alles zuständig.“ In diesem Zitat aus einem Vortrag von Thorsten Lorenz wird bereits deutlich, dass der Beruf des Medienpädagogen in der Praxis kein eindeutig abgrenzbares Berufsbild darstellt. Vielmehr zeigt sich auch in der Theorie, dass die Medienpädagogik einen umfassenden Anspruch an ihre Disziplin erhebt. Dieser ergibt sich aus einer engen Verflechtung der Wissenschaftsfelder der Pädagogik, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Psychologie. Eine eindeutige Trennung voneinander erweist sich in der Betrachtung als schwer.
Im Folgenden soll die Aussage von Thorsten Lorenz, die auf die Komplexität der medienpädagogischen Disziplin hinweist, genauer analysiert und hinsichtlich ihrer saloppen Aussage revidiert werden. Doch wird der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht allein auf der Analyse der Medienpädagogik liegen. Insbesondere wird die Frage zu behandeln sein, inwiefern sich die Beziehung zwischen der Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung gestaltet.
Im ersten Kapitel werden die einzelnen Termini als Grundbausteine der medienpädagogischen Disziplin dargestellt. Zunächst sollen diese unter Einbezug von einschlägigen Werken der Medienpädagogik kurz definiert werden. Dabei wird insbesondere auf die spezifischen Eigenheiten und die Umsetzung in der Praxis einzugehen sein.
Im zweiten Kapitel gilt es zu untersuchen, ob diese Termini in einer bedingenden Beziehung zueinander stehen oder ob eine klare Abgrenzung voneinander vorgenommen werden kann. Zudem wirft sich die Frage auf, ob eine Abgrenzung von nur jeweils zwei Begriffen, bspw. der Medienpädagogik und Medienbildung, oder auch in einem größeren Rahmen möglich ist. Deshalb erscheint interessant es in diesem Zusammenhang zu analysieren, ob gar von einem Dreiecksverhältnis zwischen der Medienpädagogik, -kompetenz und -bildung gesprochen werden kann und inwiefern sich dieses gestaltet.
Diese Analyse soll klar auf der Gegenüberstellung von Ansichten verschiedener Autoren aufbauen, die sich zu den Verhältnissen in der Medienpädagogik geäußert haben.
In der Gesamtheit soll die Analyse einen differenzierten Standpunkt zur Thematik ermöglichen und u.a. exemplarisch darstellen, welcher großen Bedeutsamkeit der eindeutige Definitionsansatz einer wissenschaftlichen Disziplin widerfährt. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit wird der Ansatz sein, eine eigene Hierarchie aufzustellen und diese in ihrem komplexen Aufbau zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Definitionsansätze als Grundbausteine der medienpädagogischen Disziplin
- 1.1 Medienpädagogik
- 1.2 Medienkompetenz
- 1.3 Medienbildung
- 2 Abhängigkeits- und Abgrenzungsverhältnisse
- 2.1 Beziehung von Medienpädagogik und Medienkompetenz
- 2.2 Beziehung von Medienkompetenz und Medienbildung
- 2.3 Beziehung von Medienpädagogik und Medienbildung
- 2.4 Dreiecksverhältnis
- 3 Synthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Komplexität der Medienpädagogik und untersucht die Beziehungen zwischen Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung. Sie hinterfragt die Abgrenzbarkeit dieser Begriffe und beleuchtet ihre jeweiligen Definitionsansätze. Ziel ist es, ein differenziertes Verständnis der Zusammenhänge zwischen diesen drei Bereichen zu entwickeln und eine eigene Hierarchie aufzustellen.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung
- Analyse der Abhängigkeits- und Abgrenzungsverhältnisse zwischen den drei Begriffen
- Untersuchung der verschiedenen Definitionsansätze im medienpädagogischen Diskurs
- Entwicklung eines differenzierten Verständnisses der Beziehungen zwischen den drei Bereichen
- Aufstellung einer eigenen Hierarchie der drei Begriffe innerhalb der medienpädagogischen Disziplin
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass der Beruf des Medienpädagogen aufgrund der Verflechtung von Erziehungswissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Psychologie, schwer abgrenzbar ist. Sie kündigt die Analyse der Beziehungen zwischen Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung an, wobei im ersten Kapitel die einzelnen Begriffe definiert und im zweiten Kapitel ihre Beziehungen zueinander untersucht werden sollen. Die Arbeit zielt auf ein differenziertes Verständnis und die Entwicklung einer eigenen Hierarchie der drei Begriffe.
1 Definitionsansätze als Grundbausteine der medienpädagogischen Disziplin: Dieses Kapitel legt das Fundament für die Analyse der Beziehungen zwischen den drei Begriffen. Es untersucht die Definitionsansätze verschiedener Medienpädagogen für Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung. Besonders die handlungsorientierte Medienpädagogik wird betrachtet, wobei die Ansätze von Bernd Schorb (soziale Verankerung, Vermittlung zwischen Medienhandeln und Medienalltag) und Dieter Baacke (Medienpädagogik als übergeordnete Kategorie) hervorgehoben werden. Die Analyse der einzelnen Termini erfolgt kurz und kompakt, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.
Schlüsselwörter
Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medienbildung, Definitionsansätze, Abhängigkeitsverhältnisse, Abgrenzungsverhältnisse, handlungsorientierte Medienpädagogik, medienpädagogischer Diskurs, Beziehung zwischen den Begriffen, wissenschaftliche Disziplin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse der Beziehungen zwischen Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die komplexen Beziehungen zwischen den drei Begriffen Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung. Sie untersucht deren Abgrenzbarkeit und Definitionsansätze, um ein differenziertes Verständnis ihrer Zusammenhänge zu entwickeln und eine eigene Hierarchie der drei Begriffe zu erstellen.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Abgrenzung der Begriffe Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung. Sie untersucht die verschiedenen Definitionsansätze im medienpädagogischen Diskurs und analysiert die Abhängigkeits- und Abgrenzungsverhältnisse zwischen diesen Begriffen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu den Definitionsansätzen von Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung, einem Kapitel zu den Abhängigkeits- und Abgrenzungsverhältnissen dieser drei Begriffe und einer abschließenden Synthese. Die Einleitung stellt die These auf, dass der Beruf des Medienpädagogen schwer abgrenzbar ist und kündigt die Analyse der Beziehungen der drei Kernbegriffe an. Kapitel 1 definiert die einzelnen Begriffe und Kapitel 2 untersucht deren Beziehungen.
Welche Ansätze der Medienpädagogik werden besonders betrachtet?
Die Arbeit betrachtet insbesondere die handlungsorientierte Medienpädagogik, wobei die Ansätze von Bernd Schorb (soziale Verankerung, Vermittlung zwischen Medienhandeln und Medienalltag) und Dieter Baacke (Medienpädagogik als übergeordnete Kategorie) hervorgehoben werden.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein differenziertes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Medienpädagogik, Medienkompetenz und Medienbildung zu entwickeln und eine eigene Hierarchie dieser drei Bereiche innerhalb der medienpädagogischen Disziplin aufzustellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medienbildung, Definitionsansätze, Abhängigkeitsverhältnisse, Abgrenzungsverhältnisse, handlungsorientierte Medienpädagogik, medienpädagogischer Diskurs, Beziehung zwischen den Begriffen, wissenschaftliche Disziplin.
Wie ist die Struktur der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Definitionsansätzen der drei Kernbegriffe, ein Kapitel zu den Abhängigkeits- und Abgrenzungsverhältnissen und ein abschließendes Kapitel mit einer Synthese. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
- Quote paper
- Christian Roos (Author), 2011, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Medienbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173880