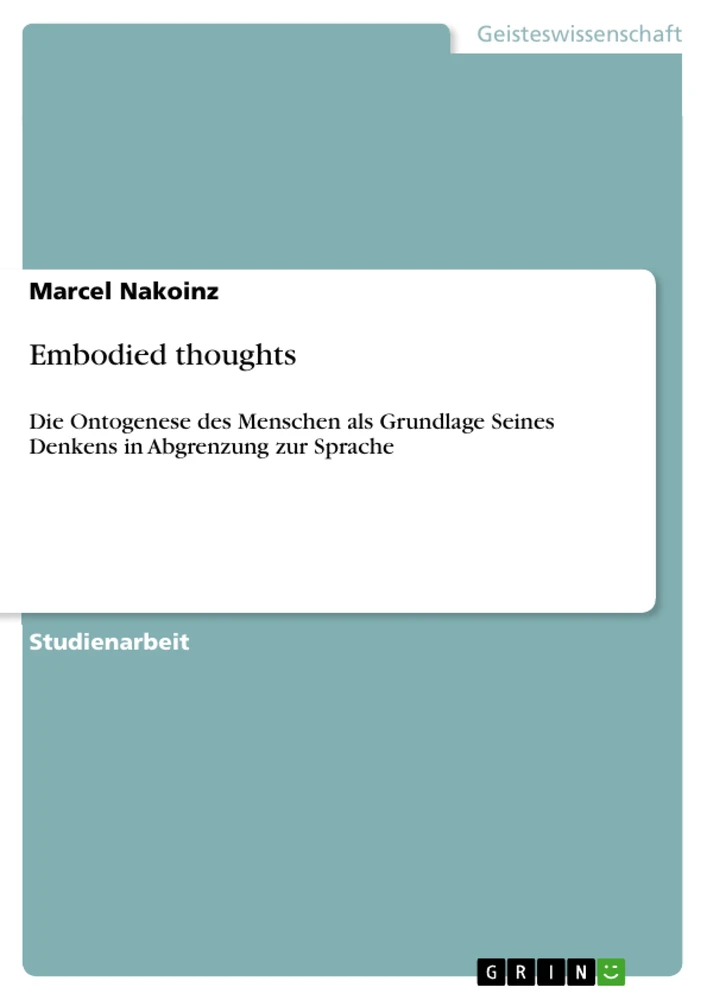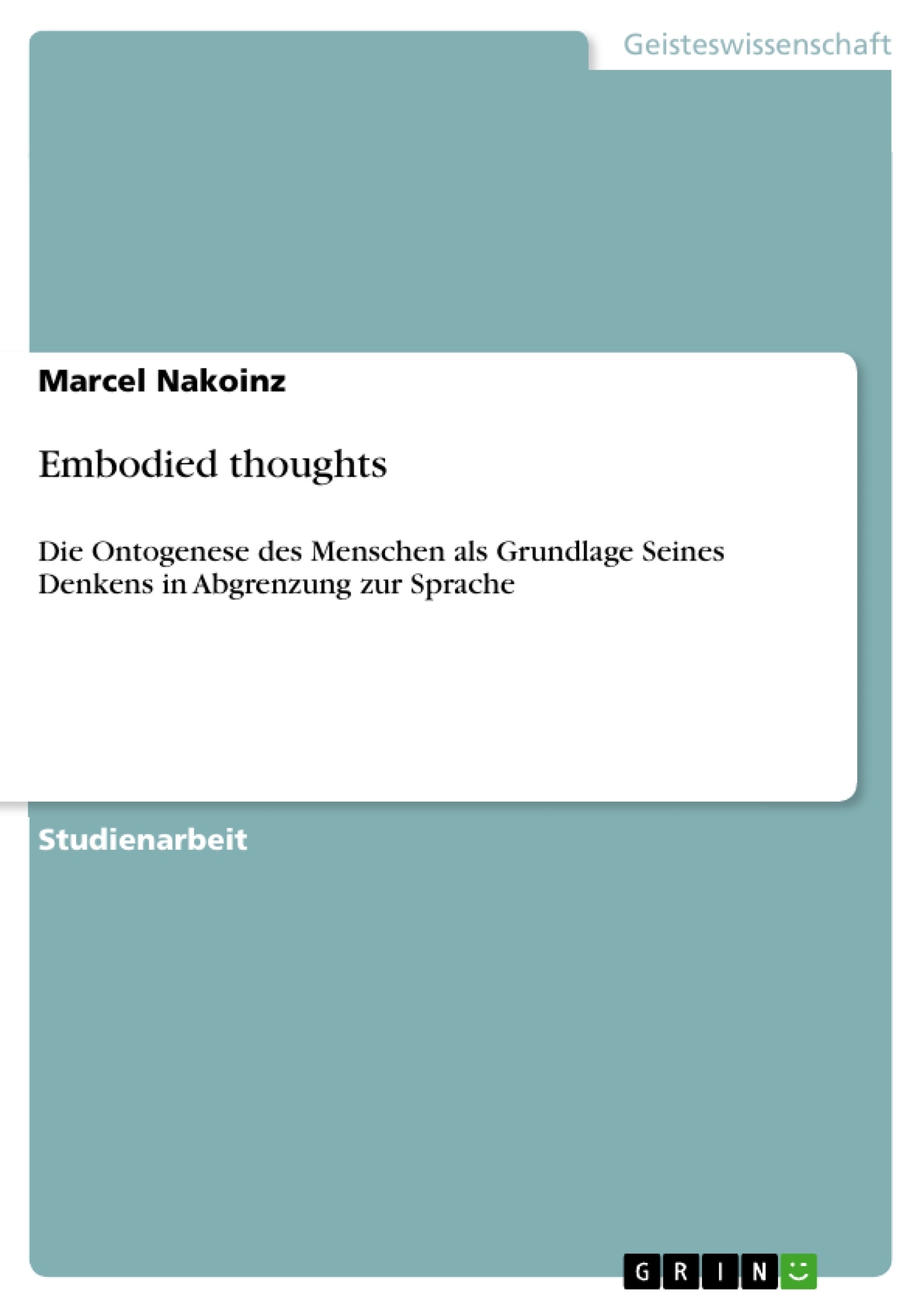Die Frage danach, ob die Sprache das Denken entscheidend beeinflusse oder sogar determiniere ist eine im sprachphilosophischen Diskurs durchaus weitreichende und überaus kontrovers diskutierte. Sprachdeterministische Theorien im Sinne der starken Version des »Linguistischen Relativitätsprinzips« (LRP), welches ausgedehnte sprachphilosophische Debatten und ethnolinguistische Feldstudien nach sich zog,dauern bis heute an. Benjamin Lee Whorf gilt als derjenige, von dem das LRP in seiner starken Form als erstem formuliert wurde, wonach unterschiedliche Sprachgemeinschaften aufgrund der Grammatik ihrer Sprache zu völlig verschieden Wahrnehmungen der Welt (und damit verschiedenen Weltauffassungen) kämen.
Wir haben berechtigte Gründe, einem derartigen Sprachdeterminismus grundsätzlich zu widersprechen. Kann man nicht intuitiv handeln, Überlegungen anstellen und denken, ohne dass es dafür einer Sprache bedürfte? Können wir ohne Worte für etwas zu haben, nicht geistige Konzepte von etwas bilden, das uns sprichwörtlich »auf der Zunge liegt«? Was ist mit dem Kleinkind, dass noch keine selbstbezüglichen Wörter spricht; müssen wir ihm jegliche selbstbezogenen Gedanken absprechen, wenn es seine Hand nach einem Spielzeug ausstreckt und die Mutter auffordernd mit seinem Bick fixiert?
Der vorliegende Aufsatz stellt einen Versuch dar, die These herauszuarbeiten und zu verteidigen, dass die menschliche Sprache sein Denken nicht determiniert, wie es vor allem von Whorf in seiner Radikalisierung der Theorie des Ethnolinguisten Edward Sapirs annimmt.
Vielmehr wird das Denken als eine lebendige Wechselbeziehung einer nonverbalen (D) und einer sprachlichen Form (S) von Denken verstanden werden (S<>D). Damit würden Sprache und Denken untrennbar verwoben gedacht, als Einheit zweier Denkformen (D = D1, S = D2). Die (vor allem sprachliche) Ontogenese des so verstandenen Denkens könnte, so die vorläufige Arbeitsthese, erklären, dass das Denken nicht sprachlich determiniert ist, sondern lediglich entscheidend durch die Entwicklung des menschlichen Denkens geformt wird (O>(D1<>D2)).
Um die Funktionsweise dieser Entwicklung zu erhellen, werden die Erkenntnisse zur der Sprachentwicklung bei Kindern, im Besonderen des Psychologen Lew S. Wygotskis und des Anthropologen Michael Tomasellos kritisch zu Rate gezogen und für die philosophische Fragestellung fruchtbar gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Sprache, Denken - Determinismus?
- 1.1 Sprache und Denken – Einige terminologische Weichenstellungen
- 1.2 Der Ursprung des Sprachdeterminismus – Blinde Ethnologen und schwimmende Anthropologen
- 1.3 Die zwei Komponenten des Denkens – Sprach-Inseln im Ozean des Schweigens
- 1.4 Zwischenkonklusion
- 2 Ontogenese und Spracherwerb
- 2.1 Wygotskis kompetente Säuglinge
- 2.1.1 Alte Vorurteile abstreifen
- 2.1.2 Wygotskis Beitrag für die Moderne
- 2.1.3 Über Wygotski hinaus
- 2.2 Wissen durch Handlung
- 2.3 Zwischenkonklusion
- 3 Phylogenese und Aufmerksamkeit
- 3.1 Tomasellos noch kompetentere Säuglinge
- 3.1.1 Erlebte Erfahrung - Die Grundlage der Ontogenese menschlichen Denkens
- 3.1.2 Die Bedeutung von Zeigegesten und gemeinsamen Hintergründen
- 3.2 Die neuronale Basis der Weltauffassung – Friths vorreflexive Weltmodelle
- 3.3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz untersucht die These, dass menschliches Denken nicht durch Sprache determiniert wird, im Gegensatz zu Theorien wie dem linguistischen Relativitätsprinzip. Stattdessen wird eine Wechselbeziehung zwischen nonverbaler und sprachlicher Denkform postuliert. Die Ontogenese des Denkens wird als entscheidender Faktor betrachtet, der die Formung des Denkens beeinflusst, nicht aber determiniert.
- Der Sprachdeterminismus und seine Kritik
- Die Rolle der Ontogenese in der Entwicklung des Denkens
- Der Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze (Wygotski, Tomasello)
- Die Interaktion zwischen nonverbaler und sprachlicher Denkform
- Die Abgrenzung des Denkens von rein sprachlicher Aktivität
Zusammenfassung der Kapitel
1 Sprache, Denken - Determinismus?: Dieses Kapitel legt die terminologischen Grundlagen des Aufsatzes fest und diskutiert den Sprachdeterminismus, insbesondere im Kontext von George Orwells "Neusprech" aus 1984. Es wird die These aufgestellt, dass Denken nicht ausschließlich sprachlich determiniert ist, und die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtungsweise von Denken, welches sowohl eine verbale als auch nonverbale Komponente umfasst, betont. Der Einfluss des linguistischen Relativitätsprinzips wird kritisch beleuchtet, und die Frage, ob Denken ohne Sprache möglich ist, wird angestoßen. Die zentrale These des Aufsatzes wird hier eingeführt: Denken ist eine lebendige Wechselwirkung nonverbaler und sprachlicher Denkformen, die eng miteinander verwoben sind.
2 Ontogenese und Spracherwerb: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ontogenese des Denkens und dem Spracherwerb, wobei die Theorien von Lew S. Wygotski im Mittelpunkt stehen. Wygotskis Ansatz, der die Bedeutung der sozialen Interaktion für die kognitive Entwicklung betont, wird detailliert erläutert. Das Kapitel untersucht, wie Kinder durch Handlung Wissen erwerben und wie dies die Entwicklung ihres Denkens prägt. Es wird argumentiert, dass die Entwicklung des Denkens nicht sprachlich determiniert ist, sondern durch die Interaktion zwischen dem Kind und seiner Umwelt, einschließlich sozialer Interaktionen, beeinflusst wird. Die Bedeutung von Handlung und Erfahrung für die Herausbildung von Denkstrukturen wird herausgestellt.
3 Phylogenese und Aufmerksamkeit: Das Kapitel erweitert die Betrachtung der Ontogenese, indem es die Erkenntnisse von Michael Tomasello zu den kognitiven Fähigkeiten von Säuglingen einbezieht. Tomasellos Forschung zu Zeigegesten und gemeinsamen Hintergründen wird analysiert, um die Entwicklung des menschlichen Denkens im Kontext der sozialen Interaktion zu verstehen. Die neuronale Basis der Weltauffassung und die Rolle von "vorreflexiven Weltmodellen" (Frith) werden diskutiert, um die komplexen Interaktionen zwischen Wahrnehmung, Erfahrung und der Entstehung von Denkstrukturen zu beleuchten. Es wird gezeigt, wie erlebte Erfahrung die Grundlage der Ontogenese des menschlichen Denkens bildet und wie soziale Interaktion diese Erfahrung strukturiert.
Schlüsselwörter
Sprachdeterminismus, Ontogenese, Spracherwerb, Wygotski, Tomasello, Denken, Nonverbale Kommunikation, Linguistisches Relativitätsprinzip, kognitive Entwicklung, soziale Interaktion, Weltmodelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprache, Denken - Determinismus?
Was ist der zentrale Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht die These, dass menschliches Denken nicht durch Sprache determiniert wird, im Gegensatz zu Theorien wie dem linguistischen Relativitätsprinzip. Stattdessen wird eine Wechselbeziehung zwischen nonverbaler und sprachlicher Denkform postuliert, wobei die Ontogenese des Denkens als entscheidender Faktor angesehen wird.
Welche Theorien werden im Aufsatz diskutiert?
Der Aufsatz diskutiert den Sprachdeterminismus und seine Kritik, die Rolle der Ontogenese in der Entwicklung des Denkens, und vergleicht verschiedene theoretische Ansätze, insbesondere von Lew S. Wygotski und Michael Tomasello. Die Interaktion zwischen nonverbaler und sprachlicher Denkform sowie die Abgrenzung des Denkens von rein sprachlicher Aktivität werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt die Ontogenese im Aufsatz?
Die Ontogenese des Denkens, also die Entwicklung des Denkens im Laufe des individuellen Lebens, wird als zentraler Faktor betrachtet. Der Aufsatz argumentiert, dass die Entwicklung des Denkens nicht sprachlich determiniert ist, sondern durch die Interaktion zwischen dem Kind und seiner Umwelt, einschließlich sozialer Interaktionen, beeinflusst wird. Die Bedeutung von Handlung und Erfahrung für die Herausbildung von Denkstrukturen wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Wygotski und Tomasello im Aufsatz?
Die Theorien von Lew S. Wygotski, die die Bedeutung der sozialen Interaktion für die kognitive Entwicklung betonen, stehen im Mittelpunkt des Kapitels über Ontogenese und Spracherwerb. Michael Tomasellos Forschung zu den kognitiven Fähigkeiten von Säuglingen, insbesondere zu Zeigegesten und gemeinsamen Hintergründen, wird im Kapitel zur Phylogenese und Aufmerksamkeit analysiert, um die Entwicklung des menschlichen Denkens im Kontext sozialer Interaktion zu verstehen.
Wie wird der Sprachdeterminismus im Aufsatz behandelt?
Der Aufsatz kritisiert den Sprachdeterminismus und argumentiert gegen die These, dass Denken ausschließlich sprachlich determiniert ist. Der Einfluss des linguistischen Relativitätsprinzips wird kritisch beleuchtet, und die Frage, ob Denken ohne Sprache möglich ist, wird diskutiert. Der Aufsatz postuliert stattdessen eine lebendige Wechselwirkung zwischen nonverbaler und sprachlicher Denkform.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Aufsatz behandelt?
Schlüsselkonzepte des Aufsatzes sind Sprachdeterminismus, Ontogenese, Spracherwerb, nonverbale Kommunikation, linguistisches Relativitätsprinzip, kognitive Entwicklung, soziale Interaktion und Weltmodelle. Die Beiträge von Wygotski und Tomasello werden als zentrale theoretische Ankerpunkte verwendet.
Was ist die Hauptthese des Aufsatzes?
Die Hauptthese des Aufsatzes ist, dass Denken keine rein sprachlich determinierte Aktivität ist, sondern eine lebendige Wechselwirkung zwischen nonverbalen und sprachlichen Denkformen darstellt, die eng miteinander verwoben sind. Die Ontogenese des Denkens spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Kapitel umfasst der Aufsatz?
Der Aufsatz umfasst drei Kapitel: 1. Sprache, Denken - Determinismus?, 2. Ontogenese und Spracherwerb, und 3. Phylogenese und Aufmerksamkeit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Beziehung zwischen Sprache, Denken und kognitiver Entwicklung.
- Quote paper
- Marcel Nakoinz (Author), 2011, Embodied thoughts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173107