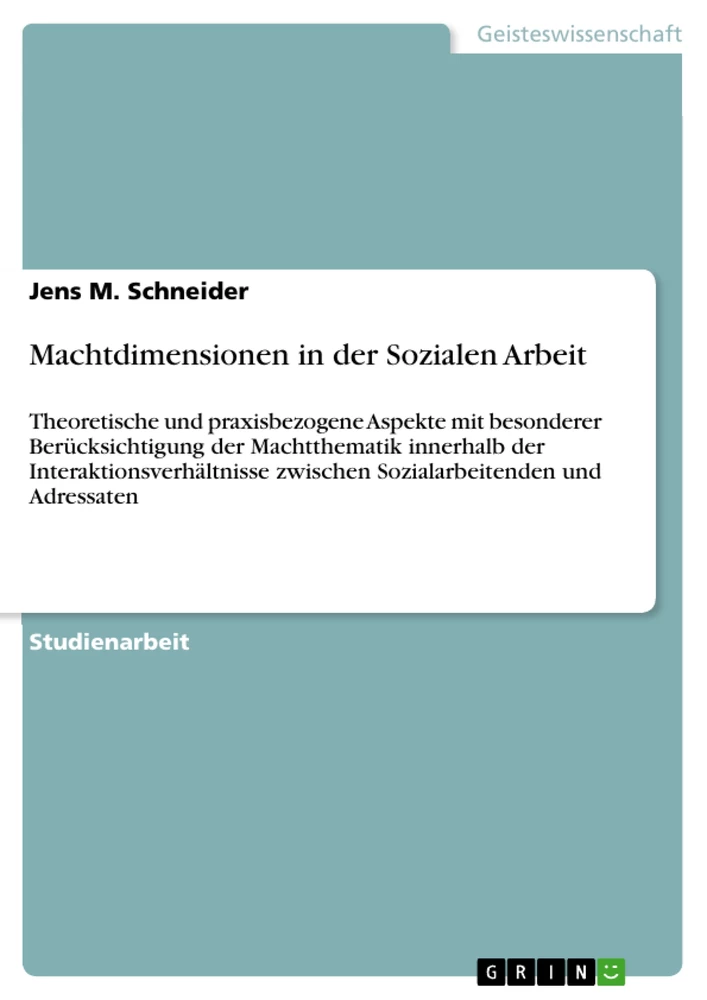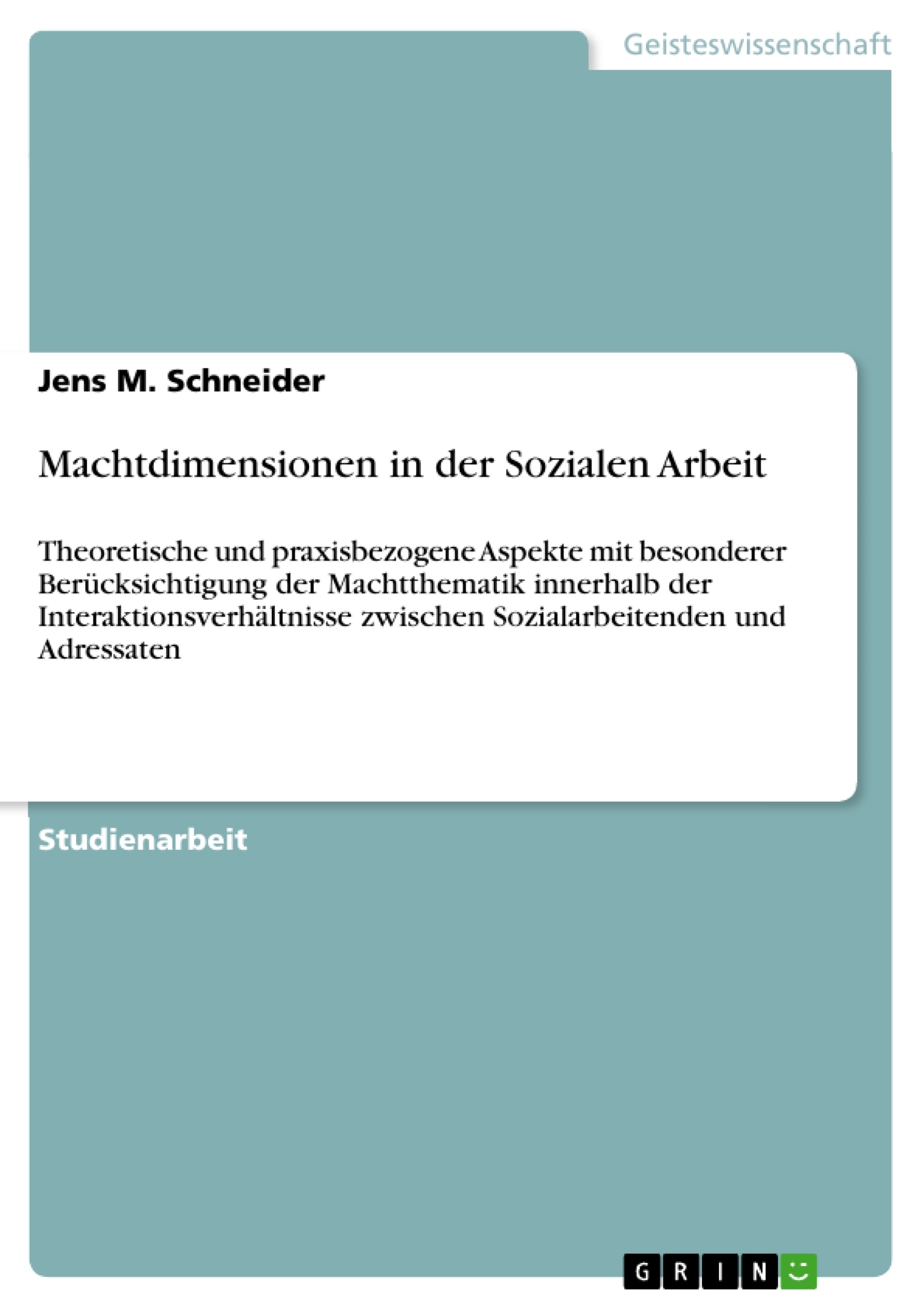Machtphänomene ziehen sich durch alle Bereiche der Sozialen Arbeit. Seien es nun Träger und Behörden, Sozialarbeitende oder die Adressaten der Profession: Beziehungen, Muster und Eigenschaften stehen in enger Verbindung mit Macht und Ohnmacht (vgl. Staub-Bernasconi, 2007, 398 f.). KESSL stellt hinsichtlich dieser Thematik Defizite im deutschsprachigen Raum fest und verweist auf eine mangelnde explizite Beschäftigung mit Macht in der sozialarbeitswissenschaftlichen Literatur. Zwar wird die Machtthematik in Einzelfällen aufgegriffen (z.B. Gender-Forschung), jedoch bleibt eine betonte Verarbeitung des Themas (noch) der soziologischen Landschaft überlassen (vgl. Kessl, 2011, 29). Auch KRAUS/KRIEGER konstatieren einen Rückzug der Machtthematik aus sozialwissenschaftlichen Publikationen seit den siebziger Jahren, der Zeit, in der die Kritische Theorie Hochkonjunktur hatte. Umso mehr legen sie die enorme Notwendigkeit dar, Fragestellungen in Bezug auf Macht ins Zentrum sozialarbeitswissenschaftlichen Interesses zu stellen (vgl. Kraus/Krieger, 2011b, 9). Die hohe Komplexität des Gebiets ist ansehnlich, muss aber im Sinne einer kritisch-reflexiven Sozialen Arbeit in Wissenschaft, Ausbildung und Praxis angegangen werden.
Diese Abhandlung stellt nun einen Versuch dar, die Machtthematik greifbarer zu machen und diese im Rahmen eines „Top-Down-Vorgehens“ darzustellen. Zentrale Fragestellung ist, welche Dimensionen Macht in der Sozialen Arbeit einnimmt, wie sie sich ausdrückt und welches Gewicht das für die Profession hat. Die Erarbeitung theoretischer Dimensionen geht dabei einem praktischen Teil voraus, der auch einen direkten Bezug zur Sozialarbeitspraxis herstellt. Demnach wird zu Beginn eine Begriffsbestimmung von Macht vorgelegt, dann ihre Bedeutsamkeit für die Sozialarbeitswissenschaft exponiert. Im Anschluss werden theoretische Aspekte und deren Relevanz für die Soziale Arbeit aufgezeigt. Hierbei beschränkt sich die Auswahl der Theorien - dem Umfang der Arbeit entsprechend - auf ein angemessenes Maß. Im Anschluss folgt eine stärkere Bezugnahme auf die Handlungsebene, indem die Facetten von Macht beispielhaft in der Praxis Sozialer Arbeit dargestellt werden. Ferner wird die systemische Denkfigur nach K. Geiser als Handwerkszeug für Sozialarbeitspraktiker vorgestellt. Letztlich folgen eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und ein Schlusswort, welches den Entwurf einer Sozialen Arbeit als Veränderungsmacht für soziale Gerechtigkeit diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Macht?
- Exkurs: Herrschaft und Gewalt
- Herrschaft
- Gewalt
- Das sozialarbeitswissenschaftliche Interesse an Macht
- Theoretische Zugänge zur Machtthematik in der Sozialen Arbeit
- Theorien der Macht
- Macht im Kontext sozialarbeitswissenschaftlichen Denkens
- Allgemeine theoretische Zugänge – Ein Überblick
- Macht in der Interaktion von Sozialarbeitenden und Klienten
- Machtanalyse in der Praxis – Die Systemische Denkfigur (SDF)
- Kritische Soziale Arbeit als Macht gesellschaftlicher Veränderung?!
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Macht in der Sozialen Arbeit und untersucht die verschiedenen Dimensionen, in denen sich Macht in diesem Bereich manifestiert. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Macht in der Sozialen Arbeit zu entwickeln, und analysiert verschiedene theoretische Perspektiven sowie deren praktische Implikationen.
- Begriffsbestimmung von Macht in der Sozialen Arbeit
- Theoretische Ansätze zur Machtthematik in der Sozialen Arbeit
- Analyse von Machtstrukturen und -verhältnissen in der Sozialen Arbeitspraxis
- Das Potenzial der Sozialen Arbeit als transformative Kraft für soziale Gerechtigkeit
- Die Relevanz der Machtanalyse für die Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik Macht in der Sozialen Arbeit ein und stellt die Relevanz des Themas sowie die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Dabei wird die Bedeutung einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit dem Thema Macht im Kontext der Sozialen Arbeit hervorgehoben.
- Was ist Macht?: In diesem Kapitel wird der Machtbegriff aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, angefangen von seiner etymologischen Herkunft bis hin zu soziologischen Definitionen von Max Weber und Niklas Luhmann. Auch der fachwissenschaftliche Bezug im Kontext der Sozialen Arbeit wird erörtert und die Unterscheidung zwischen legitimer und illegitimer Macht erläutert.
- Exkurs: Herrschaft und Gewalt: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen Herrschaft und Gewalt und stellt deren Verbindung zu Macht heraus. Dabei wird Herrschaft als institutionalisierte Machtausübung definiert und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt beschrieben.
- Das sozialarbeitswissenschaftliche Interesse an Macht: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz der Machtthematik für die Soziale Arbeit und zeigt auf, wie Macht als ein zentrales Element in der professionellen Praxis fungiert. Es wird argumentiert, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Macht für die Entwicklung einer kritischen und reflexiven Sozialen Arbeit unerlässlich ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Macht, Soziale Arbeit, Interaktion, Klient, Sozialarbeiter, Herrschaft, Gewalt, Theoretische Ansätze, Praxisbezug, Systemische Denkfigur, Soziale Gerechtigkeit, Kritik, Reflexion, Veränderung.
- Quote paper
- Jens M. Schneider (Author), 2011, Machtdimensionen in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/172582