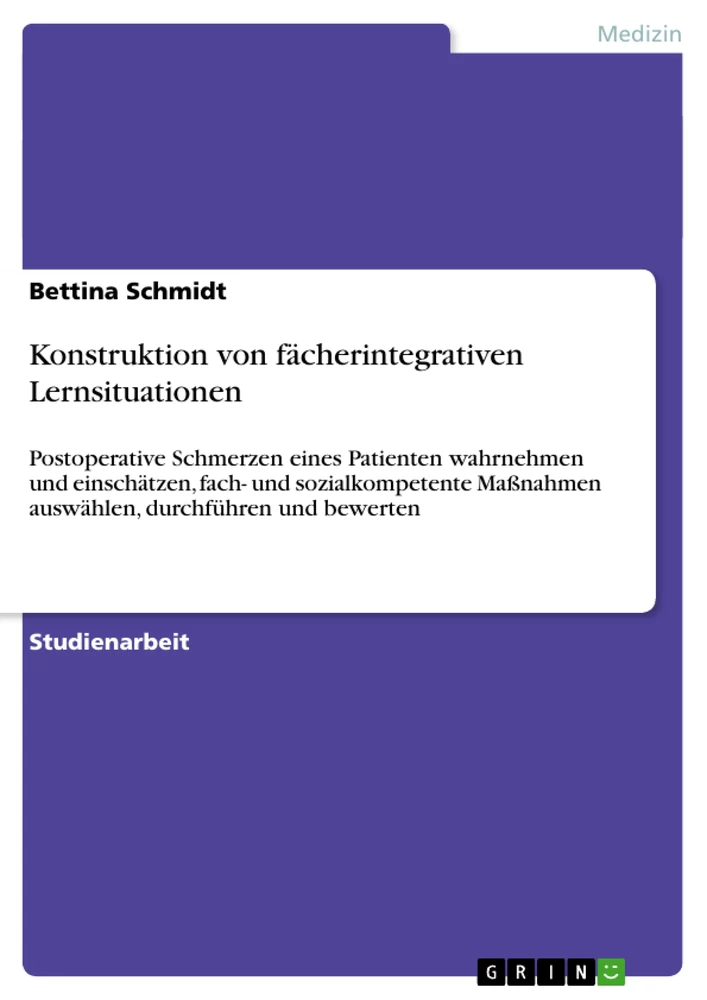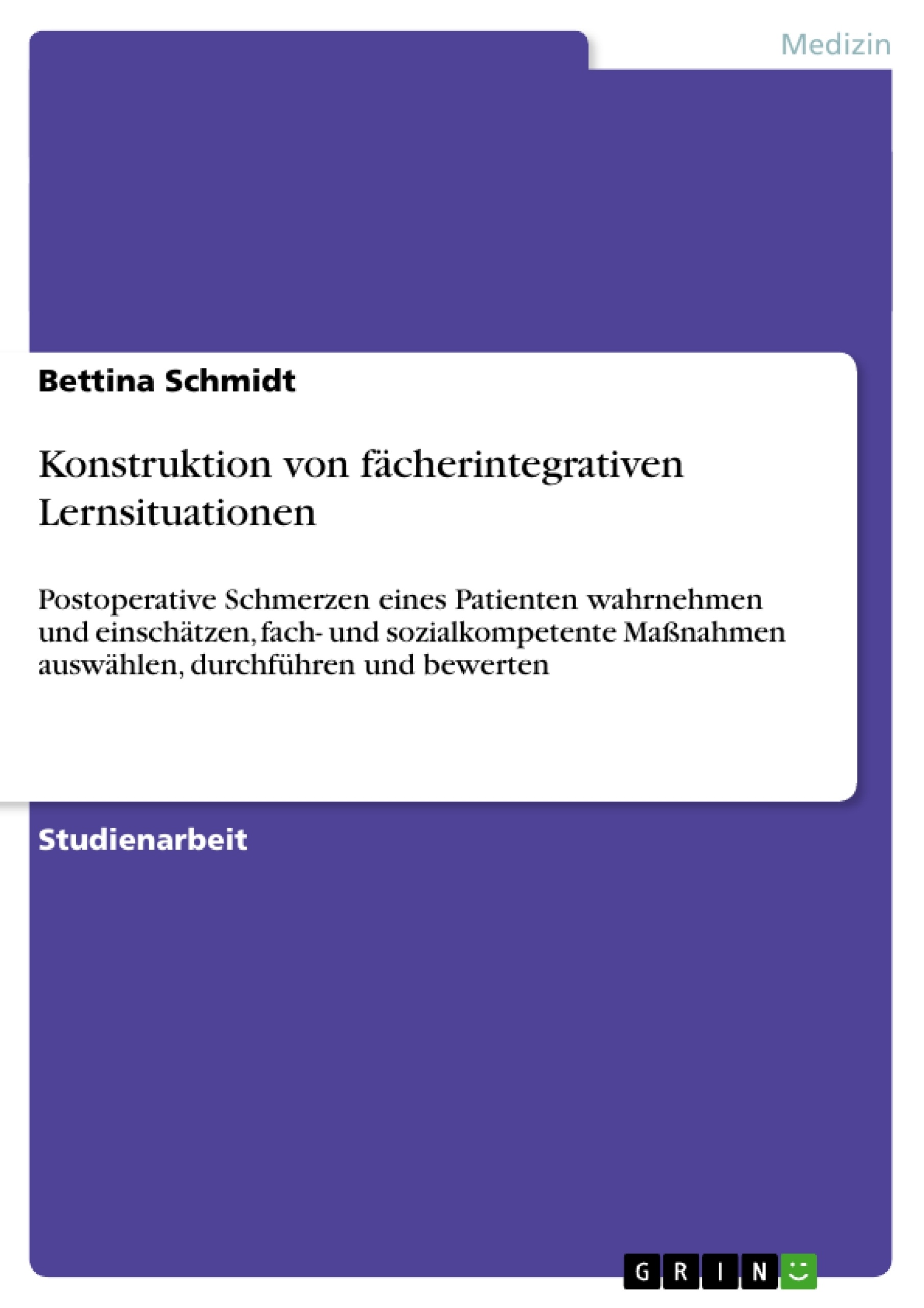Die Pflegeberufe sind im Umbruch. Nicht nur neue Prüfungs- und Ausbildungsverordnungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie in der Altenpflege zeigen dies an, sondern auch die Veränderungen und Verständnisse der jeweiligen Berufsprofile deuten darauf hin.
Diese Veränderungen lassen sich auf der inhaltlichen Basis der Ausbildungen sichtbar machen. So gewinnen nicht nur die Prävention, Rehabilitation und Beratung einen größeren Stellenwert. (vgl. Schewior-Popp, 2005, S.1-2)
Vielmehr werden die neuen Ausbildungsinhalte meiner Auffassung nach dem demographischen Wandel in Deutschland mehr und mehr gerecht.
Aber auch auf der organisatorischen Ebene sind Veränderungen für alle Beteiligten spürbar. Dazu zählt nicht nur die Anhebung der schulischen Ausbildungszeit sondern auch die Umsetzung des Lernfeldkonzeptes. (vgl. Schewior-Popp, 2005, S.1-2)
„Darüberhinaus entstehen dem Gesundheitswesen durch schmerzbedingte Komplikationen und einer daraus oft erforderlichen Verweildauerverlängerung im Krankenhaus sowie durch die Chronifizierung von Schmerzen beträchtliche Kosten, die durch ein frühzeitiges Schmerzmanagement in den meisten Fällen erheblich verringert werden könnten.“ (DNQP, 2005, S. 22)
Um diesen inhaltlichen und auch organisatorischen Veränderungen gerecht werden zu können, setzte ich mich im Rahmen dieser Modulabschlussprüfung in der Fachdidaktik mit dem Lernfeldkonzept und der Thematik Schmerz und Schmerzmanagement, hier vertiefend die postoperativ entstandenen Schmerzen, auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Ziel- und Aufgabenstellung
- 1.2. Vorgehensweise
- 2. Bedingungsebene
- 2.1. gesetzliche Vorgaben
- 2.2. Bedingungen der Lernenden
- 2.2.1. Kompetenzen, die bereits ausgebildet sind
- 3. Entscheidungsebene
- 3.1. 360° Analyse
- 3.2. Übergeordnete Handlungsstruktur
- 3.3. Handlungsstruktur
- 4. Didaktische Reduktion
- 4.1. Quantitative Reduktion
- 4.2. Qualitative Reduktion
- 5. Einbettung der Unterrichtsstunden in die Lernsituation
- 6. Durchzuführende Unterrichtsstunde
- 6.1. Handlungsstruktur der Unterrichtsstunde
- 6.2. Begründung und Erläuterungen
- 6.3. Didaktischer Ansatz
- 6.4. Zu fördernde Kompetenzen
- 6.5. Methoden, Medien und Sozialformen
- 6.6. Artikulationsschema
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Konstruktion einer fächerintegrativen Lernsituation zum Thema „Postoperative Schmerzen eines Patienten wahrnehmen und einschätzen, Fach- und sozialkompetente Maßnahmen auswählen, durchführen und bewerten“. Die Arbeit analysiert den aktuellen Stand der Pflegeberufe im Kontext von neuen Prüfungs- und Ausbildungsverordnungen, demographischem Wandel und der Bedeutung von Schmerzmanagement. Ziel ist es, eine didaktisch fundierte Lernsituation zu entwickeln, die den spezifischen Herausforderungen der postoperativen Schmerztherapie gerecht wird.
- Entwicklung eines fächerintegrativen Unterrichtskonzeptes
- Analyse von Kompetenzen und Bedürfnissen von Pflegenden
- Bedeutung von Schmerzmanagement in der postoperativen Phase
- Entwicklung eines didaktischen Ansatzes für die Vermittlung von Fach- und Sozialkompetenzen
- Integration von Theorie und Praxis in der Lernsituation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung und die Vorgehensweise. Es wird auf die aktuellen Veränderungen in den Pflegeberufen, die wachsende Bedeutung des Schmerzmanagements und die Notwendigkeit einer didaktischen Fundierung von Lernsituationen hingewiesen.
- Kapitel 2: Bedingungsebene: Dieses Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen für die Lernsituation, darunter gesetzliche Vorgaben und die Kompetenzen, die die Lernenden bereits besitzen. Es dient als Grundlage für die Entwicklung der weiteren Inhalte und der Gestaltung der Lernsituation.
- Kapitel 3: Entscheidungsebene: In diesem Kapitel wird eine 360° Analyse der Lernsituation durchgeführt, um die relevanten Handlungsstrukturen und Inhalte zu identifizieren. Die Analyse dient als Grundlage für die Auswahl und Gestaltung der Unterrichtsinhalte.
- Kapitel 4: Didaktische Reduktion: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Reduktion der komplexen Thematik auf die wesentlichen Inhalte und Kompetenzen. Es werden quantitative und qualitative Reduktionsstrategien vorgestellt, die für die Entwicklung einer effektiven Lernsituation notwendig sind.
- Kapitel 5: Einbettung der Unterrichtsstunden in die Lernsituation: Hier wird die konkrete Einbettung der Unterrichtsstunden in die Lernsituation beschrieben, die sich an den vorherigen Kapiteln orientiert und die didaktischen Ziele verfolgt.
- Kapitel 6: Durchzuführende Unterrichtsstunde: In diesem Kapitel wird die konkrete Unterrichtsstunde detailliert vorgestellt, inklusive Handlungsstruktur, Begründung, didaktischem Ansatz, zu fördernden Kompetenzen, Methoden, Medien und Sozialformen sowie dem Artikulationsschema.
Schlüsselwörter
Fächerintegrative Lernsituation, postoperativer Schmerz, Schmerzmanagement, Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Pflegeberufe, didaktische Reduktion, Kompetenzen, Handlungsstruktur, Unterrichtsstunde, Artikulationsschema.
- Quote paper
- Bachelor Bettina Schmidt (Author), 2010, Konstruktion von fächerintegrativen Lernsituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/172575