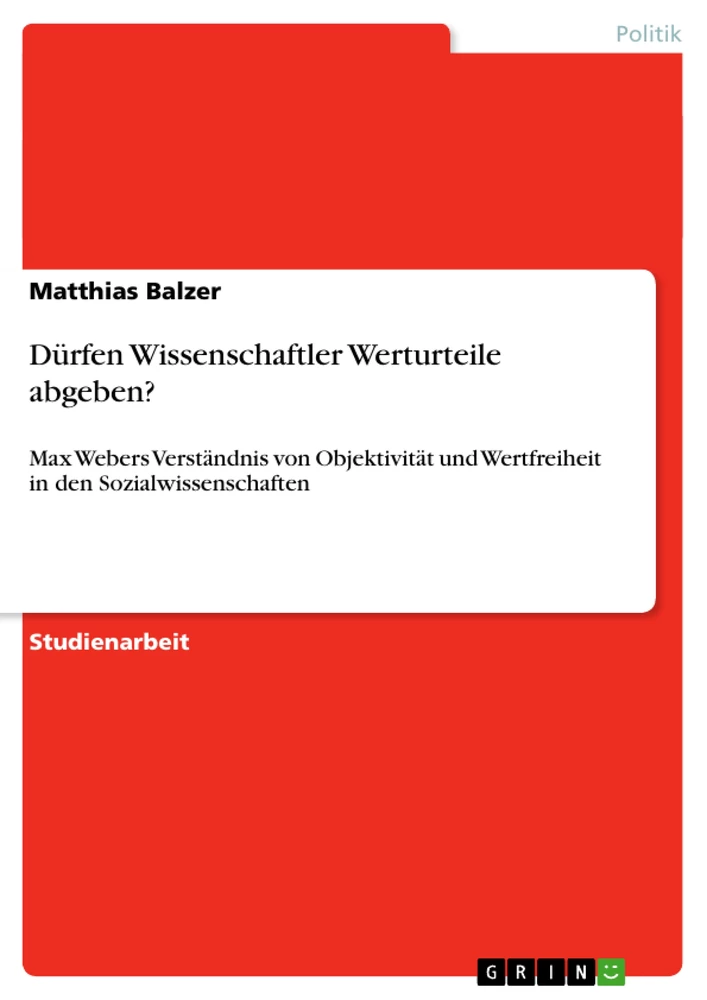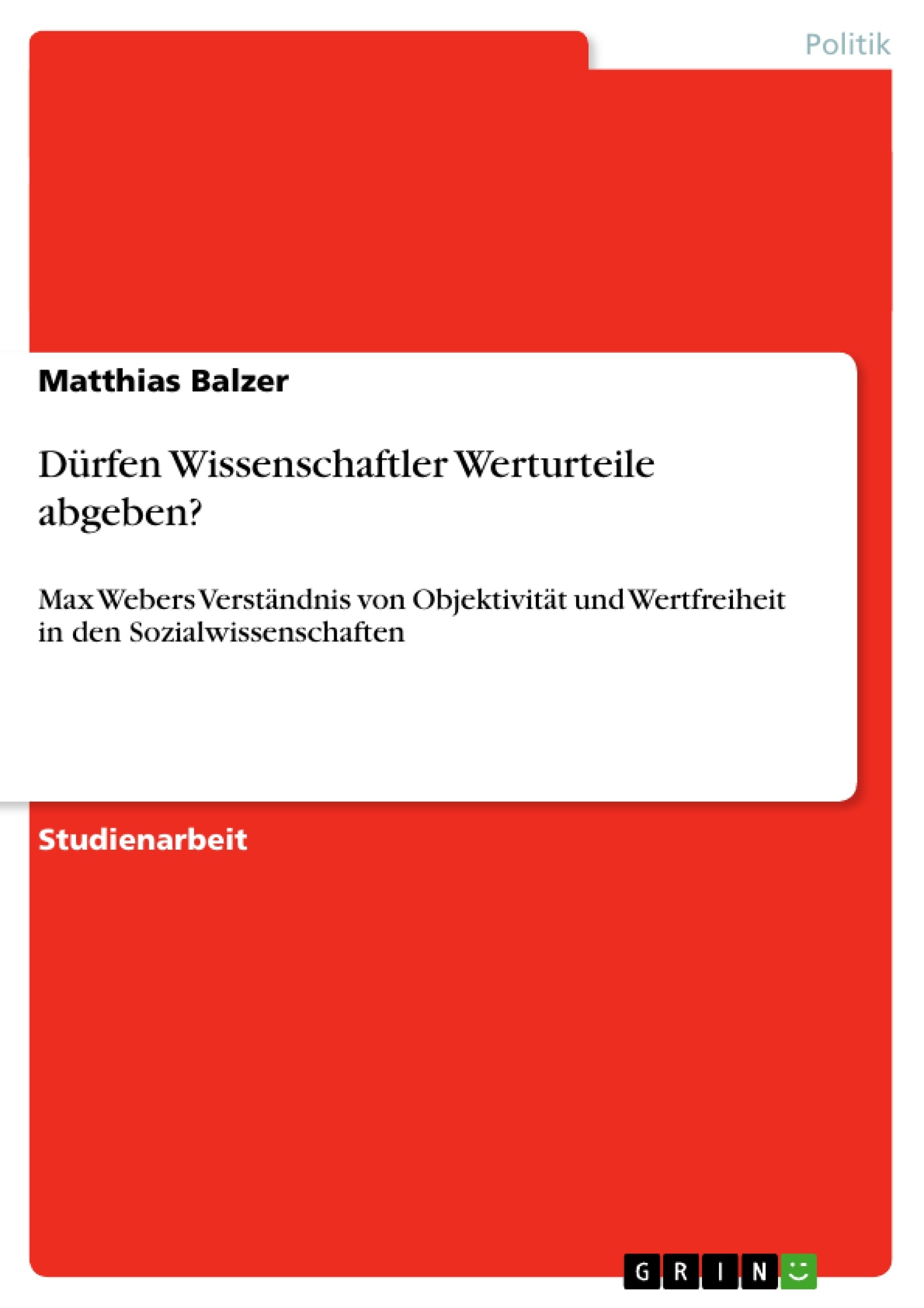Über Zweck und Aufgabe von Wissenschaft, insbesondere der Kultur- und Sozialwissenschaften wird seit geraumer Zeit gestritten. Bereits zu Beginn des 20.Jhdt. wurde im sogenannten Werturteilsstreit darüber diskutiert, ob es Aufgabe der Wissenschaft ist praktische Werturteile abzugeben oder nicht. Während den 1960er Jahren wurde diese Frage erneut im sogenannten Positivismusstreit aufgegriffen, bei dem sich unter anderem Popper und Adorno gegenüberstanden. Doch auch in der Gegenwart ist die Frage nach den Werten in der Wissenschaft nicht vollständig geklärt. Immer wieder wird von der Wissenschaft gefordert Antworten auf konkrete Probleme der Politik, der Wirtschaft oder der Gesellschaft zu geben. So wird auch in aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen (z.B. Mindestlöhne, Sterbehilfe oder Armutsbekämpfung) von der Wissenschaft erwartet, „(…) dass sie praktische Empfehlungen und Reformen für Politik und Gesellschaft unterbreiten müsste“ (vgl. Müller 2007: 189). Max Weber war einer der ersten Intellektuellen, der die Vermengung von Fakten und Wertungen in wissenschaftlichen Aussagen ablehnte. Sein Postulat der Werturteilsfreiheit ist Gegenstand dieser Arbeit.
Im ersten Teil der Arbeit soll auf den historischen Kontext von Max Webers Werken eingegangen werden. Zum einen soll auf seine Stellung im „Verein für Sozialpolitik“, in dem der Werturteilsstreit ausgetragen wurde, eingegangen werden. Zum anderen soll das an Universitäten übliche Phänomen der „Professoren-Prophetie“ erläutert werden. Im zweiten Teil soll Max Webers Verständnis von Wissenschaft anhand zweier Aufsätze und eines Vortrags („Wissenschaft als Beruf“) herausgearbeitet werden. Hierbei geht es um das Verhältnis von Fakten und Werturteilen, Prognosen und Gesetzmäßigkeiten in den Sozialwissenschaften und den Sinn der Wertfreiheit. Im letzten Teil soll die Kritik an Max Weber und der Fortgang der Werturteilsdiskussion im Positivismusstreit dargestellt werden, sowie ein Bezug zur Gegenwart hergestellt werden. Damit soll gezeigt werden, dass Max Webers Verständnis von Wertfreiheit in der Wissenschaft auch heute noch Gültigkeit besitzt und in der Lage ist die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 2. Der historische Kontext
- 2.1 Professoren-Prophetie und das universitäre Umfeld
- 2.2 Methoden- und Werturteilsstreit
- 3. Max Webers Wissenschaftslehre
- 3.1 Der „Objektivitätsaufsatz“ (1904)
- 3.2 Der „Wertfreiheitsaufsatz“ (1917)
- 3.3 Wissenschaft als Beruf (1919)
- 4. Nachwirkung und Rezeption
- 4.1 Kritik an Webers Prinzip der Wertfreiheit
- 4.2. Der Positivismusstreit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Max Webers Verständnis von Objektivität und Wertfreiheit in den Sozialwissenschaften. Sie untersucht, wie Webers Positionen im historischen Kontext des Werturteilsstreits und der Professoren-Prophetie entstanden sind und welche Auswirkungen sie auf die wissenschaftliche Praxis hatten. Die Arbeit analysiert Webers Schriften und untersucht seine Argumentation für die strikte Trennung von Fakten und Wertungen in der wissenschaftlichen Forschung.
- Der Werturteilsstreit in der Sozialwissenschaft
- Das Problem der Professoren-Prophetie und die Frage nach der Objektivität in der Wissenschaft
- Max Webers Konzept der Wertfreiheit und seine Kritik an der Vermengung von Fakten und Wertungen
- Die Nachwirkungen und die Kritik an Webers Position im Positivismusstreit
- Die Relevanz von Webers Ideen für die heutige Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Fakten und Wertungen in der Wissenschaft dar. Es zeigt die Kontroverse im Werturteilsstreit auf und erläutert die Relevanz von Max Webers Positionen in diesem Kontext.
- Kapitel 2: Der historische Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund von Max Webers Werken und stellt die relevanten Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar. Es beschreibt den Methodenstreit und das Phänomen der Professoren-Prophetie, die maßgeblich auf Webers Verständnis von Wissenschaft einwirkten.
- Kapitel 3: Max Webers Wissenschaftslehre: Dieses Kapitel analysiert Max Webers Verständnis von Wissenschaft anhand seiner Schriften, insbesondere "Objektivitätsaufsatz" (1904), "Wertfreiheitsaufsatz" (1917) und "Wissenschaft als Beruf" (1919). Es untersucht Webers Argumentation für die Trennung von Fakten und Werturteilen sowie die Bedeutung der Wertfreiheit für die wissenschaftliche Praxis.
- Kapitel 4: Nachwirkung und Rezeption: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption und Kritik an Max Webers Positionen, insbesondere die Auseinandersetzung im Positivismusstreit. Es beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf die Frage nach der Wertfreiheit und die Entwicklungen in der wissenschaftlichen Diskussion.
Schlüsselwörter
Werturteilsfreiheit, Objektivität, Sozialwissenschaften, Wissenschaftslehre, Professoren-Prophetie, Methodenstreit, Positivismusstreit, Max Weber, Historischer Kontext.
- Quote paper
- Matthias Balzer (Author), 2009, Dürfen Wissenschaftler Werturteile abgeben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/172459