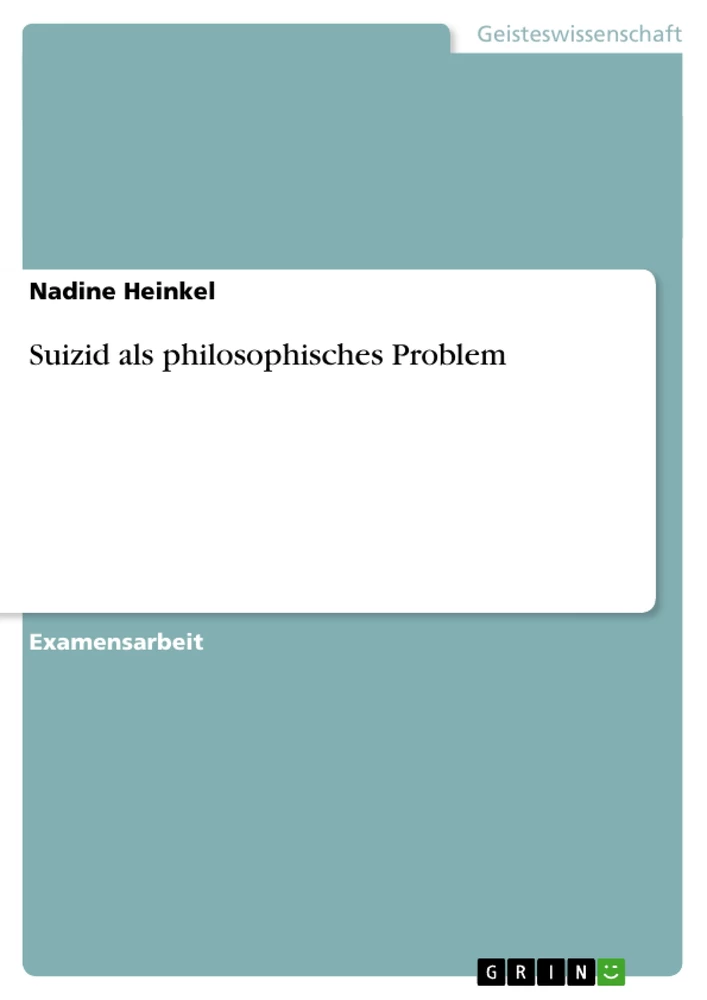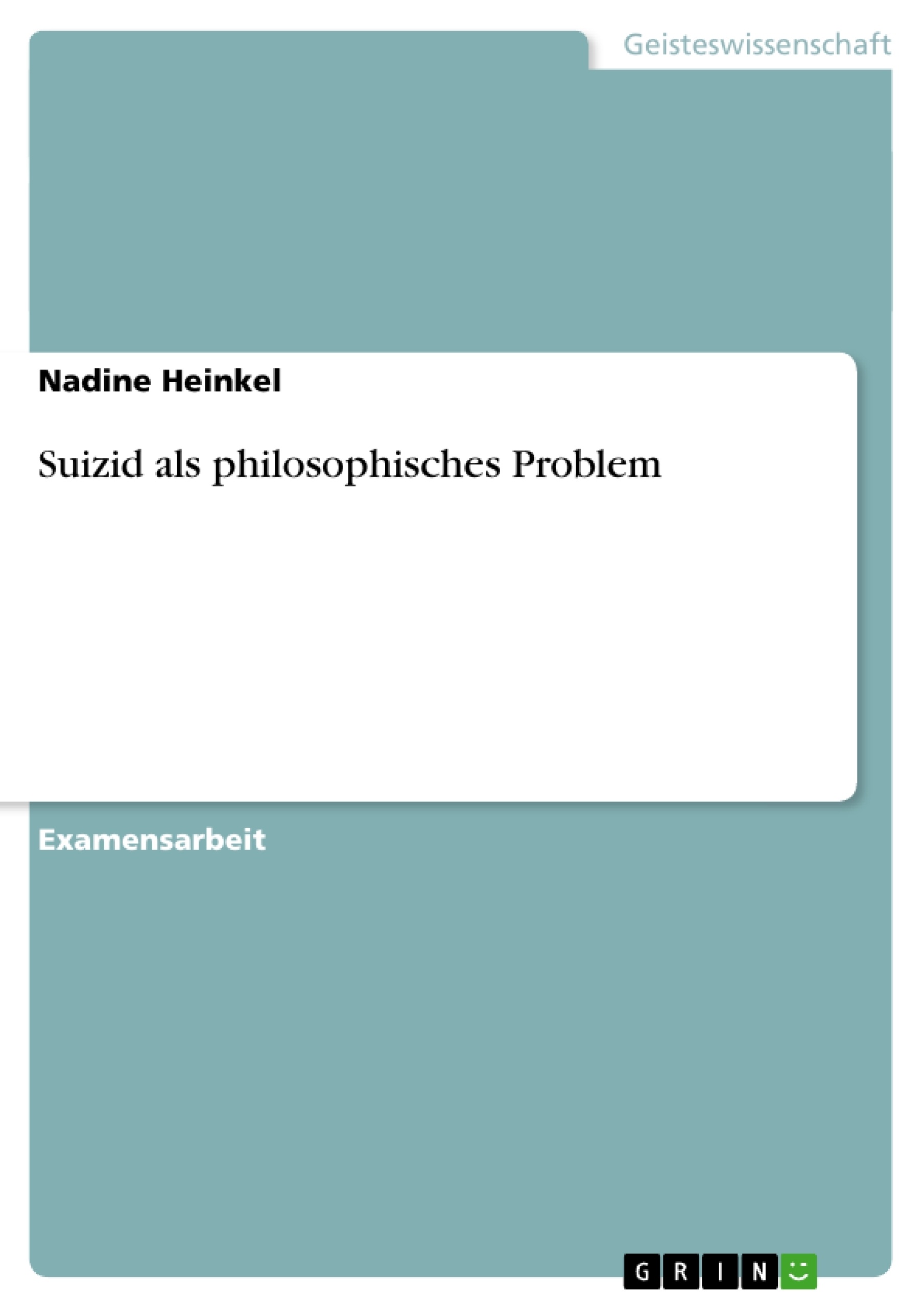»In statistischer Hinsicht wissen wir heute alles über den Selbstmord, aber was das Grundproblem angeht, ist man kaum weitergekommen und wird auch nicht weiterkommen, solange stillschweigend die Gewißheit herrscht, daß das Leben um jeden Preis besser ist als der Tod.«
Statistiken sind bekanntlich wichtige Instrumentarien der Medizin, wenn es darum geht, die Epidemiologie einer Krankheit zu untersuchen. Doch handelt es sich beim Suizid überhaupt um eine Krankheit, welche auf diese Weise erfasst und untersuchbar gemacht werden kann? Der Suizid als »Krankheit zum Tode« also, an der schon Goethes Werther zugrunde ging?
[...]
Betrachtet man verschiedene Philosophen, so zeigt sich schnell, dass der Suizid zu jeder Zeit als weit mehr als eine Krankheit erachtet wurde. Er stellt vielmehr ein moralisches Problem dar, ja sogar das einzig wirklich ernste philosophische Problem, wenn es nach Camus geht, der zu Beginn seines Werkes Der Mythos des Sisyphos feststellt: »Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten.«
[...]
Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, den Suizid aus philosophischer Perspektive zu betrachten. Einleitend soll eine Abgrenzung der Begriffe Selbstmord, Freitod, Suizid und Selbsttötung sowie eine Definition vorangestellt werden.
Weil Suizid Sterben bedeutet, ist die Frage danach, was überhaupt Sterben und Tod sowie Leben heißt bzw. die Frage nach dem Sinn des Lebens, ebenfalls wichtig für die Suizidproblematik. Um diese Fragen soll es daher in Kapitel II gehen.
Daraufhin gibt Kapitel III einen Überblick darüber, wie der Suizid in der Geschichte der Philosophie gesehen wird. Grob kann man dabei zwischen zwei Positionen unterscheiden, welche mit dem Streben nach Transzendenz und der Verneinung der Transzendenz einhergehen. Während die einzelnen Ansichten hier horizontal abgearbeitet werden, befasst sich Kapitel IV dann beispielhaft anhand einer Analyse von Amérys Hand an sich legen mit der postmodernen Phase, in welcher der Suizid aufgrund von Überforderung und Selbstverausgabung des Subjekts als letzte Möglichkeit gesehen wird, der Biographie einen Sinn zu geben, bevor eine Zusammenfassung die Arbeit beschließt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Zur Terminologie
- 1. Selbstmord, Freitod oder Suizid?
- 2. Freiheit
- II. Suizid: Bewegung vom Sein zum Tod
- 1. Lebensbegriff und die Frage nach dem Sinn des Lebens
- 2. Der Umgang mit dem Phänomen Tod
- III. Der Suizid in der Philosophiegeschichte
- 1. Antike
- 2. Christliches Mittelalter
- 3. Neuzeit
- 4. 19. Jahrhundert
- 5. 20. Jahrhundert
- IV. Jean Amérys Hand an sich legen als Beispiel für den Umgang mit der Suizidproblematik in der Postmoderne
- 1. Aufbau
- 2. Inhalt
- 3. Das philosophische Potential
- 4. Würdigung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Suizid als philosophisches Problem. Ziel ist es, verschiedene philosophische Perspektiven auf Selbsttötung von der Antike bis zur Postmoderne zu beleuchten und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Umgang mit dem Thema in verschiedenen Epochen und philosophischen Strömungen.
- Definition und Begriffsbestimmung von Suizid und Freiheit
- Philosophische Betrachtung des Lebensbegriffs und des Sinns des Lebens im Zusammenhang mit Suizid
- Historische Entwicklung der philosophischen Auseinandersetzung mit Suizid
- Analyse von Jean Amérys "Hand an sich legen" als Beispiel für die postmoderne Debatte
- Bewertung der verschiedenen philosophischen Positionen zum Thema Suizid
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach dem Suizid als philosophisches Problem und nicht nur als medizinisch-statistisches Phänomen. Sie hebt die unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Medizin und Philosophie hervor und betont die Einzigartigkeit des Menschen, sich selbst das Leben nehmen zu können, bedingt durch Selbstreflexion und Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende Auseinandersetzung mit dem Thema, indem sie die Grenzen rein statistischer Betrachtung aufzeigt und den philosophischen Ansatz begründet.
I. Zur Terminologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der genauen Definition von Begriffen wie „Selbstmord“, „Freitod“ und „Suizid“, differenziert diese und erläutert den Unterschied. Es analysiert den Begriff der Freiheit, insbesondere im Kontext der Selbstbestimmung am Lebensende und legt die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit der moralischen und philosophischen Bewertung von Suizidhandlungen. Die klare Definition dieser zentralen Begriffe ist essenziell für ein präzises Verständnis der folgenden Kapitel.
II. Suizid: Bewegung vom Sein zum Tod: Dieses Kapitel erörtert den Lebensbegriff und die Frage nach dem Sinn des Lebens im Kontext von Suizid. Es untersucht kritisch, wie das Phänomen Tod in verschiedenen philosophischen und kulturellen Kontexten wahrgenommen und gedeutet wird. Die Auseinandersetzung mit diesen existentiellen Fragen bildet die Brücke zwischen der begrifflichen Klärung und der Analyse der historischen Entwicklung des Denkens zum Suizid.
III. Der Suizid in der Philosophiegeschichte: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die philosophischen Auseinandersetzungen mit dem Suizid von der Antike über das Mittelalter und die Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. Es analysiert die Positionen wichtiger Denker wie Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin, Montaigne, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Camus und Wittgenstein und zeigt die Entwicklung der Argumentationslinien und die unterschiedlichen Perspektiven auf. Der Bogen spannt sich von ethischen und moralischen Erwägungen bis hin zu existenzialistischen Überlegungen.
IV. Jean Amérys Hand an sich legen als Beispiel für den Umgang mit der Suizidproblematik in der Postmoderne: Dieses Kapitel analysiert Jean Amérys Werk "Hand an sich legen" als Fallbeispiel für die postmoderne Auseinandersetzung mit Suizid. Es untersucht den Aufbau des Werkes, den Inhalt mit seinen zentralen Argumenten (z.B. Lebenslogik vs. Todeslogik, Natur vs. Norm, Humanität und Würde, das Verhältnis Ich-Körper etc.), das philosophische Potential und bietet eine kritische Würdigung. Die Analyse von Amérys Werk dient als exemplarischer Abschluss, der die vorherigen Ausführungen zusammenfasst und in einen zeitgenössischen Kontext stellt.
Schlüsselwörter
Suizid, Freitod, Selbstmord, Freiheit, Selbstbestimmung, Lebensbegriff, Sinn des Lebens, Tod, Philosophiegeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Aufklärung, Existentialismus, Postmoderne, Jean Améry, ethische Bewertung, moralische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen zu: Philosophische Betrachtung des Suizids
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Suizid als philosophisches Problem von der Antike bis zur Postmoderne. Sie analysiert verschiedene philosophische Perspektiven auf Selbsttötung und beleuchtet den Umgang mit dem Thema in verschiedenen Epochen und philosophischen Strömungen. Der Fokus liegt auf der philosophischen, nicht der medizinisch-statistischen Betrachtung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Begriffsbestimmung von Suizid und Freiheit, die philosophische Betrachtung des Lebensbegriffs und des Sinns des Lebens im Zusammenhang mit Suizid, die historische Entwicklung der philosophischen Auseinandersetzung mit Suizid, eine Analyse von Jean Amérys "Hand an sich legen" als Beispiel für die postmoderne Debatte und eine Bewertung der verschiedenen philosophischen Positionen zum Thema Suizid.
Welche Begriffe werden im Detail geklärt?
Die Arbeit klärt die Begriffe "Selbstmord", "Freitod" und "Suizid" und analysiert den Begriff der Freiheit im Kontext der Selbstbestimmung am Lebensende. Eine präzise Definition dieser Begriffe ist Grundlage des Verständnisses der weiteren Ausführungen.
Wie wird der Lebensbegriff und der Sinn des Lebens behandelt?
Das Werk erörtert den Lebensbegriff und die Frage nach dem Sinn des Lebens im Kontext von Suizid und untersucht, wie das Phänomen Tod in verschiedenen philosophischen und kulturellen Kontexten wahrgenommen und gedeutet wird.
Welche philosophischen Epochen und Denker werden berücksichtigt?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die philosophischen Auseinandersetzungen mit Suizid von der Antike (Platon, Aristoteles) über das Mittelalter (Augustinus, Thomas von Aquin) und die Neuzeit (Montaigne, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche) bis ins 20. Jahrhundert (Sartre, Camus, Wittgenstein). Es werden die unterschiedlichen Perspektiven und die Entwicklung der Argumentationslinien analysiert.
Welche Rolle spielt Jean Amérys "Hand an sich legen"?
Jean Amérys Werk "Hand an sich legen" dient als Fallbeispiel für die postmoderne Auseinandersetzung mit Suizid. Die Arbeit analysiert den Aufbau, den Inhalt (Lebenslogik vs. Todeslogik, Natur vs. Norm etc.), das philosophische Potential und bietet eine kritische Würdigung des Werkes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Suizid, Freitod, Selbstmord, Freiheit, Selbstbestimmung, Lebensbegriff, Sinn des Lebens, Tod, Philosophiegeschichte, Antike, Mittelalter, Neuzeit, Aufklärung, Existentialismus, Postmoderne, Jean Améry, ethische Bewertung, moralische Bewertung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Terminologie, ein Kapitel zum Suizid als Bewegung vom Sein zum Tod, ein Kapitel zum Suizid in der Philosophiegeschichte und ein Kapitel zur Analyse von Jean Amérys "Hand an sich legen".
- Quote paper
- Nadine Heinkel (Author), 2010, Suizid als philosophisches Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/172089