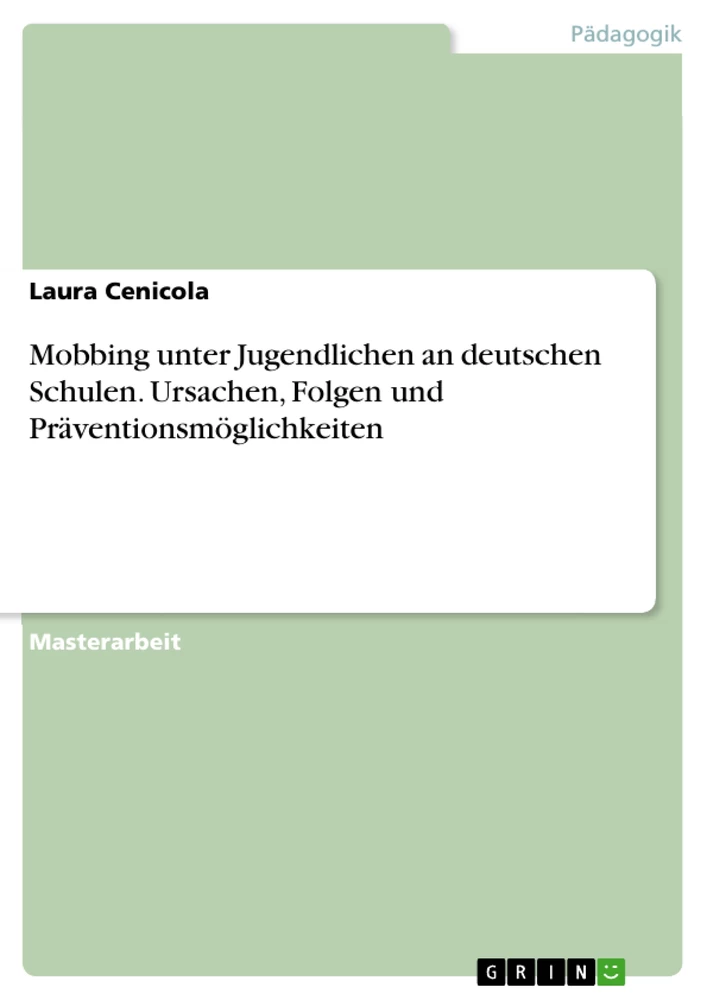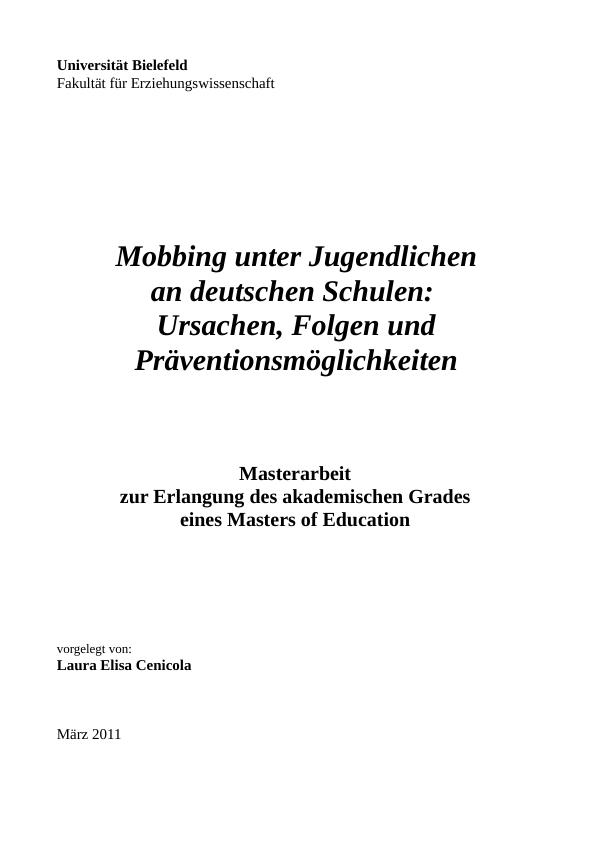Mobbing hat es schon immer gegeben und die Schule ist der Ort, an dem am meisten Mobbing stattfindet (vgl. Olweus 2006, S.32). Seit etwa zwei Jahrzehnten aber steht Mobbing aktiv in der öffentlichen Diskussion, da die Problematik in der Schule scheinbar immer mehr zunimmt (vgl. ebd., S.28), denn Lehrer1 und Eltern berichten immer häufiger von ernsten Vorfällen, welche starke psychische und zum Teil auch physische Probleme nach sich ziehen. Mittlerweile wird Mobbing als eine radikale und „besonders problematische Gewaltform an Schulen wahrgenommen“ (Schubarth 2010, S.57). Erst in den 1990er Jahren wurde der Gewaltbegriff erweitert und man fasste nicht mehr nur Aggressionen darunter (vgl. ebd., S.55). Seit den 2000er Jahren zählt insbesondere Mobbing zu den Gewaltformen, die an Schulen erforscht werden (vgl. ebd.).
Diese Arbeit soll dazu beitragen, das facettenreiche Phänomen genau zu analysieren und ein geeignetes, bereits vorerprobtes Instrument für Schulen zu entwickeln, mit welchem aufgezeigt werden kann, inwiefern die Lehrkräfte an einer Schule die möglichen Präventionsmaßnahmen kennen und bewerten. Mobbing ist eine moderne Form von Gewalt an Schulen, welche besonders zugenommen hat (vgl. Schubarth 2010, S.58). Deshalb sollten Schulen auch zunehmend bemüht sein, gegen Mobbingprozesse anzukämpfen. Mein Ziel ist also erreicht, wenn Schulen durch dieses Instrument die Schwächen bezüglich der Prävention von Mobbing erkennen können und im nächsten Schritt verbesserte Maßnahmen an der Schule ergreifen können, um aktiv gegen Mobbing vorzubeugen. Daher bin ich letztlich zu der folgenden Fragestellung der vorliegenden Arbeit gekommen: „Mobbing unter Jugendlichen an deutschen Schulen: Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Warum das Thema Mobbing?
- 1.2 Begriffsdefinition „Mobbing“
- 1.3 Ausmaße von Mobbing
- 1.4 Abgrenzung zum Bullying und Cyber-Mobbing
- 2 Ursachen von Mobbing
- 2.1 Wodurch ist Mobbing begründet?
- 2.1.1 Schule als Lernort und als Sozialisationsinstanz
- 2.1.2 Aussehen und Verhalten der Schüler
- 2.1.3 Familie und Herkunft
- 2.1.4 Einflüsse durch die Peergruppe
- 2.1.5 Gesellschaftliche Strukturen und Medien
- 2.2 Welche Anzeichen gibt es für Mobbing in der Schule?
- 3 Folgen von Mobbing
- 3.1 Folgen auf physischer/gesundheitlicher Ebene
- 3.1.1 Ein Fallbeispiel
- 3.1.1.1 Erläuterungen und Diskussion des Fallbeispiels
- 3.2 Folgen auf psychischer/schulischer/sozialer Ebene
- 3.2.1 Ein Fallbeispiel
- 3.2.1.1 Erläuterungen und Diskussion des Fallbeispiels
- 3.3 Folgen im Hinblick auf die Täter
- 4 Rollen der Beteiligten an einem Mobbingprozess
- 4.1 Die Täterrolle: Typische Tätermerkmale
- 4.2 Die Opferrolle: Typische Opfermerkmale
- 4.3 Typische Beziehungen zwischen Täter und Opfer
- 4.4 Die Rolle des Verstärkers/Antreibers
- 4.5 Die Rolle des Mitläufers/Außenstehenden
- 4.6 Die Rolle des Verteidigers
- 5 Präventionsmöglichkeiten
- 5.1 Präventionsmaßnahmen durch die Schule als Institution
- 5.2 Präventionsmaßnahmen durch die Lehrer
- 5.2.1 Exkurs: Einschätzung der Reaktionen auf Mobbing von Lehrkräften
- 5.3 Präventionsmaßnahmen durch die Eltern
- 5.4 Präventionsmaßnahmen durch die Schüler selbst
- 6 Bewertung der Präventionsmöglichkeiten durch Lehrer (Empirischer Teil)
- 6.1 Das Untersuchungsdesign
- 6.1.1 Ziel der Befragung
- 6.1.2 Der Fragebogen als Instrument
- 6.1.3 Beschreibung des Feldes und der Befragten
- 6.2 Erhebungsergebnisse und Diskussion
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Phänomen Mobbing unter Jugendlichen an deutschen Schulen. Ziel ist die Analyse von Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten. Ein empirischer Teil bewertet die Einschätzung von Lehrkräften zu Präventionsmaßnahmen.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing
- Ursachen von Mobbing (schulische, familiäre, gesellschaftliche Faktoren)
- Folgen von Mobbing für Opfer und Täter
- Rollen der Beteiligten im Mobbingprozess
- Präventionsmöglichkeiten und deren Bewertung durch Lehrer
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Mobbings an deutschen Schulen ein. Sie begründet die Wahl des Themas, definiert den Begriff Mobbing und dessen Abgrenzung zu Bullying und Cybermobbing, beleuchtet das Ausmaß des Problems in Deutschland und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der einleitende Fall eines Jugendlichen namens Tim verdeutlicht die gravierenden Folgen von Mobbing.
2 Ursachen von Mobbing: Dieses Kapitel untersucht die vielschichtigen Ursachen von Mobbing. Es analysiert die Rolle der Schule als Sozialisationsinstanz, den Einfluss von Aussehen und Verhalten der Schüler, familiäre Hintergründe, den Einfluss der Peergruppe und gesellschaftliche sowie mediale Faktoren. Der sozialisationstheoretische Ansatz wird als integrativer Erklärungsansatz hervorgehoben.
3 Folgen von Mobbing: Hier werden die physischen, psychischen, schulischen und sozialen Folgen von Mobbing für Opfer und Täter detailliert dargestellt. Zwei Fallbeispiele – die Geschichten von Jens und Mehmet – illustrieren die weitreichenden und oft verheerenden Konsequenzen von Mobbing, die von körperlichen Verletzungen bis hin zu Selbstmordgedanken reichen können. Das Kapitel betont auch die Bedeutung von frühzeitigem Eingreifen.
4 Rollen der Beteiligten an einem Mobbingprozess: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Rollen, die Schüler in einem Mobbingprozess einnehmen: Täter, Opfer, Verstärker, Mitläufer und Verteidiger. Es werden typische Merkmale dieser Rollen analysiert und die Beziehungen zwischen Tätern und Opfern untersucht, wobei auch die Unterscheidung zwischen passiven und provozierenden Opfertypen berücksichtigt wird.
5 Präventionsmöglichkeiten: Das Kapitel diskutiert Präventionsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen: Schule, Lehrer, Eltern und Schüler. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, darunter Anti-Gewaltprogramme, Mediation, Schulregeln, und die Stärkung sozialer Kompetenzen. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Schülern wird besonders betont.
6 Bewertung der Präventionsmöglichkeiten durch Lehrer (Empirischer Teil): Dieser Kapitel beschreibt eine empirische Studie mit einem Fragebogen, der an 30 Lehrkräften eines Gymnasiums durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen die Wahrnehmung der Lehrer zum Ausmaß von Mobbing, ihre Reaktionen auf Mobbingfälle, und ihre Einschätzung verschiedener Präventionsmaßnahmen. Die Studie deckt sowohl Stärken als auch Schwächen der Präventionsmaßnahmen an der untersuchten Schule auf.
Schlüsselwörter
Mobbing, Bullying, Cybermobbing, Schule, Jugendliche, Prävention, Intervention, Opfer, Täter, Ursachen, Folgen, Sozialisation, Peergruppe, Familie, Medien, Empathie, soziale Kompetenz, Lehrkräfte, empirische Forschung, Fragebogen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Masterarbeit über Mobbing an deutschen Schulen
Was ist der Hauptfokus dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht das Phänomen Mobbing an deutschen Schulen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten von Mobbing unter Jugendlichen. Ein empirischer Teil bewertet die Einschätzung von Lehrkräften zu verschiedenen Präventionsmaßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Mobbing (inkl. Bullying und Cybermobbing), Ursachen von Mobbing (schulische, familiäre und gesellschaftliche Faktoren), Folgen von Mobbing für Opfer und Täter, die verschiedenen Rollen der Beteiligten im Mobbingprozess (Täter, Opfer, Verstärker, Mitläufer, Verteidiger), sowie verschiedene Präventionsmöglichkeiten und deren Bewertung durch Lehrer mittels einer empirischen Studie.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (mit Definition und Abgrenzung von Mobbing und Fallbeispiel), Ursachen von Mobbing (inkl. sozialisationstheoretischer Ansatz), Folgen von Mobbing (mit Fallbeispielen für Opfer und Täter), Rollen der Beteiligten im Mobbingprozess, Präventionsmöglichkeiten (auf Schulebene, Lehrer, Eltern und Schüler), Bewertung der Präventionsmöglichkeiten durch Lehrer (empirischer Teil mit Beschreibung des Untersuchungsdesigns, des Fragebogens und der Ergebnisse), und schließlich ein Fazit und Ausblick.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse der bestehenden Literatur zu Mobbing und eine quantitative Methode im empirischen Teil. Im empirischen Teil wurde ein Fragebogen an 30 Lehrkräften eines Gymnasiums eingesetzt, um deren Einschätzung zu Präventionsmaßnahmen zu erheben und zu analysieren.
Welche Ergebnisse liefert der empirische Teil?
Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse einer Befragung von Lehrkräften zu ihrem Umgang mit Mobbingfällen und ihrer Einschätzung verschiedener Präventionsmaßnahmen. Die Studie deckt sowohl Stärken als auch Schwächen der an der untersuchten Schule angewandten Präventionsmaßnahmen auf.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit und der Ausblick der Arbeit fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und geben Handlungsempfehlungen für die Prävention von Mobbing an Schulen. Es werden die Grenzen der Studie aufgezeigt und zukünftige Forschungsfragen benannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Mobbing, Bullying, Cybermobbing, Schule, Jugendliche, Prävention, Intervention, Opfer, Täter, Ursachen, Folgen, Sozialisation, Peergruppe, Familie, Medien, Empathie, soziale Kompetenz, Lehrkräfte, empirische Forschung, Fragebogen.
Wo finde ich Fallbeispiele?
Die Arbeit enthält mehrere Fallbeispiele, um die Folgen von Mobbing für Opfer und Täter zu veranschaulichen. Ein Fallbeispiel wird bereits in der Einleitung vorgestellt, weitere finden sich in Kapitel 3 (Folgen von Mobbing).
Welche Rolle spielen verschiedene Akteure (Schule, Lehrer, Eltern, Schüler) bei der Prävention?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Schule, Lehrern, Eltern und Schülern bei der Prävention von Mobbing und präsentiert verschiedene Präventionsmaßnahmen auf jeder dieser Ebenen. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren wird besonders hervorgehoben.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant darstellt.
- Arbeit zitieren
- Laura Cenicola (Autor:in), 2011, Mobbing unter Jugendlichen an deutschen Schulen. Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/171371