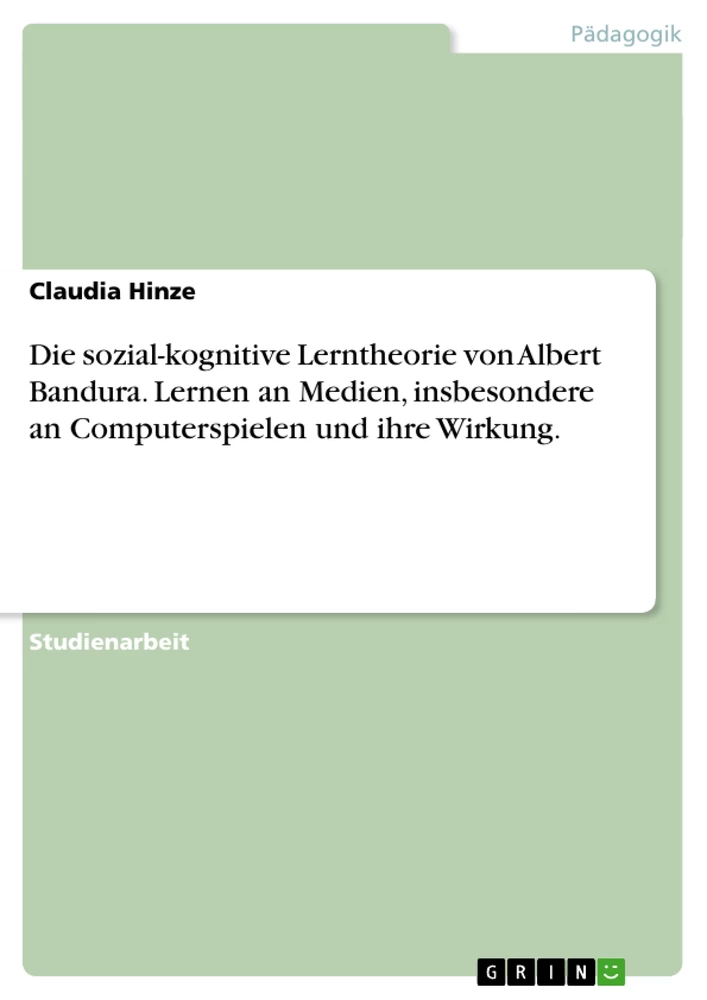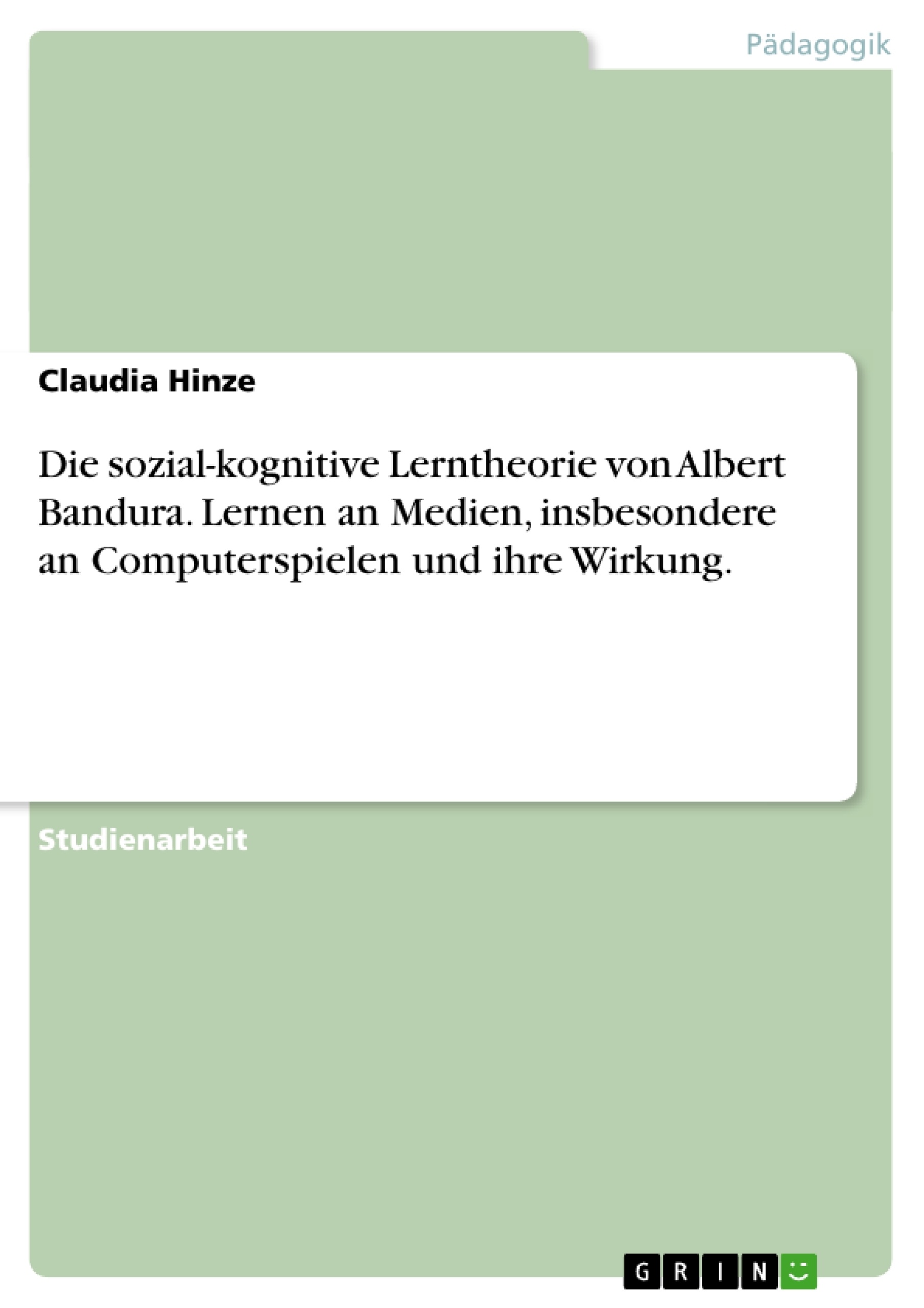Albert Bandura wurde am 4.12.1925 in Alberta geboren. Dort verbrachte
er seine Jugendzeit, bevor er sein Studium an der Universität von British
Columbia begann. Später entschied er sich für die Universität von Iowa,
um dort Klinische Psychologie zu studieren und an den Erforschungen
von Lernprozessen teilzunehmen. 1950 ging er nach Stanford und
arbeitete dort auf dem Gebiet der Interaktionsprozesse in der
Psychotherapie und dem Familienmuster, welches Aggressivität bei
Kindern erzeugt. Während der Arbeit auf diesem Gebiet, stieß er auf die zentrale Rolle des
Modelllernens bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ziel seiner Forschungen war eine
umfassende Theorie vom menschlichen Verhalten zu erhalten, um die menschlichen
Fähigkeiten besser einordnen zu können.
1980 erhielt Bandura die wissenschaftliche Auszeichnung der Vereinigung der „American
Psychological Association“ für „vorbildliche Leistungen als Forscher, Lehrender und
Theoretiker“. 1
Bandura vertrat, bevor er nach Stanford ging, die behavioristische Sichtweise, in welcher der
Mensch passiv und von außen gesteuert dargestellt wird.
Die behavioristischen Lerntheorien, die die klassische und instrumentelle Konditionierung
beinhalten, beschreiben den Mensch als „black box“. Nur die sichtbaren Aspekte des
Lernprozesses werden dargestellt. Nach der Auffassung der Behavioristen reagieren
Menschen nur auf Reize, wie Belohnung oder Bestrafung.
Die Ergebnisse seiner Forschungen interpretierte Bandura folgendermaßen: Der Mensch lernt
nicht nur durch sofortige Verstärkung seines Verhaltens, sondern es genügt ihm, andere
Personen, die als Modelle fungieren und die nach einer bestimmten Verhaltensweise belohnt
oder bestraft werden, zu beobachten. Heute gilt Bandura als wichtigster Vertreter der Theorie des Lernens am Modell.
Bandura ordnet die Theorie des Modelllernens (1969) den kognitiven Lerntheorien zu und
verließ damit den Boden des Behaviorismus.
Demnach spricht er dem Lernenden eine aktivere Rolle zu, da dieser im Stande ist neue Reize
und Informationen aufzunehmen, diese zu verarbeiten und anschließend darauf zu reagieren.
In der sozial – kognitiven Theorie gilt Verstärkung als förderlich, aber nicht als notwendige
Bedingung. [...]
1 Diese Ausführung stütz sich auf Stangl, Werner: „Lernen am Modell – Albert Bandura“.
http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNEN/Modelllernen.shtml
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modelllernen
- Die sechs Typen des Modelllernens
- Beeinflussung von Auffassungen über die Realität
- Übertragung emotionaler Erregung
- Reaktionsauslösung
- Soziale Veranlassung
- Hemmung und Enthemmung
- Beobachtungslernen
- Die Aneignungsphase (Akquisition)
- Der Aufmerksamkeitsphase (attention)
- Der Behaltensphase (retention)
- Die Ausführungsphase (Performanz)
- Motorische Reproduktionsphase (production)
- Verstärkungs- und Motivationsphase (motivation)
- Die Aneignungsphase (Akquisition)
- Untersuchung von Bandura 1965
- Die Selbststeuerung
- Die sechs Typen des Modelllernens
- Die Massenmedien
- Medienwirkungsforschung
- Katharsistheorie
- Inhibitionsthese
- Wirkungslosigkeit
- Lernorientierte Theorien
- Imitation
- Suggestionstheorie
- Stimulationstheorie
- Habitualisierungsthese
- Entwicklung von Aggressionsauslösern
- Die Medienwelt als Kinderspielzeug
- Junp`n Run-Spiele
- Kampf und Blut-Spiele (Ego-Shooter)
- Simulations- und Strategiespiele
- Adventure-Spiele
- Untersuchung von Clemens Trudewind und Rita Steckel
- Computeranimationen im Militär
- Medienwirkungsforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura und untersucht die Rolle des Modelllernens, insbesondere im Kontext von Medien, insbesondere Computerspielen. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Modelllernen auf die Entwicklung von Verhaltensweisen und Emotionen, insbesondere im Hinblick auf Aggressivität.
- Die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura
- Modelllernen und seine Auswirkungen auf das menschliche Verhalten
- Die Rolle von Medien, insbesondere Computerspielen, im Lernprozess
- Die Entwicklung von Aggressivität und ihre Ursachen im Kontext von Medienkonsum
- Die Bedeutung von Selbststeuerung im Prozess des Modelllernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Albert Bandura und seine sozial-kognitive Lerntheorie vor. Sie erklärt die zentralen Elemente dieser Theorie und ihre Bedeutung für die Untersuchung von Lernprozessen. Das Kapitel "Modelllernen" geht ausführlich auf die sechs Typen des Modelllernens ein und analysiert die Aneignungsphase (Akquisition) und die Ausführungsphase (Performanz) des Beobachtungslernens. Die Untersuchung von Bandura aus dem Jahr 1965 wird ebenfalls behandelt, welche die grundlegenden Prinzipien des Modelllernens verdeutlicht. Abschließend wird die Selbststeuerung als ein wichtiger Faktor im Kontext des Modelllernens betrachtet. Das Kapitel "Die Massenmedien" untersucht die Medienwirkungsforschung und verschiedene Theorien, die die Wirkung von Medien auf das menschliche Verhalten erklären, wie z.B. die Katharsistheorie, die Inhibitionsthese, die Wirkungslosigkeitsthese und lernorientierte Theorien. Die Entwicklung von Aggressionsauslösern durch Medien und die Darstellung der Medienwelt als Kinderspielzeug werden analysiert, wobei verschiedene Arten von Computerspielen betrachtet werden. Die Untersuchung von Clemens Trudewind und Rita Steckel sowie die Anwendung von Computeranimationen im Militär liefern weitere Einblicke in die Nutzung und Wirkung von Medien im modernen Kontext.
Schlüsselwörter
Sozial-kognitive Lerntheorie, Albert Bandura, Modelllernen, Beobachtungslernen, Medienwirkung, Computerspiele, Aggressivität, Selbststeuerung, Medienwirkungsforschung, Katharsistheorie, Inhibitionsthese, Wirkungslosigkeitsthese, Lernorientierte Theorien.
- Quote paper
- Claudia Hinze (Author), 2003, Die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura. Lernen an Medien, insbesondere an Computerspielen und ihre Wirkung., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17117