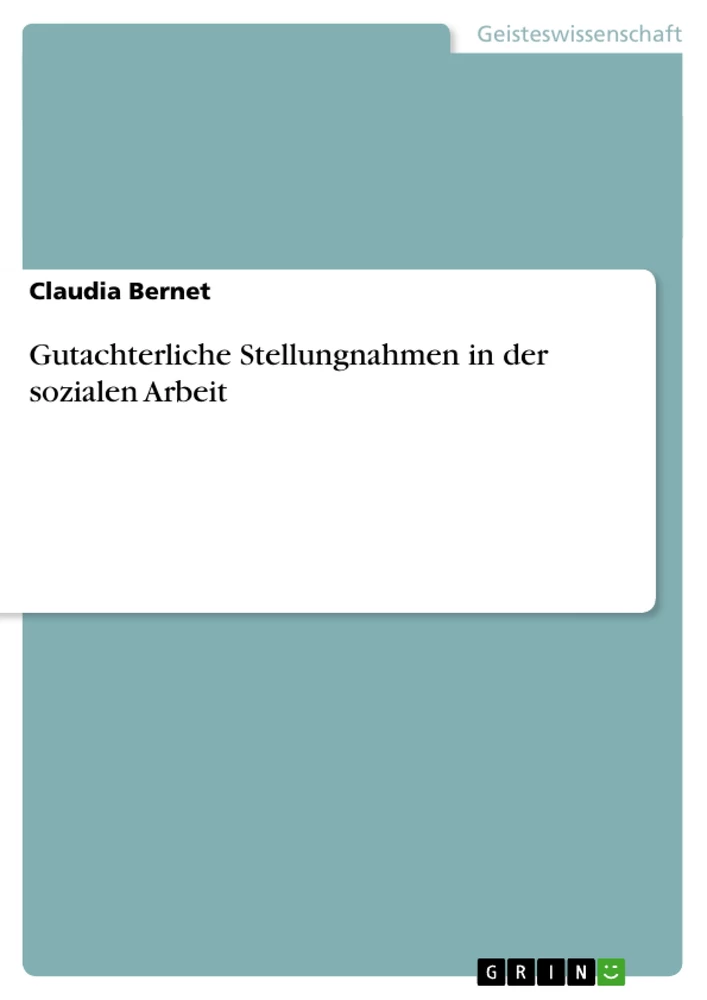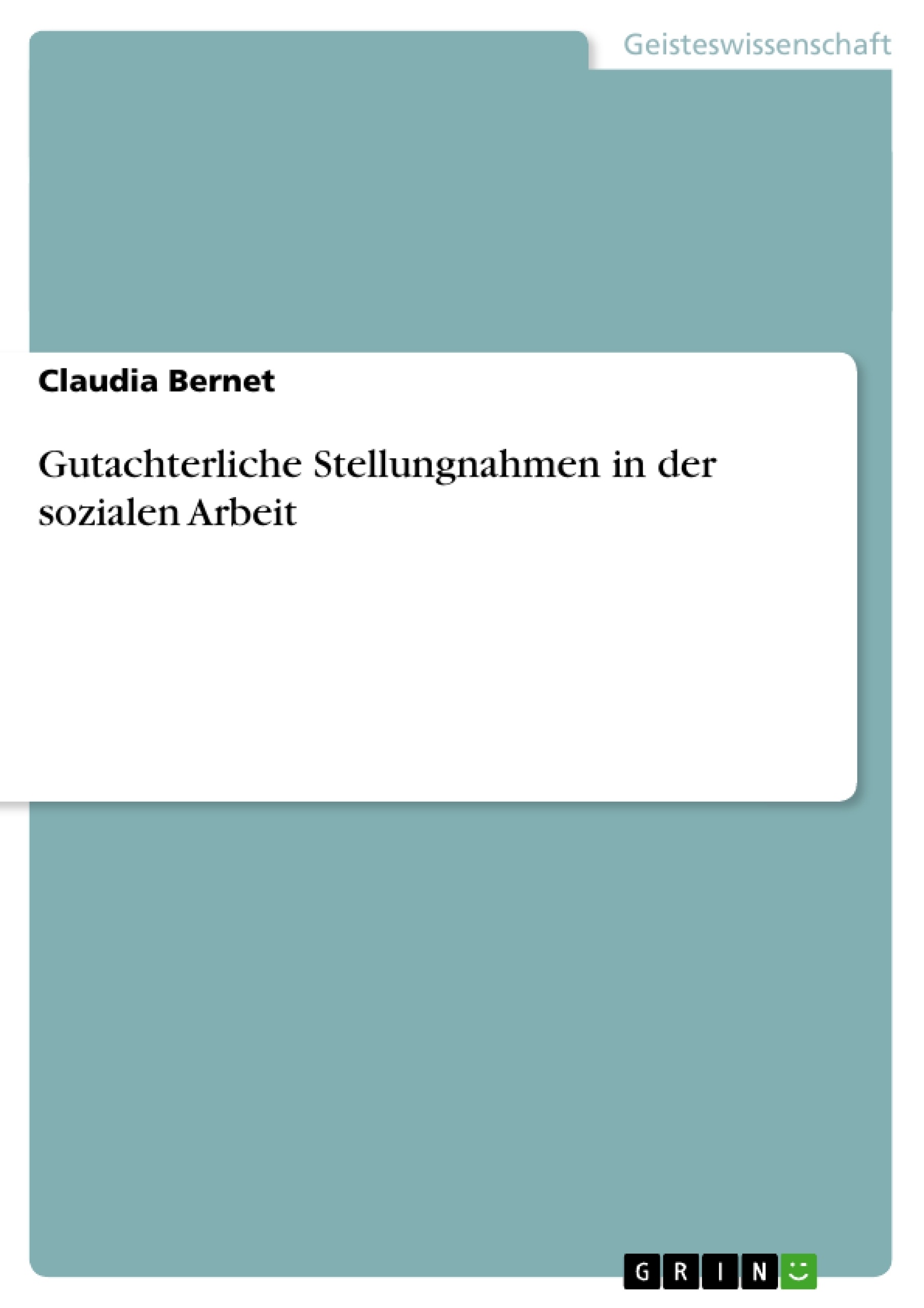Mein pädagogisches Praktikum absolvierte ich in der Caritas, Fachambulanz für Suchtkranke,
in der ich nichts mit Minderjährigen zu tun hatte, so daß auch jeder Kontakt zu Jugendämtern
und deren Gutachten nicht nötig war. Der einzige Kontakt bestand dort zu einer
Sozialpädagogin des Jugendamtes, die von uns Auskünfte über den Verlauf der Therapie einer
Klientin erfragte, den wir ihr aufgrund der Schweigepflicht jedoch nicht geben konnten.
Somit ist das Thema für mich relativ fremd, sieht man vom Besuch der Rechtsvorlesungen
Familienrecht und KJHG ab.
Einzige Ähnlichkeiten fand ich in dem im Suchtbereich angewandten Sozialbericht, dessen
Erstellungskriterien wohl mit dem jugendamtlichen Gutachten vergleichbar sind. Von daher
bestand bei mir das Interesse weniger auf den rechtlichen Grundlagen, die ich nur kurz
darstelle, sondern mehr auf den psychosozialen Komponenten, die auf ein Gutachten
einwirken. Dabei habe ich besonders die Themen Vorurteile und Stereotype, sowie die
Datenerhebung zur Anamnese näher betrachtet.
Ebenso beschäftigte ich mich mit dem Parental Alienation Syndrom, das eine Folge des
jugendamtlichen Gutachtens sein kann, um auch die Konsequenzen dessen zu betrachten.
Ich verwendete hierfür hauptsächlich die Werke von Oberloskamp und Harnach-Beck, sowie
einige Referate aus dem Internet und weiterführende Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die gutachterliche Stellungnahme und ihre rechtliche Grundlage
- III. Schwierigkeiten bei der Erstellung des Gutachtens
- IV. Vorurteile, Stereotype und Einstellungen
- IV.I. Soziale Systeme
- V. Die Bedeutung von Vorurteilen und Stereotype
- V.I. Ursachen der Stereotype- und Vorurteilsbildung
- VI. Die Theorie der „Autoritären Persönlichkeit“ von Adorno
- VII. Die „Frustrations-Aggressions-Hypothese" und die Theorie des „Sündenbocks"
- VII.I. Einstellungen und Vorurteile
- VIII. Der Richter
- IX. Erstellung eines Gutachtens
- X. Konsequenzen des Gutachtens für das Kinderwohl und ethische Bedenken
- XI. Die Datenerhebung
- XI.I. Fragen im Interview und in der Exploration
- XI.II. Die Beobachtung und Körpersprache
- XI.III. Der Scenotest
- XI.IV. Der Hausbesuch
- XII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit gutachtlichen Stellungnahmen in der sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext des Jugendamtes. Die Zielsetzung ist es, die rechtlichen Grundlagen, die Herausforderungen bei der Erstellung solcher Gutachten und die psychosozialen Komponenten, die einen Einfluss darauf haben, zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Datenerhebung und der Rolle von Vorurteilen und Stereotypen.
- Rechtliche Grundlagen gutachtlicher Stellungnahmen im Jugendamt
- Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Erstellung von Gutachten
- Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen auf die Gutachtenerstellung
- Methoden der Datenerhebung in der Anamnese
- Konsequenzen von Gutachten für das Kindeswohl
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Autorin beschreibt ihren mangelnden direkten Kontakt mit Jugendamtsgutachten während ihres Praktikums in einer Suchtfachambulanz. Sie betont ihr Interesse an den psychosozialen Aspekten der Gutachtenerstellung, insbesondere an Vorurteilen, Stereotypen und der Datenerhebung, sowie an den Konsequenzen der Gutachten, z.B. dem Parental Alienation Syndrom. Ihre Arbeit basiert auf den Werken von Oberloskamp und Harnach-Beck sowie weiteren Quellen.
II. Die gutachterliche Stellungnahme und ihre rechtliche Grundlage: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Gutachten" und seine historische Entwicklung. Es erläutert die rechtliche Verantwortung sozialpädagogischer Fachkräfte im Kontext des staatlichen Wächteramtes (§ 2 GG Art. 6 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 1 SGBVIII Abs. 3 Nr. 3) und die Bedeutung professioneller Gutachtenerstellung. Der Fokus liegt auf Gutachten zur Sorgerechtsbestimmung im Zusammenhang mit § 17 KJHG und der "doppelten Kindeswohlprüfung" nach Harnach-Beck. Das Kapitel diskutiert die verschiedenen Verfahren der Informationsweitergabe an das Familiengericht und die Bedeutung von informeller Selbstbestimmung der Eltern. Es betont die Rolle des Jugendamtes als unabhängige, sachverständige Behörde und die Bedeutung von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz des Sozialpädagogen.
III. Schwierigkeiten bei der Erstellung des Gutachtens: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen bei der Erstellung gutachtlicher Stellungnahmen. Es thematisiert den Konflikt zwischen der eigentlichen Zielsetzung – dem Wohl des Klienten – und ökonomischen, administrativen und politischen Anforderungen. Die Grenzen der Kompetenz von Sozialpädagogen und die Notwendigkeit, gegebenenfalls Sachverständige hinzuzuziehen, werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Gutachtliche Stellungnahme, Jugendamt, Kindeswohl, Sorgerecht, rechtliche Grundlage, Vorurteile, Stereotype, Datenerhebung, Anamnese, psychosoziale Diagnostik, Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, § 17 KJHG, § 1 SGB VIII, § 1671 BGB, Parental Alienation Syndrom.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gutachtliche Stellungnahmen im Jugendamt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht gutachtliche Stellungnahmen im Jugendamt, insbesondere die rechtlichen Grundlagen, Herausforderungen bei der Erstellung und die psychosozialen Einflussfaktoren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Datenerhebung und der Rolle von Vorurteilen und Stereotypen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. die rechtlichen Grundlagen gutachtlicher Stellungnahmen, Schwierigkeiten bei der Erstellung, den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen, Methoden der Datenerhebung (Interviews, Beobachtung, Scenotest, Hausbesuche), Konsequenzen für das Kindeswohl und ethische Aspekte. Theorien wie die „Autoritären Persönlichkeit“ und die „Frustrations-Aggressions-Hypothese“ werden ebenfalls diskutiert.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die rechtliche Verantwortung sozialpädagogischer Fachkräfte im Kontext des staatlichen Wächteramtes (§ 2 GG Art. 6 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 1 SGBVIII Abs. 3 Nr. 3), die Bedeutung professioneller Gutachtenerstellung im Zusammenhang mit § 17 KJHG und der „doppelten Kindeswohlprüfung“ nach Harnach-Beck. § 1671 BGB wird ebenfalls erwähnt.
Welche Schwierigkeiten bei der Gutachtenerstellung werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert den Konflikt zwischen dem Wohl des Klienten und ökonomischen, administrativen und politischen Anforderungen. Die Grenzen der Kompetenz von Sozialpädagogen und die Notwendigkeit, gegebenenfalls Sachverständige hinzuzuziehen, werden diskutiert.
Welche Rolle spielen Vorurteile und Stereotype?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Vorurteilen und Stereotypen auf die Gutachtenerstellung und beleuchtet die Ursachen ihrer Entstehung. Die „Autoritären Persönlichkeit“ von Adorno und die „Frustrations-Aggressions-Hypothese“ werden in diesem Zusammenhang betrachtet.
Welche Methoden der Datenerhebung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Datenerhebung, darunter Interviews, Exploration, Beobachtung (einschließlich Körpersprache), Scenotest und Hausbesuche.
Welche Konsequenzen für das Kindeswohl werden behandelt?
Die Arbeit diskutiert die Konsequenzen von Gutachten für das Kindeswohl und ethische Bedenken, z.B. im Zusammenhang mit dem Parental Alienation Syndrom.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gutachtliche Stellungnahme, Jugendamt, Kindeswohl, Sorgerecht, rechtliche Grundlage, Vorurteile, Stereotype, Datenerhebung, Anamnese, psychosoziale Diagnostik, Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, § 17 KJHG, § 1 SGB VIII, § 1671 BGB, Parental Alienation Syndrom.
Auf welchen theoretischen Ansätzen basiert die Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die Werke von Oberloskamp und Harnach-Beck sowie weitere Quellen und bezieht Theorien wie die „Autoritären Persönlichkeit“ von Adorno und die „Frustrations-Aggressions-Hypothese“ mit ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Resümee. Zwischendrin werden die rechtlichen Grundlagen, die Schwierigkeiten der Gutachtenerstellung, der Einfluss von Vorurteilen, die Methoden der Datenerhebung und die Konsequenzen für das Kindeswohl detailliert behandelt.
- Quote paper
- Claudia Bernet (Author), 2002, Gutachterliche Stellungnahmen in der sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17080