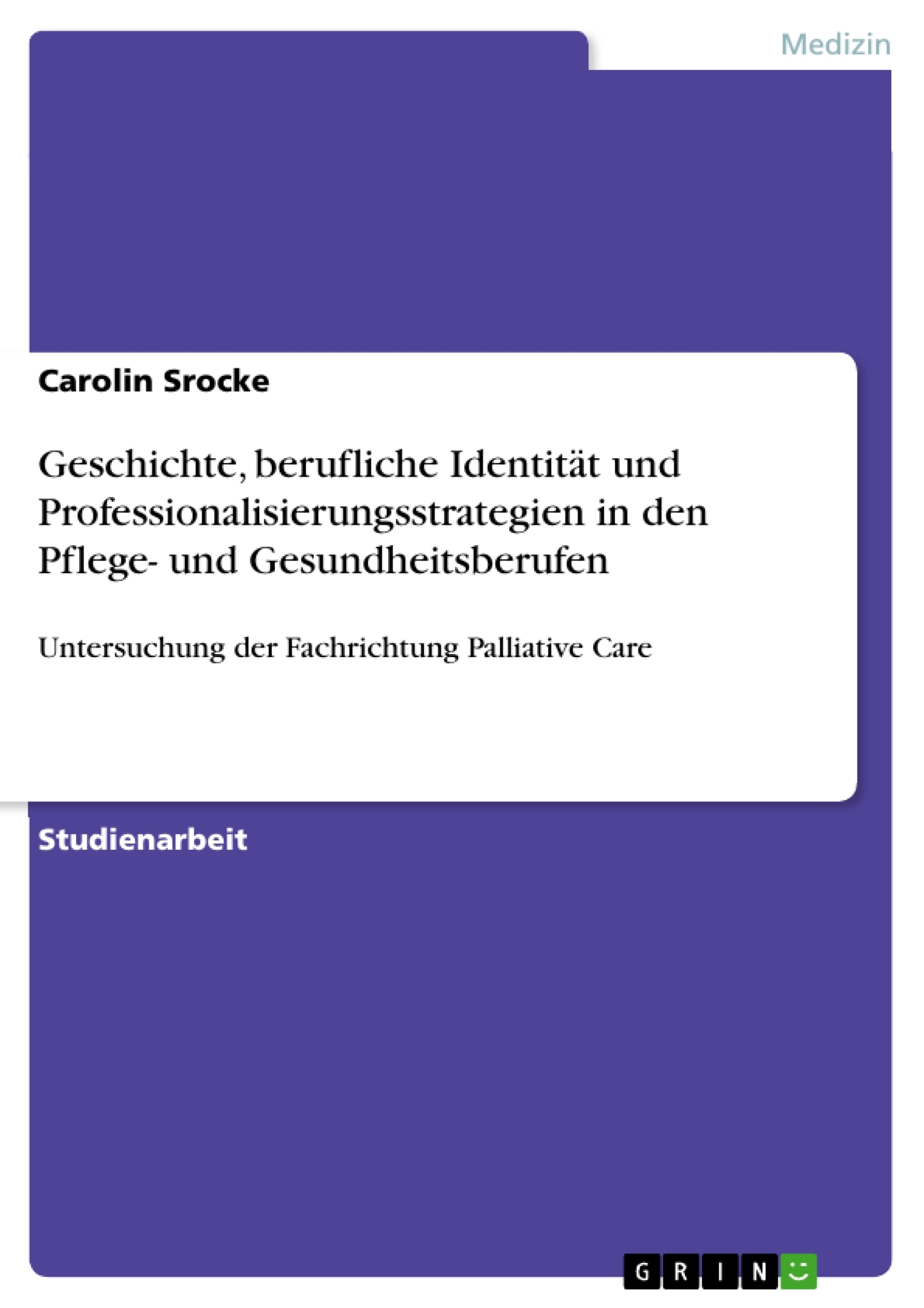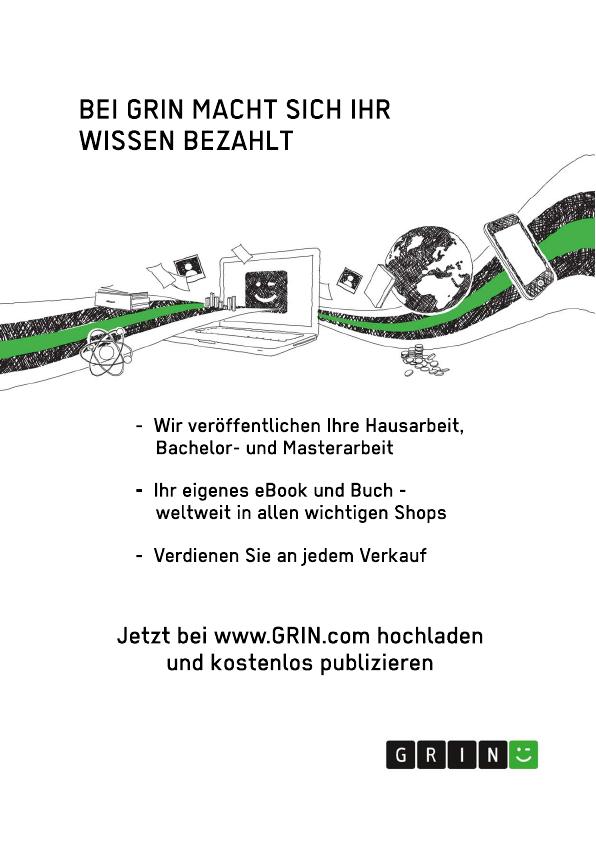Professionelles Handeln im facettenreichen Pflegeberuf ist heute mehr denn je Voraussetzung für eine adäquate qualitativ hochwertige Versorgung von Klientinnen in allen Sektoren des Gesundheitswesens. Um den Pflegeempfängerinnen ihrer jeweiligen Situation entsprechend geplante, zielgerichtete pflegerische Maßnahmen zukommen lassen zu können, ist in den letzten Jahren eine deutlich steigende Entstehungsanzahl von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu verzeichnen. Die Spezialisierung durch Fort- und Weiterbildung soll Pflegende zu Expertinnen in einem Themenbereich bzw. einem Fachgebiet werden lassen, um im speziellen pflegerischen Kontext auf das Auftreten von Pflegephänomenen reagieren zu können und professionell zu handeln. In Deutschland gibt es aktuell eine Vielzahl spezialisierter Berufsbilder für Angehörige der Pfle-geberufe: Pflegeexpertin für integrative Rehabilitation, Fachkraft für Palliative Care, Breast Care Nurse, Pflegeexpertin Herzinsuffizienz, Stroke Unit/ Stroke Nurse und Study Nurse sind nur einige der Bildungsangebote (Kempa 2010, S. 53).
Dieses Portfolio soll (nicht zuletzt aus persönlichem Interesse) eine Standortbestimmung der Palliative Care als Spezialgebiet der Pflege auf dem (eventuellen) Weg zur Entstehung einer Profession darstellen. Es wird aufgezeigt, dass die Spezialisierung in einem Aufgabengebiet der Pflege durchaus Teilbereiche der Professionalisierung erkennen lässt. Als Belegstück zum Nachweis der fachlichen Kompetenz wurde deshalb ein Lehrtext zur historischen Entwicklung der Palliativ- und Hospizentwicklung in Deutschland gewählt, um einen Einblick in den geschichtlichen Entstehungsprozess eines speziellen Berufsfeldes der Pflege zu bekommen, der sich durch bürgerliches Engagement sowie zunehmendes Fachwissen und dementsprechende Vermehrung der Kernkompetenzen der Pflege darstellt. Belegstücke zur methodischen und personalen Kompetenz stellen erstens die Diskussion einer Äußerung in der 2010 erschienenen „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ und die Möglichkeiten zur Realisierung der darin formulierten Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung dar. Zweitens soll daraufhin ein Unterrichtsentwurf für die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zum Thema „Palliative Care“ schon in der Ausbildungszeit die Relevanz der Forderungen der Charta verdeutlichen und Möglichkeiten zur Vermittlung der entsprechenden Handlungskompetenzen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Fachliche Kompetenz
2.1 Kommentierung zur fachlichen Kompetenz
2.2 Belegstück der fachlichen Kompetenz
3 Personale und methodische Kompetenz
3.1 Kommentierung zur personalen und methodischen Kompetenz
3.2 Belegstück der personalen Kompetenz
3.3 Belegstück der methodischen Kompetenz
4 Nachwort
5 Literaturverzeichnis
6 Anhang
1 Einleitung
Professionelles Handeln im facettenreichen Pflegeberuf ist heute mehr denn je Voraus- setzung für eine adäquate qualitativ hochwertige Versorgung von Klientinnen in allen Sektoren des Gesundheitswesens. Um den Pflegeempfängerinnen ihrer jeweiligen Situ- ation entsprechend geplante, zielgerichtete pflegerische Maßnahmen zukommen lassen zu können, ist in den letzten Jahren eine deutlich steigende Entstehungsanzahl von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu verzeichnen. Die Spezialisierung durch Fort- und Weiterbildung soll Pflegende zu Expertinnen in einem Themenbereich bzw. einem Fachgebiet werden lassen, um im speziellen pflegerischen Kontext auf das Auftreten von Pflegephänomenen reagieren zu können und professionell zu handeln. In Deutsch- land gibt es aktuell eine Vielzahl spezialisierter Berufsbilder für Angehörige der Pfle- geberufe: Pflegeexpertin für integrative Rehabilitation, Fachkraft für Palliative Care, Breast Care Nurse, Pflegeexpertin Herzinsuffizienz, Stroke Unit/ Stroke Nurse und Study Nurse sind nur einige der Bildungsangebote (Kempa 2010, S. 53).
Dieses Portfolio soll (nicht zuletzt aus persönlichem Interesse) eine Standortbestim- mung der Palliative Care als Spezialgebiet der Pflege auf dem (eventuellen) Weg zur Entstehung einer Profession darstellen. Es wird aufgezeigt, dass die Spezialisierung in einem Aufgabengebiet der Pflege durchaus Teilbereiche der Professionalisierung er- kennen lässt. Als Belegstück zum Nachweis der fachlichen Kompetenz wurde deshalb ein Lehrtext zur historischen Entwicklung der Palliativ- und Hospizentwicklung in Deutschland gewählt, um einen Einblick in den geschichtlichen Entstehungsprozess ei- nes speziellen Berufsfeldes der Pflege zu bekommen, der sich durch bürgerliches En- gagement sowie zunehmendes Fachwissen und dementsprechende Vermehrung der Kernkompetenzen der Pflege darstellt. Belegstücke zur methodischen und personalen Kompetenz stellen erstens die Diskussion einer Äußerung in der 2010 erschienenen „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ und die Möglichkeiten zur Realisierung der darin formulierten Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung dar. Zweitens soll daraufhin ein Unterrichtsentwurf für die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zum Thema „Palliative Care“ schon in der Ausbildungszeit die Relevanz der Forderungen der Charta verdeutlichen und Möglichkeiten zur Vermittlung der entsprechenden Handlungskompetenzen auf- zeigen.
2 Fachliche Kompetenz
2.1 Kommentierung zur fachlichen Kompetenz
Jeder Beruf unterliegt fortlaufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen, gege- ben durch Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen, Zunahme der berufsspezifi- schen Wissensbasis oder aufgrund gesellschaftlicher Forderungen. Solche Entwick- lungsprozesse hat auch der traditionelle Pflegeberuf zu verzeichnen: Der Wandel von der gottgegeben Mütterlichkeit und Fürsorge der Schwestern über Pflegerinnen als treue Dienerinnen der Ärzte bis hin zum modernen Berufsbild, basierend auf bundes- weit einheitlichen Gesetzmäßigkeiten (Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Gesetze über die Berufe in der Krankenpflege) und dem Anspruch der gesundheitsfördernden, Leid lindernden und krankheitsverhindernden Pflege mit ganzheitlicher Betreuung und Versorgung des Klientel, machen die nicht enden wollenden und erforderlichen Verän- derungen deutlich.
Das Herausbilden von Spezialgebieten, innerhalb derer Expertinnen mit besonderen pflegerischen Kernkompetenzen ausgestattet sind, gehört ebenfalls zu diesen Entwick- lungsprozessen. So hat sich bspw. die Palliative Care als mittlerweile eigenständiges und anerkanntes Fachgebiet der Pflege herausgebildet und sich der Idee angenommen, schwerstkranken Menschen am Lebensende besondere Aufmerksamkeit und bedarfsge- rechte Pflege zukommen zu lassen. Diese Entwicklung fand über einen Zeitraum von mehr als vier Jahrhunderten statt: Anfangs parallel zu den Veränderungen der Pflege- berufe und später, durch die Entstehung eigener Gesetze und Rahmenbedingungen, was die Versorgung der schwerstkranken Menschen in speziell zu diesem Zweck entstan- denen Institutionen und Einrichtungen angeht, auch fachgebietspezifisch und teilweise losgelöst vom Versorgungsauftrag der allgemeinen Pflege. Ein Lehrtext zur Entwick- lung der Palliative Care in Deutschland soll die Entstehungs- und Veränderungsprozes- se dieses Spezialgebietes der Pflege im historischen Kontext darstellen.
2.2 Belegstück zur fachlichen Kompetenz
Schon seit jeher befasst sich die Menschheit mit dem Tod und einem etwaigen Leben nach dem Tod: Im alten Ägypten wurden herrschende Pharaonen einbalsamiert, Opfer- gaben wurden als Proviant für die Reise in das Jenseits in der letzten Ruhestätte depo- niert. Im christlichen Glauben stellt der Tod bis heute den Eintritt des Menschen in das Jenseits, das Leben nach dem Tod, dar. Im Mittelalter galt der Schlaf als kleiner Bruder des Todes, die Pest wurde bezeichnet als „der schwarze Tod“. Es herrschte große Angst vor Krankheiten und Epidemien, da die medizinische Behandlung nur selten er- folgreich war.
Sterben fand bis in das 18. Jahrhundert hinein stets in der Gemeinschaft statt, die Menschen entwickelten Strategien und Rituale, die im Todesfall anzuwenden waren: Sterbende wurden nicht isoliert, es wurden Totenmessen und gemeinsame Gebete durchgeführt (Nagele & Feichtner 2005, S. 13).
Eine Wende im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer trat im 19. Jahrhundert ein. Man empfand den Tod und den Anblick, die Lautäußerungen und die Gerüche der Sterben- den zunehmend als unerträglich. Selbst dem Sterbenden wurde der bevorstehende Tod nicht selten verheimlicht (ebd., S. 13). Die rasante Entwicklung der Medizin im 20. Jahrhundert ließ Gesundheit „machbar“ erscheinen, der Tod wurde zunehmend verbor- gen und trat in den Hintergrund. Durch die therapeutischen Möglichkeiten der moder- nen Medizin galt der Tod nun als Versagen, Fehler oder Panne in Gesundheitsinstituti- onen (vgl. Student & Napiwotzky 2007, S. 5). Sterben, Tod und Trauer als Teile des Lebenszyklus der Menschen wurden somit verbannt, es entstand eine gewisse Angst vor dem Tod, mit der die Menschen in früheren Epochen teils besser umzugehen ver- mochten. Erst kurz nach dem zweiten Weltkrieg rückten die Themen Tod und Sterben wieder in den Vordergrund, man war unzufrieden mit dem Umgang mit Sterbenden (Heimerl 2008, S. 19). Erste Stimmen für einen würdevollen Umgang mit sterbenden und schwerstkranken Menschen wurden laut und es entstand eine Art Gegenbewegung gegen die „Verwilderung des Todes“ (Student & Napiwotzky 2007, S. 6). Frühe Pha- sen der Hospize (vom lateinischen Begriff „hospitium“, Gastfreundschaft) bekamen Bedeutung durch die Aufnahme von Pilgern (Pleschberger 2006, S. 25). Schwester Ma- ry Aikenhead gründete bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Hospiz in Dublin für alle Menschen, die Pilger und hilfsbedürftig waren. Aufgenommene Gläu- bige wurden dort als Gäste versorgt und gepflegt, um die lange Pilgerreise gestärkt fortführen zu können (Student & Napiwotzky 2007, S. 6).
Die Hospizidee sowie die moderne Hospiz- und Palliative Care Entwicklung gehen be- sonders auf das Lebenswerk zweier engagierter Frauen zurück: Die Britin Cicely Saunders (Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin) begann sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa aufgrund negativer Erfahrungen in der Begleitung un- heilbar Kranker für einen würdevollen Umgang mit schwerstkranken Menschen einzu- setzen. Ihr Ziel war es, den Betroffenen und ihren Angehörigen wieder Raum für das Abschied nehmen, Sterben und Trauern zu geben. In den 1940er Jahren hinterließ ein an Krebs verstorbener Freund C. Saunders 500 Pfund Sterling mit den Worten: „Ich werde ein Fenster in deinem Heim sein“, dieses Fenster existiert noch heute in dem 1967 von ihr gegründeten St. Christopher`s Hospice in London (Kränzle 2006, S. 3). Vor der Gründung des Hospizes sammelte sie unermüdlich Erfahrungen, was Wün- sche, Versorgung und Begleitung unheilbar kranker Menschen angeht. Mit ihrem mul- tiprofessionellen Hintergrund relativierte Saunders jeglichen Monopolanspruch einer Disziplin: Sowohl die Architektur als auch die Teamzusammensetzung und Versor- gungsphilosophie im St. Christopher`s ließ die Entstehung einer neuen Art medizi- nisch- pflegerischer Institution erkennen. Als weiterer Verdienst ihrer Arbeit ist die Auseinandersetzung mit der meist größten Belastung sterbender Menschen anzusehen: Schmerzen. Sie entwickelte in multiprofessioneller Zusammenarbeit erste Konzepte zum Schmerz- und Symptommanagement am Lebensende und nahm den Gästen ihrer Einrichtung durch eine adäquate Morphintherapie nicht nur den Schmerz, sondern auch die Angst vor dem Schmerz, indem sie die Zeitabstände zwischen den Morphingaben drastisch reduzierte (Pleschberger 2006, S. 26).
Die zweite Pionierin in diesem Gebiet ist die Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler- Ross, die internationale Aufmerksamkeit auf die Sorgen und Ängste von sterbenden Menschen zog, als sie 1969 ihr Buch „On Death and Dying“ („Interviews mit Sterben- den“) veröffentlichte. Bekannt wurde Kübler- Ross vor allem durch die Beschreibung und öffentliche Darstellung von gemeinsamen Erfahrungen, Bedürfnissen und Ängsten Sterbender und daraus systematisierten Phasen, die jeder Mensch während des Sterbe- prozesses bis zu seinem Tod durchläuft. Auch wenn Phasenmodelle heute allgemein als überholt gelten, wurde durch ihre Arbeit der gesamte Themenbereich um Tod und Sterben in der westlichen Welt thematisiert und ein Versuch unternommen, ihn zu ent- tabuisieren (Heimerl 2008, S. 20).
Der Einzug der Hospizentwicklung gelang in Deutschland erst zum Anfang der 1980er Jahre. Jedoch wurde schon 1971 im Zweiten Deutschen Fernsehen die Hospizarbeit und -entwicklung erstmals öffentlich in den Medien präsentiert: Der Münchner Rein- hold Iblacker hatte im Londoner St. Christopher`s Hospice den Film „Noch 16 Tage“ gedreht. Sechzehn Tage betraf damals die durchschnittliche Verweildauer der Gäste im St. Christopher`s. Der Film zeigte das Leben der Sterbenden und ihrer Angehörigen im Hospizalltag, d.h. es gab wider Erwarten keine bekannten sterilen Krankenhauszimmer, sondern wohnlich eingerichtete Zimmer ohne Überwachungsgeräte und Sterilität, au- ßerdem wurden Ehrenamtliche und Pflegende in Pflegesituationen gezeigt, die sich Zeit nahmen für die Bedürfnisse der sterbenden Menschen und oft auch im Gespräch zu beobachten waren. Leider wurde mit der Veröffentlichung seiner Dokumentation der unsachgemäße Begriff „Sterbeklinik“ nach Deutschland transportiert, der hierzu- lande vielerlei negative Kritik auslöste (Lamp 2001, S. 14). Vor dem Hintergrund der Euthanasieverbrechen nationalsozialistischer Anhänger des Hitler- Regimes traf das Annehmen und die Umsetzung der Hospizidee in beinahe allen Gesellschaftskreisen Deutschlands auf Ablehnung. Besonders die Kirchengemeinden benötigten lange Zeit, um akzeptieren zu können, dass die Hospiz- und Palliativbewegung in keinerlei Hin- sicht mit der Ghettoisierung oder Abschiebung schwerstkranker Menschen in Spezial- abteilungen von Institutionen gleichzusetzen war, sondern vielmehr dem Ruf nach ei- ner ganzheitlichen medizinischen und therapeutischen Versorgung gerecht werden wollte (Kränzle 2006, S. 3).
Das Wort „Palliativ“ stammt vom lateinischen „pallium“ (Mantel) ab und meint Um- mantelung oder Linderung. Der palliative Ansatz ist die Alternative zum kurativen An- satz, der eine Ursachenbekämpfung und somit eine teilweise oder vollständige Gene- sung anstrebt (Kostrzewa 2008, S. 95). Der palliative Ansatz dagegen widmet sich der Behandlung der Symptome und deren Linderung, es geht nicht um maximale Lebens- verlängerung sondern um den Erhalt möglichst hoher Lebensqualität am Lebensende. Begrifflichkeiten wie Hospice Care, Palliative Care und Hospizbewegung werden in der Literatur meist synonym verwendet, trotzdem betonen Anhänger der Hospizbewe- gung stets die multiprofessionelle Ganzheitlichkeit der Hospize als eine Art Oase des Gesundheitssystems, wobei Palliative Care hingegen eher die medizinisch- pflegeri- sche Versorgung, also hauptsächlich Interventionen zum Zweck der Symptomkontrol- le, darstellt (ebd., S. 96). Die erste Palliativstation in Deutschland wurde schließlich 1983 in den Universitätskliniken zu Köln eröffnet, 1984 folgte die Entstehung des ers- ten ambulanten Hospizdienstes an der Evangelischen Fachhochschule Hannover. Das „Haus Hörn“ öffnete 1986 als erstes stationäres Hospiz in Aachen seine Türen für Menschen am Lebensende (Student & Napiwotzky 2007, S. 11). In den folgenden Jah- ren wurden zahlreiche weitere Institutionen, sowohl Hospize und Palliativstationen für die stationäre Versorgung, als auch Tageshospize und ambulante Hospiz- und Pallia- tivdienste in Deutschland gegründet, die alle gemeinsam die folgenden Grundpfeiler der Hospiz- und Palliativarbeit vertreten: Ganzheitliche Sichtweise des Sterbenden verbunden mit einem interdisziplinären Versorgungs- und Betreuungsverständnis, der Sterbende und seine Angehörigen werden als eine Einheit gesehen, palliatives Betreu- ungs- und Pflegeverständnis, Hospize als Bindeglied zwischen einzelnen Versorgungs- strukturen im Gesundheitssystem und Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer (Kostrzewa 2008, S. 96- 98).
1990 und 2002 erstellte die WHO im Zuge der rasanten Entwicklung der neuen Spezi- algebiete Palliative Care und Palliativmedizin Definitionen für ein ganzheitliches Be- treuungskonzept zur Begleitung von Sterbenden: Demnach ist Palliative Care „die wirksame, ganzheitliche „care“ von Patienten, deren Krankheit nicht mehr kurativ be- handelbar ist. Dabei stehen die erfolgreiche Behandlung der Schmerzen und weiterer Symptome sowie die Hilfe bei psychologischen, sozialen und seelsorgerischen Proble- men an erster Stelle. Das Ziel von Palliative Care ist, die bestmöglichste Lebensqualität für Patienten und deren Familien zu erreichen“ (Kränzle 2006, S. 3). Palliativmedizin ist laut WHO „der Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen oder Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, Einschätzen und Behandeln von Schmerzen sowie anderen be- lastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“ (Clemens & Klaschik, zit. n. Kostrzewa 2008, S. 95-96 ).
1992 entstand in Halle/ Saale der Deutsche Hospiz- und Palliativ Verband e.V. (DHPV), der in den Folgejahren v.a. durch die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Hos- pizarbeit in Zusammenarbeit mit den Bundesministerien erste Verbindungen zu Kran- kenkassen und Abgeordneten aufnahm (DHPV o.J.). Viele Anregungen und Forderun- gen zur bundeseinheitlichen Regelung der Finanzierung von Einrichtungen und Ange- boten rund um die Versorgung Sterbender durch den DHPV führten letztendlich zur Entstehung der bereits bis heute mehrmals überarbeiteten, aktuell geltenden Rahmen- vereinbarungen, die im § 39a SGB V: „Stationäre und ambulante Hospizleistungen“ (aktuell geltende Version vom 14.04.2010) verankert sind. Durch die HPCV- Studie (Hospizliche Begleitung und Palliative Care- Versorgung in Deutschland 2008) wurde durch die Deutsche Hospizstiftung eine Erhebung der Anzahl von ambulanten und stationären Hospiz- und Palliativ Care Einrichtungen vorgenommen. Demnach existierten 2008 in Deutschland 1.084 ambulante, ehrenamtliche Hospizdienste, 163 stationäre Hospize und 158 Palliativstationen.
Trotz dieser wachsenden Anzahl von ambulanten und stationären Einrichtungen zur Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland konnte festge- stellt werden, dass in 2008 noch 87, 5 % der Verstorbenen in Deutschland völlig ohne hospizliche Begleitung oder Palliative Care- Versorgung ihr Lebensende fanden (Deut- sche Hospizstiftung 2009, S. 3). Das heisst, der Bedarf an professioneller Begleitung Sterbender in Deutschland übersteigt das Angebot an hilfeleistenden Institutionen und Angeboten bei Weitem. Um diesen Bedarf decken zu können, gilt es jedoch nicht nur, weitere Institutionen zu eröffnen, sondern auch qualifiziertes Personal auszubilden, das dieser professionellen Begleitung gerecht werden kann. Schließlich muss gerade in die- sem Spezialgebiet der Pflege auf höchste Qualität, gegeben durch Fort- und Weiterbil- dung, statt auf Quantität, durch schnelle Entstehung neuer Versorgungsstrukturen, ge- achtet werden, um das hochsensible pflegerische Klientel bedarfsgerecht entsprechend neuester pflegerischer Erkenntnisse begleiten zu können. Dementsprechend hat auch die Zahl der Anbieter für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen dieses Gebietes einen Zuwachs zu verzeichnen: 2010 konnten durch den Deutschen Hospiz- und Palliativver- band 155 Fort- und Weiterbildungsanbieter in Deutschland verzeichnet werden (Deut- scher Hospiz- und Palliativ Verband 2010; S. 1). Um die palliative Versorgung in Deutschland zu verbessern, wurde 2010 schließlich die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und Sterbender Menschen in Deutschland“ veröffentlicht, in der neben Anregungen zur Forschung auf diesem Gebiet auch Anforderungen an die Fort- und Weiterbildung der palliativen Pflege formuliert wurden (Deutsche Gesellschaft für Pal- liativmedizin e.V., Deutscher Hospiz- und Palliativverband e.V., Bundesärztekammer, 2010).
3 Personale und methodische Kompetenz
3.1 Kommentierung zur personalen und methodischen Kompetenz
In der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch- land“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., dem Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V. und der Bundesärztekammer, werden auf der Grundlage der Ausgangssituation von Menschen, die durch eine fortschreitende, unheilbare Erkrankung mit Sterben und Tod unmittelbar konfrontiert sind, in fünf Leit- sätzen Aufgaben, Ziele und Handlungsbedarfe der Palliativversorgung in Deutschland formuliert (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V., Bundesärztekammer 2010, S. 4). Die Charta soll dazu beitragen, die Betreuung und Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen, orientiert an internationalen Erfahrungen, zu verbessern.
Der dritte Leitsatz thematisiert Anforderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung und weist in diesem Zusammenhang auf das Recht eines jeden Menschen hin, eine qua- lifizierte und bei Bedarf multiprofessionelle Behandlung und Begleitung am Lebensen- de zu erhalten. Im Belegstück zur personalen Kompetenz soll eine Forderung des drit- ten Leitsatzes aufgegriffen und in Bezug auf Spezialisierung und Professionalisierung der Palliative Care diskutiert werden. Daraufhin sollen mögliche Chancen und Risiken der Forderung aufgezeigt und mögliche Reaktionen und erforderliche Handlungskom- petenzen skizziert werden. Zum Nachweis der methodischen Kompetenz soll ein Un- terrichtsentwurf zur Vermittlung der in der Charta geforderten Handlungskompetenzen für die dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege Möglichkeiten zur Thematisierung der Palliative Care- Entwicklung und Verbesserung der Versor- gung betroffener Menschen verdeutlichen.
3.2 Belegstück der personalen Kompetenz
Im dritten Leitsatz der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ (s. Anhang 1, S. 32 ff.) wird für den Bereich der Ausbildung für die Professionen im Gesundheitswesen folgende Forderung aufgestellt: „Von Vertretern der Gesundheitsberufe wird erwartet, dass sie schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige ihrer Profession entsprechend qualifiziert unterstützen können“ (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V., Bundesärztekammer 2010, S. 15). Es finden sich in der Charta jedoch zum Begriff „Profession“ und dessen Bedeutung keine näheren Erläuterungen. Neben „Profession“ werden in der Charta, in Bezug auf an Palliativversorgung Beteiligte, Begriffe wie „Berufsprofile“, „Arbeitsbereiche“ und „Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsberufe“ verwendet. Dementsprechend steht eine Einordnung der Palliative Care in den Professionalisierungs- bzw. Professionsbegriff aus.
Es ist davon auszugehen, das mit „Professionen“ sowohl die Medizin als auch die Pflegeberufe, insbesondere die Palliative Care, gemeint und angesprochen werden, da in der Charta alle an die Professionen gestellten Forderungen gleichermaßen die Gesundheitsberufe, Hauptamtliche und Ehrenamtliche ansprechen (s. Anhang 1, S. 32 ff.).
Meines Erachtens ist allerdings die Verwendung des Begriffs „Profession“ im Zusammenhang mit geschulten ehrenamtlich Tätigen, die keine Berufsausbildung oder kein Studium im Gesundheitswesen absolviert haben, nicht angemessen, da diese zwar i.d.R. zur Teilnahme an Schulungen zur Befähigung von allgemeinen Palliative Care- Kompetenzen verpflichtet sind, dadurch jedoch in keiner Weise die durch eine Ausbildung bzw. darauf aufbauende Fort- oder Weiterbildung erlangten Kenntnisse und Fähigkeiten ersetzt werden können. Betrachtet man die Kriterien von Arets et al. (Fleischmann 2009, S 169), die professionelle Pflege von Laienpflege abgrenzen, so erfüllen Ehrenamtliche diese nicht: Sie arbeiten nicht auf der Grundlage einer anerkannten Ausbildung, die Ausübung erfolgt zwar nach theoretischer und praktischer Sachkenntnis, jedoch findet die Verrichtung ohne ein Entgelt statt, was schließlich Hauptmerkmal ehrenamtlicher Tätigkeit ist. Außerdem kommen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der Palliativversorgung weniger für die direkten Pflegeinterventionen, sondern vielmehr für die Begleitung alltäglicher Verrichtungen und als Ansprechpartner für Gespräche und Trauerbegleitung zum Einsatz.
Die Formulierung, Vertreter der Gesundheitsberufe sollen ihrer Profession entsprechend qualifizierend unterstützen können, lässt vermuten, dass jeder Profession entsprechende Qualifikationen zuzuordnen sind. Das heisst, den verschiedenen Gesundheitsberufen werden Verantwortungsbereiche bzw. Tätigkeitsmerkmale zugeschrieben, um als Profession zu gelten, was dem merkmalsorientierten Ansatz zur Beschreibung von Professionen nahe kommt. Dieser Ansatz ist durch die Annahme gekennzeichnet, dass eine Profession erst als solche zu betrachten ist, wenn sie bestimmte Merkmale aufweist und erfüllt. Das Auffinden von bestimmten Merkmalen, die Professionen kennzeichnen, könnte eine Möglichkeit darstellen, Professionen von Nicht- Professionen zu unterscheiden (Veit 2004, S. 25). Jedoch gibt es keine internationalen Festlegungen bzw. übereinstimmende Literatur, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um als Profession zu gelten.
Weidner und Voges stützen sich bei den von ihnen erarbeiteten Merkmalen von Professionen auf die Arbeit von Hesse und haben folgende sieben Kriterien formuliert:
1. „Die Berufstätigkeit begründet sich auf einer längerfristigen Spezialausbildung, die an einer Wissenschaftsdisziplin ausgerichtet ist.
2. In der Praxis sind die Berufsangehörigen an spezifische ethische und rechtliche
Normen gebunden.
3. Es existiert ein Berufsverband mit Möglichkeit der Selbstverwaltung, Disziplinargewalt zur Sicherung fachlicher Standards und Einflussnahme auf die Rekrutierung des Nachwuchses.
4. Die Tätigkeit richtet sich nach dem Wohl der Allgemeinheit und zentralen gesellschaftlichen Werten wie Wahrung von Gesundheit, Gerechtigkeit oder Religiosität und weniger dem privaten Nutzen der Berufsangehörigen. 5. Es besteht ein Expertenstatus für die persönliche und sachliche Entscheidung mit gleichzeitiger Autonomie über die Inhalte und Bedingungen des beruflichen Handelns gegenüber Staat und Markt (Definitions- und Behandlungsmonopol) und eine gesetzlich geregelte Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen (Tätigkeitsvorbehalte).
6. Es existiert eine Leistungsvergütung nach generell- abstrakten Regeln (z.B. Gebühren oder Honorar), wobei der Erfolg nicht an der Einkommenshöhe gemessen wird, sondern eher an Titeln, Orden und Ämtern.
7. Innerhalb des Berufes gibt es Hierarchien mit unterschiedlichen Qualifikationen (zertifizierte Weiterbildung)“ (Fleischmann 2009, S. 169).
[...]
- Quote paper
- Carolin Srocke (Author), 2011, Geschichte, berufliche Identität und Professionalisierungsstrategien in den Pflege- und Gesundheitsberufen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170515