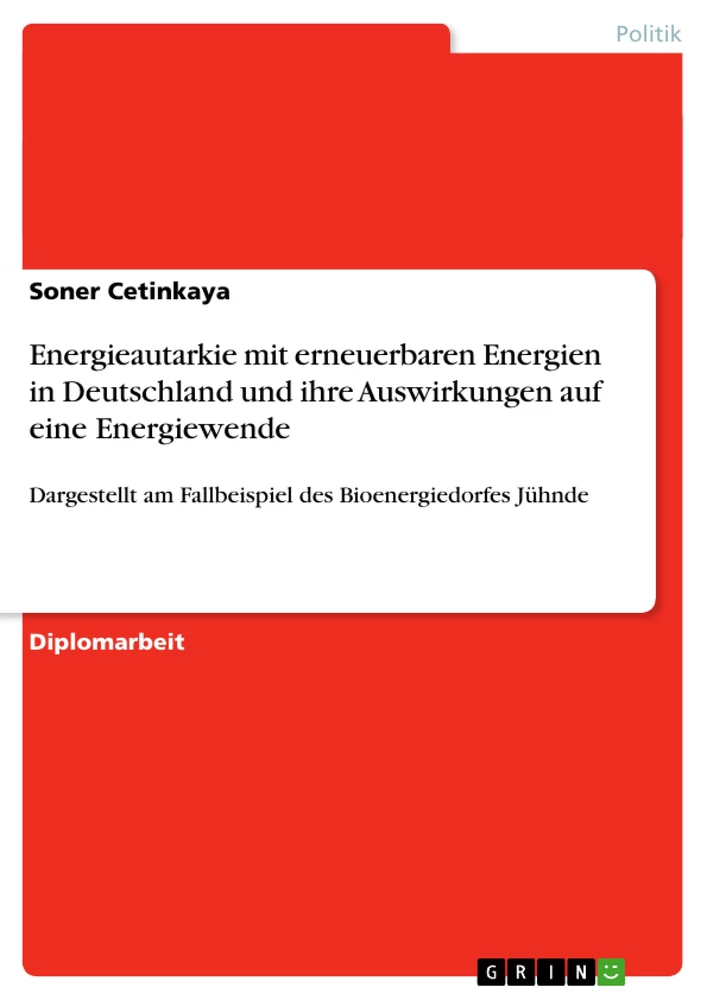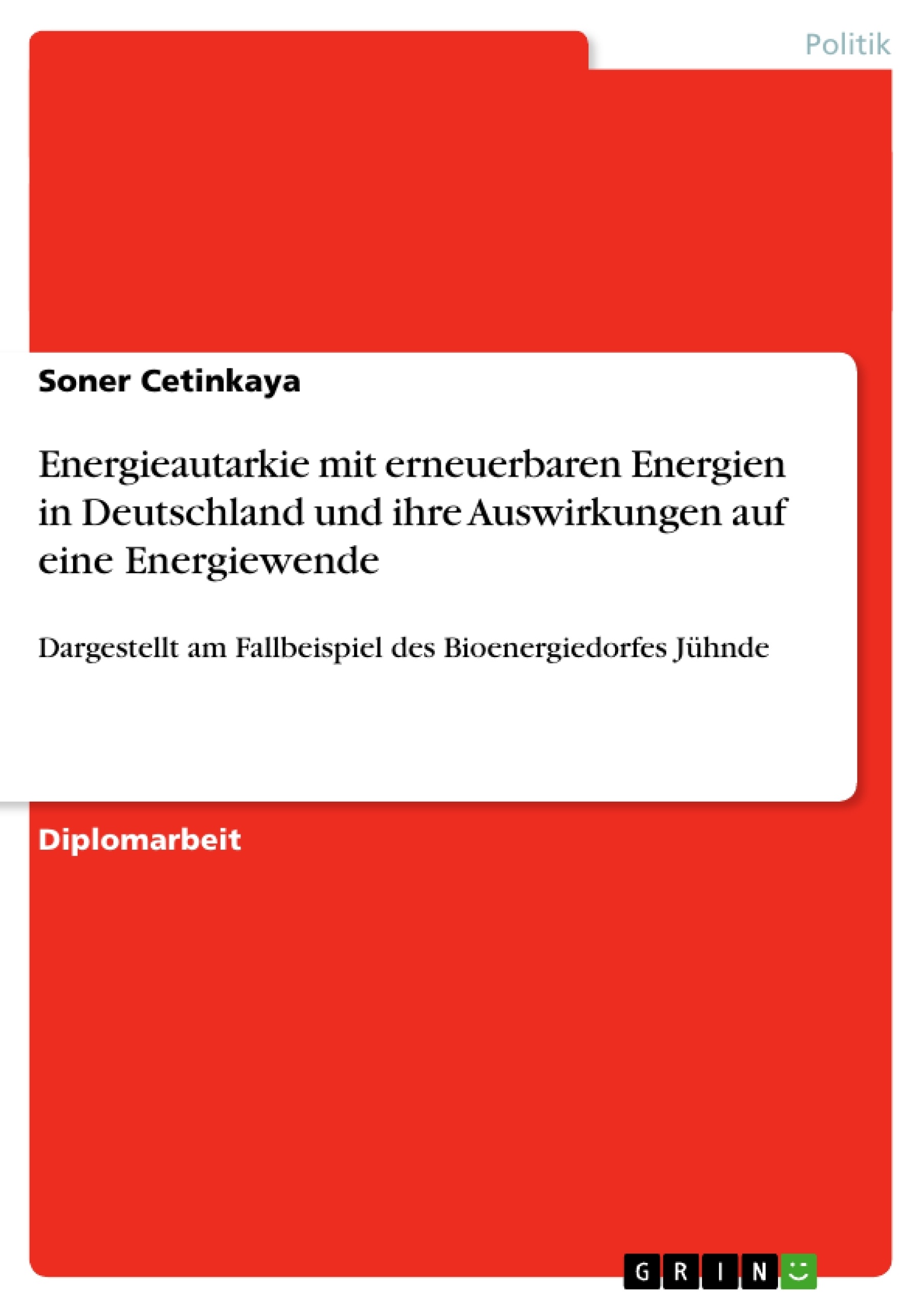Wenn Autarkieprojekte auf Basis erneuerbarer Energieerzeugung Lösungsansätze für die (genannten) Probleme bieten, dann steht die Frage im Raum, warum die Energiewende noch nicht verstärkt über diese Möglichkeiten eingeleitet wurde. Für diese Arbeit habe ich das Autarkieprojekt Bioenergiedorf Jühnde ausgewählt und möchte das übergeordnete Thema in diesem eingegrenzten Bereich bearbeiten. Meine Fragestellung wird dabei sein, welches Potential Dörfer für eine Energiewende haben, wenn sie ihre Energieversorgung auf nachhaltiger Basis selbst in die Hand nehmen. Mit anderen Worten: Welches Potential haben Energieautarkie-Projekte am Fallbeispiel des Bioenergiedorfes Jühnde für eine Energiewende in Deutschland?
Meine Wahl fiel deshalb auf diesen Bereich eines Lösungsansatzes, weil der, dem Begriff der Autarkie inne wohnenden dezentralen Versorgungsstruktur, in der Debatte um eine Energiewende eine wesentliche Rolle zugesprochen wird. Die Erscheinungen, die der Begriff der Autarkie benennt, sind implizit der zentralisierten Struktur abgewandt. Zum einen liegen meiner Meinung nach in diesen Gegenpolen die entscheidenden Ursachen für das Ausbleiben der Energiewende,im Gegensatz z.B. zur rein technologischen Ebene. Zum anderen deutet der Begriff explizit auf einen selbstbestimmten und eigenständigen Weg zur Energiewende hin und bezieht somit pluralisierte und basisorientierte Akteursspektren in seine Strategien ein.
Für die Beantwortung meiner Fragestellung werde ich entsprechend den Schwerpunkt auf den sozialen Umsetzungsprozess des Bioenergiedorfes legen, um den für mich wesentlichen Aspekt der Aktivierung und Gewinnung der Akteure, d.h. der Einwohner Jühnde´s,
dahingehend zu untersuchen, welche Rolle sie für die Umsetzung der Energiewende spielen. Dabei sollen alle maßgeblichen Faktoren für die erfolgreiche Umgestaltung der Energieversorgung deutlich werden.
Nach der Untersuchung von Jühnde erscheinen mir zwei Themenfelder besonders erkenntnisfördernd, hinsichtlich des Energiewendepotentials von Bioenergiedörfern. Erstens: Wie gewinnt man neue Akteure? Mit welcher Methode wurden Jühnder gewonnen? Zweitens: Wie speist man angesichts der fossil-atomaren Übermacht den erneuerbar erzeugten Strom ein?
Hinsichtlich dieser Unterfragen, werde ich die fossil-atomar dominierten zentralen Versorgungsstrukturen heranziehen und zugleich die staatliche Rolle als „Zünglein an der Waage“ darlegen. Die Betrachtung dieses Dreiecks stellt den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Problemstellung
- 3 Erneuerbare Energien
- 3.1 Grundprinzipien der Entwicklung erneuerbarer Energien
- 3.1.1 Erstes Grundprinzip Dezentralisierung
- 3.1.2 Zweites Grundprinzip: Pluralisierte und basisorientierte Verbreiterung des Akteursfeldes
- 3.1.3 Drittes Grundprinzip: Ökologie als Leitnorm
- 3.1 Grundprinzipien der Entwicklung erneuerbarer Energien
- 4 Stromproduktion aus erneuerbaren Energien
- 4.1 Status quo
- 4.2 Staatliche Förderung
- 4.3 Bürger als Stromerzeuger
- 4.4 Landwirtschaftliche Betriebe als Stromerzeuger
- 5 Das Bioenergiedorf-Projekt Jühnde
- 5.1 Biomasse als nachhaltige und dezentrale Energiequelle
- 5.1.1 Definition und Geschichte von Biomasse
- 5.1.2 Biomasse und Klimaschutz
- 5.1.2.1 Energiepflanzenanbau und Ökologie
- 5.1.3 Biomassereserven auf dem Acker, im Wald und in Reststoffen
- 5.2 Voraussetzungen für ein Bioenergiedorf (Dorfeignung)
- 5.3 Technisches Konzept
- 5.4 Zeitlicher Überblick des Umstellungsprozesses
- 5.5 Ökonomische Umsetzung
- 5.6 Beteiligung der Einwohner
- 5.6.1 Organisation des öffentlichen Planungsprozesses
- 5.6.2 Aktionsforschung
- 5.6.3 „Unsicherheitsreduktion“ - Die Rolle des IZNE
- 5.7 Zwischenfazit
- 5.1 Biomasse als nachhaltige und dezentrale Energiequelle
- 6 Erneuerbare Energien und das Stromsystem
- 6.1 Das Problem der Netzeinspeisung der dezentralen Stromerzeugung
- 6.2 Dezentralisierung als energiewirtschaftliches Umbaukonzept
- 7 Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Potential von Energieautarkie-Projekten, insbesondere am Beispiel des Bioenergiedorfes Jühnde, für eine Energiewende in Deutschland. Der Fokus liegt auf der sozialen Umsetzung und der Aktivierung der Einwohner. Die Arbeit analysiert, wie die Energiewende durch dezentrale, nachhaltige Energieversorgung auf Dorfebene vorangetrieben werden kann.
- Dezentrale Energieversorgung durch erneuerbare Energien
- Soziale Umsetzung und Akteursbeteiligung im Kontext der Energiewende
- Das Bioenergiedorf Jühnde als Fallbeispiel
- Die Rolle des Staates bei der Energiewende
- Herausforderungen der Netzeinspeisung von dezentral erzeugtem Strom
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Energiewende und deren Bedeutung für Umwelt und Wirtschaft ein. Sie beschreibt die Problematik der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Notwendigkeit alternativer Energiequellen. Die Arbeit fokussiert auf das Potential von Energieautarkie-Projekten, veranschaulicht am Beispiel des Bioenergiedorfes Jühnde, und stellt die Forschungsfrage nach dem Potential solcher Dörfer für eine deutsche Energiewende. Der gewählte Ansatz betont den sozialen Aspekt der Umsetzung und die Aktivierung der Dorfbewohner.
2 Problemstellung: Dieses Kapitel vertieft den energiepolitischen und umweltpolitischen Problemdruck, der die Notwendigkeit einer Energiewende verdeutlicht. Es beleuchtet die Endlichkeit fossiler Energieträger und die damit verbundenen Umweltprobleme wie Schadstoffemissionen. Die Problemstellung wird als Ausgangspunkt für die Forschungsfrage definiert, warum alternative, nachhaltige Energieerzeugung nicht stärker im Vordergrund steht und warum Projekte wie das Bioenergiedorf Jühnde nicht als Vorbild dienen.
3 Erneuerbare Energien: Dieses Kapitel beschreibt die Grundprinzipien der Entwicklung erneuerbarer Energien, wobei die Dezentralisierung, die pluralisierte und basisorientierte Akteursbeteiligung und die Ökologie als Leitnorm im Vordergrund stehen. Es legt die Grundlage für das Verständnis der im Bioenergiedorf Jühnde verfolgten Strategie und die Herausforderungen bei der Umsetzung.
4 Stromproduktion aus erneuerbaren Energien: Hier wird der Status quo der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien dargestellt, mit einem Fokus auf staatliche Förderungen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Der Bürger und landwirtschaftliche Betriebe als Stromerzeuger werden als wichtige Akteure der Energiewende vorgestellt. Das Kapitel konzentriert sich auf Biogastechnologie, die im Bioenergiedorf Jühnde zum Einsatz kommt.
5 Das Bioenergiedorf-Projekt Jühnde: Dieses umfangreiche Kapitel präsentiert das Bioenergiedorf Jühnde als Fallbeispiel. Es beschreibt die Nutzung von Biomasse als nachhaltige und dezentrale Energiequelle, von der Definition und Geschichte der Biomasse bis hin zum technischen und ökonomischen Konzept des Projekts. Ein Schwerpunkt liegt auf der soziologischen Perspektive der Umsetzung, der Beteiligung der Einwohner und den Herausforderungen des Prozesses. Das Kapitel beleuchtet die Organisation des öffentlichen Planungsprozesses, die Aktionsforschung und die Rolle des IZNE bei der „Unsicherheitsreduktion“.
6 Erneuerbare Energien und das Stromsystem: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Netzeinspeisung von dezentral erzeugtem Strom und der Bedeutung der Dezentralisierung als energiewirtschaftliches Umbaukonzept. Es zeigt die Verflechtung von dezentraler und zentraler Stromversorgung auf und analysiert die Herausforderungen die sich aus dieser Verflechtung ergeben.
Schlüsselwörter
Energiewende, erneuerbare Energien, Biomasse, Bioenergiedorf Jühnde, Dezentralisierung, Energieautarkie, Bürgerbeteiligung, Netzeinspeisung, soziale Umsetzung, staatliche Förderung, Aktionsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Bioenergiedorf Jühnde: Ein Fallbeispiel für die Energiewende"
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht das Potential von Energieautarkie-Projekten, insbesondere am Beispiel des Bioenergiedorfes Jühnde, für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland. Der Fokus liegt dabei stark auf der sozialen Umsetzung und der aktiven Beteiligung der Dorfbewohner.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette von Themen, darunter die Grundprinzipien erneuerbarer Energien (Dezentralisierung, Akteursbeteiligung, Ökologie), die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (Status quo, staatliche Förderung, Bürgerbeteiligung), das Bioenergiedorf Jühnde als Fallbeispiel (technisches Konzept, ökonomische Umsetzung, soziale Beteiligung), die Herausforderungen der Netzeinspeisung dezentral erzeugten Stroms und die Rolle des Staates bei der Energiewende.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Problemstellung, Erneuerbare Energien, Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, Das Bioenergiedorf-Projekt Jühnde (detailliert beschrieben), Erneuerbare Energien und das Stromsystem, und Ausblick/Fazit. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was ist das Bioenergiedorf Jühnde und warum ist es wichtig für das Dokument?
Das Bioenergiedorf Jühnde dient als Fallbeispiel für die Untersuchung der Praxistauglichkeit und der Herausforderungen bei der Umsetzung dezentraler, nachhaltiger Energieversorgung auf Dorfebene. Seine Analyse liefert konkrete Erkenntnisse zur sozialen Umsetzung, Bürgerbeteiligung und den technischen Aspekten solcher Projekte.
Welche Rolle spielt die Bürgerbeteiligung im Dokument?
Die Bürgerbeteiligung ist ein zentraler Aspekt des Dokuments. Es wird untersucht, wie die Einwohner von Jühnde in den Planungsprozess und die Umsetzung des Bioenergiedorf-Projekts eingebunden wurden und welche Rolle sie für den Erfolg des Projekts spielen. Der soziale Aspekt der Energiewende steht im Vordergrund.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Energiewende angesprochen?
Das Dokument adressiert verschiedene Herausforderungen der Energiewende, darunter die Netzeinspeisung dezentral erzeugten Stroms, die ökonomische Umsetzung solcher Projekte, die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Notwendigkeit der staatlichen Förderung. Die Komplexität der sozialen und technischen Aspekte wird hervorgehoben.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Dokument?
Das Dokument zieht Schlussfolgerungen zum Potential von Energieautarkie-Projekten wie Jühnde für eine erfolgreiche Energiewende. Es betont die Bedeutung der sozialen Umsetzung und der aktiven Bürgerbeteiligung als Schlüsselfaktoren für den Erfolg solcher Initiativen und beleuchtet gleichzeitig die Herausforderungen bei der Integration dezentraler Energieerzeugung in das bestehende Stromsystem.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für dieses Dokument?
Schlüsselbegriffe sind: Energiewende, erneuerbare Energien, Biomasse, Bioenergiedorf Jühnde, Dezentralisierung, Energieautarkie, Bürgerbeteiligung, Netzeinspeisung, soziale Umsetzung, staatliche Förderung, Aktionsforschung.
- Quote paper
- Soner Cetinkaya (Author), 2010, Energieautarkie mit erneuerbaren Energien in Deutschland und ihre Auswirkungen auf eine Energiewende , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170487