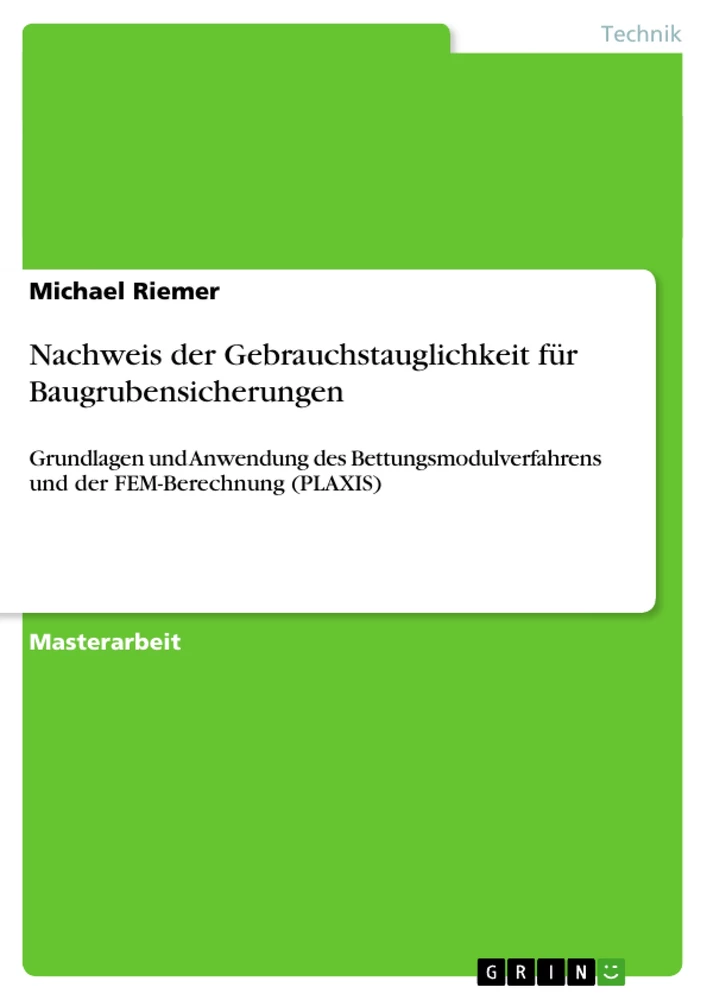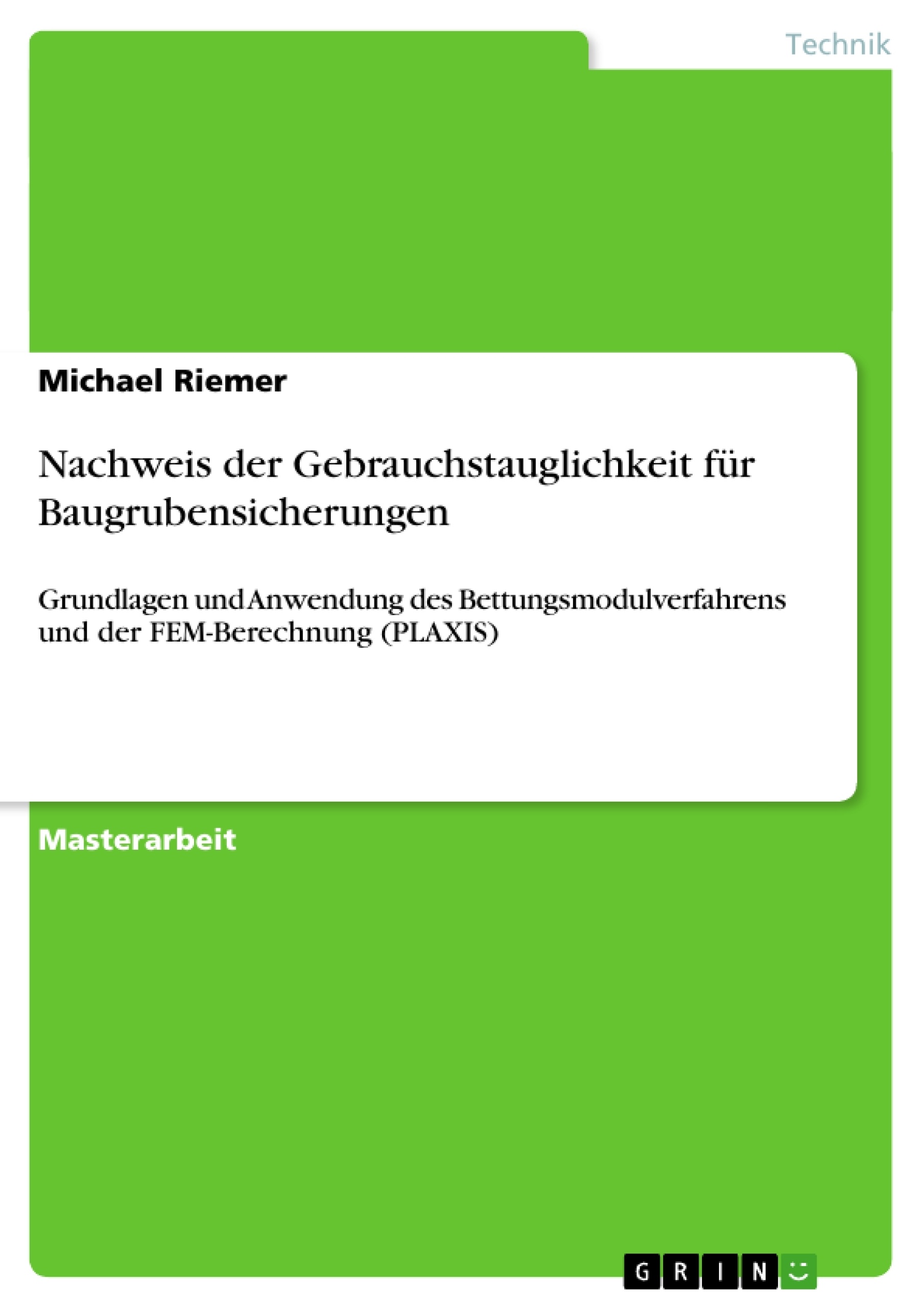Beengte Verhältnisse in Städten, tiefe Nutzung von Grundstücken und immer größere Dimensionierung von Bauwerken machen den Einsatz von Baugrubenverbauten notwendig. Im Hinblick auf die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Baugruben und aller benachbarten Bauwerke während aller Bauzustände haben Verformungsprognosen damit eine große Bedeutung erlangt.
Für Verformungsberechnungen im Sinne des Nachweises der Gebraustauglichkeit stehen dem Geotechnikingenieur Berechnungsansätze der Stabstatik oder Numerische Verfahren zu Verfügung. Die drei gebräuchlichsten Verfahren, das klassische Trägermodell mit unnachgiebiger Stützung, das erweiterte Träger-modell mit gebettetem Wandfuß (Bettungsmodulverfahren) und die Finite-Elemente-Methode (Hardening-Soil Modell) sollen in der vorliegenden Arbeit näher erläutert und miteinander verglichen werden. Dazu werden anhand einer einfach gestützten Baugrubenwand die Berechnungsergebnisse aus ausführlichen Handrechnungen sowie den Grundbauprogrammen GGU-Retain V.5 und PLAXIS V.8 vorgestellt.
The cramped situation in cities, the deep using of sites and growing up of the dimension of buildings are the reasons for necessity of deep excavations. In view for the stability and serviceability of the building pit sheeting and all adjacent constructions the importance of prediction of deformations during all building phases has increased.
The Geotechnical Engineer has the choice between classical procedures or numerical methods to determine deformations for proving the Serviceability Limit State. The three common methods, the classical beam model with rigid supports, the configure beam model with earth support proposing an elastic subgrade reaction and the Finite-Elemente-Methode (using with Hardening Soil Model) should be explained and compared with each other. Therefore the results out of hand-calculations as well as of the Geotechnical design Programs GGU-Retain V.5 and PLAXIS V.8 for a single propped excavation wall are introduced.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Aufgabenstellung zur Masterarbeit
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
- 2.1 Zusammenführung der DIN 1054 und des Eurocodes 7-1
- 2.2 Teilsicherheitskonzept
- 2.2.1 Geotechnische Kategorien
- 2.2.2 Charakteristische Werte und Bemessungswerte
- 2.2.3 Einwirkungen, Beanspruchungen
- 2.2.4 Widerstände
- 2.2.5 Bemessungssituationen
- 2.2.6 Kombinationsregeln in den verschiedenen Bemessungssituationen
- 2.2.6.1 Nachweis der Tragfähigkeit
- 2.2.6.2 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- 2.2.7 Grenzzustände der Tragfähigkeit (ULS)
- 2.2.7.1 Nachweis der Tragfähigkeit
- 2.2.7.2 Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben
- 2.2.8 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS)
- 2.2.8.1 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- 2.2.8.2 Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben
- 2.2.9 Teilsicherheitsbeiwerte
- 3 Berechnungsgrundlagen
- 3.1 Hinweise zur Wahl geeigneter Konstruktionsarten für Baugrubensicherungsmaßnahmen
- 3.1.1 Allgemein
- 3.1.2 Stahlspundwände
- 3.1.3 Massive Baugrubenwände
- 3.1.3.1 Schlitzwände
- 3.1.3.2 Bohrpfahlwände
- 3.1.4 Trägerbohlwände
- 3.1.4.1 Ermittlung von Bewegungen und Verformungen
- 3.1.5 Stützung von Baugruben
- 3.1.5.1 Aussteifung
- 3.1.5.2 Verankerung
- 3.1.5.3 Gurtung
- 3.2 Bodenkenngrößen- Parameter
- 3.2.1 Erläuterung
- 3.2.2 Ermittlung & Festlegung von Bodenparametern
- 3.3 Einwirkungen auf Baugrubenkonstruktionen
- 3.3.1 Lastannahmen
- 3.3.2 Vereinfachte Verteilung des aktiven Erddrucks nach EB 69 & EB 70
- 3.3.3 Erddruck aus Nutzlasten in Form von Ersatzlasten
- 3.3.3.1 Lastfiguren infolge lotrechter Nutzlasten
- 3.3.3.2 Lastfiguren infolge waagerechter Nutzlasten
- 3.3.4 Erdruhedruck
- 3.3.5 Erddrucklast infolge benachbarter Bebauung
- 3.3.6 Erddrucklast aus Rückbauzuständen
- 3.3.7 Wasserdrucklast
- 3.4 Widerstände
- 3.4.1 Ansatz des passiven Erddrucks (Erdwiderstand) - Ebener Fall
- 3.4.2 Ansatz des passiven Erddrucks (Erdwiderstand) - Räumlicher Fall
- 3.5 Baugruben in weichen Böden
- 4 Verformungsberechnung zum Rechnerischen Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- 4.1 Klassisches Trägermodell (TM)
- 4.1.1 Ermittlung von Verschiebungen und Verformungen
- 4.1.2 Anwendung
- 4.1.3 Wandfußverschiebung
- 4.1.3.1 Mobilisierungsansatz von Besler für nichtbindige Böden
- 4.1.3.2 Erweiterung für bindige Böden
- 4.1.3.3 Berücksichtigung einer Vorbelastung bei nichtbindigen Böden
- 4.1.3.4 Berücksichtigung einer Vorbelastung bei bindigen Böden
- 4.2 Bettungsmodulverfahren (BM)
- 4.2.1 Bilineare Bettungsansätze
- 4.2.1.1 Bettungsmodul ks
- 4.2.1.2 Anwendung in der Praxis
- 4.2.2 Nichtlinearer Bettungsansatz nach Besler
- 4.2.2.1 Anwendung in der Praxis
- 4.3 Numerische Verfahren (FEM)
- 4.3.1 Stoffgesetze für Böden
- 4.3.1.1 Linear-elastische Stoffmodelle
- 4.3.1.2 Nichtlinear- elastische Stoffmodelle (mit veränderlichen Elastizitätsmoduln)
- 4.3.1.3 Elastisch- idealplastische Stoffmodelle
- 4.3.1.4 Elastoplastische Stoffmodelle (mit isotroper Verfestigung)
- 4.3.1.5 Hypoplastische Stoffmodelle
- 4.3.2 Hardening-Soil Modell in PLAXIS V.8
- 4.3.3 Anwendung der FEM für Nachweise der Gebrauchstauglichkeit
- 5 Beobachtungsmethode bzw. Messtechnische Bauwerksüberwachung
- 6 Vergleich der Methoden zur Ermittlung der Verformung - Berechnungsbeispiel
- 6.1 Lastgeschichte
- 6.2 Vorbemessung der erforderlichen Einbindetiefe
- 6.2.1 Iterative Lösung
- 6.2.2 Verfahren nach Blum
- 6.3 Verformungen aus dem klassischem Trägermodell
- 6.3.1 Vorgehensweise
- 6.3.2 Berechnungsergebnisse
- 6.3.3 Korrektur der Wandfußverschiebung mit Hilfe der Mobilisierungsfunktion nach Besler
- 6.4 Verformungen aus dem Bettungsmodulverfahren
- 6.4.1 Vorgehensweise
- 6.4.2 Berechnungsergebnisse
- 6.5 Berechnung der Verformungen mit der FEM
- 6.5.1 Vorgehensweise
- 6.5.2 Berechnungsergebnisse
- 6.5.3 Verformungen hinter der Wand
- 6.6 Vergleich der Biegelinien
- 7 Fazit
- Anhang A: Ablaufdiagramme für Nachweisverfahren nach EC 7
- A.1: Berechnungsverfahren 1 für den Nachweis einer bodengestützten Wand nach EC 7 Abs. 2.4.7.3.4.2
- A.2: Berechnungsverfahren 2 für den Nachweis einer bodengestützten Wand nach EC 7 Abs. 2.4.7.3.4.3
- A.3: Berechnungsverfahren 3 für den Nachweis einer bodengestützten Wand nach EC 7 Abs. 2.4.7.3.4.4
- Anhang B: Ermittlung der Einbindetiefe mit dem Verfahren nach Blum
- B.1: Berechnungsalgorithmus für das Verfahren 1 zur Ermittlung der Einbindetiefe t für den Ausnutzungsgrad μ = 1
- B.2: Berechnungsalgorithmus für das Verfahren 2 zur Ermittlung des Ausnutzungsgrades des Erdwiderlagers bei vorgegebener Einbindetiefe t
- Anhang C: Bodenkenngrößen für Vorentwürfe
- C.1: Mittlere Bodenkennwerte für Vorentwürfe von Flächengründungen
- C.2: Mittlere Bodenkennwerte für Vorentwürfe�Rechenwerte (abgeminderte charakteristische Werte)
- Anhang D: Weitere Berechnungsverfahren zur Berücksichtigung der Verformungseinflüsse
- D.1: Berechnungsformeln für horizontale Wandverschiebungen von rückverankerten Baugruben in nichtbindigen Böden
- D.2: Erläuterungen
- Anhang E: Ergebnisausgaben für das Berechnungsbeispiel 1
- Technisches Regelwerk
- Normen
- Veröffentlichungen der Arbeitskreise der DGGT
- Literaturverzeichnis
- Fachzeitschriften
- Monografien/ Abhandlungen
- Fachbeiträge in Schriftreihen und Tagungsbänden
- Fachkapitel in Sammelwerken
- Angekündigte Neuerscheinungen
- Genutzte Grundbausoftware
- Stichwortverzeichnis
- Zusammenführung der DIN 1054 und des Eurocodes 7-1 für Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
- Anwendung des Teilsicherheitskonzepts für Baugrubenkonstruktionen
- Vorstellung verschiedener Konstruktionsarten für Baugrubensicherungen und deren Eigenschaften
- Erläuterung der wichtigsten Bodenkenngrößen und deren Einfluss auf die Verformungen von Baugrubenwänden
- Vergleich von Berechnungsmethoden: Klassisches Trägermodell, Bettungsmodulverfahren und Finite-Elemente-Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für Baugrubensicherungen. Sie untersucht verschiedene Methoden zur Berechnung der Verformungen von Baugrubenwänden und vergleicht deren Ergebnisse. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tiefergehendes Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Baugrubenkonstruktionen, Baugrund und Umgebung zu entwickeln, um in der Praxis geeignete Methoden zur Verformungsprognose zu identifizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken im Allgemeinen und Baugruben im Speziellen. Anschließend werden die Grundlagen des Sicherheitsnachweises im Erd- und Grundbau, insbesondere das Teilsicherheitskonzept und die aktuellen Normenwerke, detailliert erläutert.
Kapitel 3 widmet sich der Beschreibung der gängigen Baugrubensicherungen, den wichtigen Bodenkenngrößen und den Einwirkungen auf Baugrubenkonstruktionen. Der Fokus liegt hierbei auf den für die Verformungsberechnung relevanten Parametern und den Ansätzen zur Ermittlung von Erddruck und Erdwiderstand.
Im Hauptteil der Arbeit (Kapitel 4) werden die drei wichtigsten Methoden zur Berechnung von Verformungen von Baugrubenwänden vorgestellt und analysiert: das klassische Trägermodell, das Bettungsmodulverfahren und die Finite-Elemente-Methode. Die Arbeit verdeutlicht die Vor- und Nachteile jeder Methode und zeigt die Grenzen ihrer Anwendbarkeit auf.
Kapitel 5 befasst sich mit der Beobachtungsmethode und der messtechnischen Bauwerksüberwachung. Es werden die Bedeutung und Anwendung dieser Methoden im Kontext von Baugrubenkonstruktionen erläutert, sowie die Planung und Durchführung von messtechnischen Überwachungsmaßnahmen.
In Kapitel 6 wird anhand eines konkreten Berechnungsbeispiels ein detaillierter Vergleich der drei Methoden durchgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen werden analysiert und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ansätze hingewiesen.
Schlüsselwörter
Baugrubensicherung, Gebrauchstauglichkeit, Verformungsberechnung, Trägermodell, Bettungsmodulverfahren, Finite-Elemente-Methode, Hardening-Soil Modell, Bodenkenngrößen, Erddruck, Erdwiderstand, Teilsicherheitskonzept, Eurocode 7, DIN 1054, Beobachtungsmethode, Messtechnische Bauwerksüberwachung
- Quote paper
- Diplom Ingenieur (FH) Michael Riemer (Author), 2011, Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für Baugrubensicherungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/170213