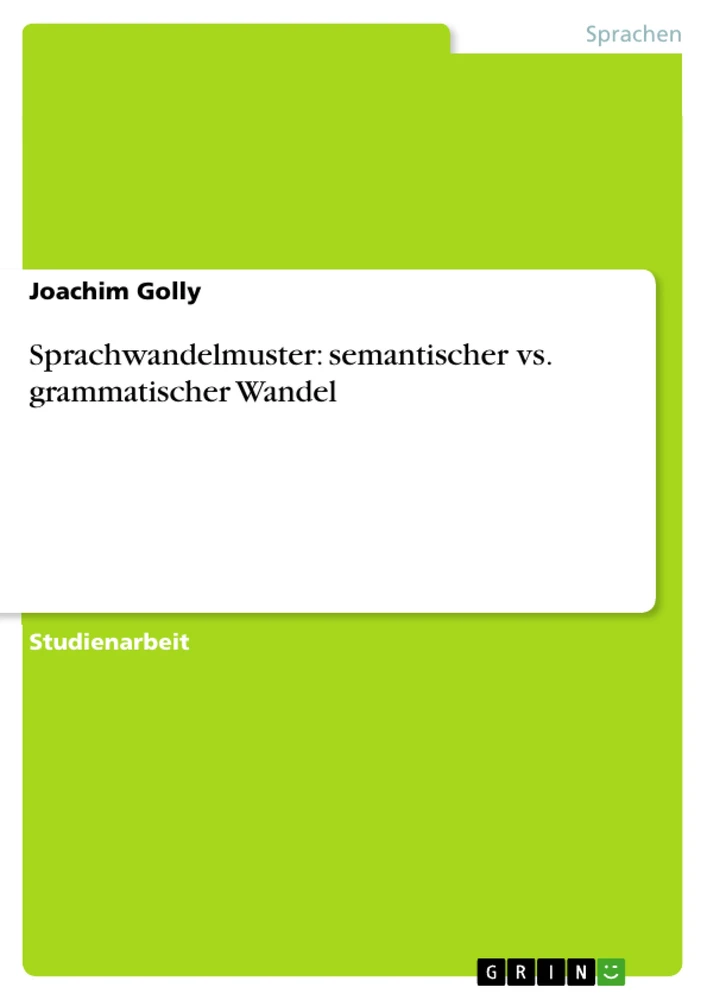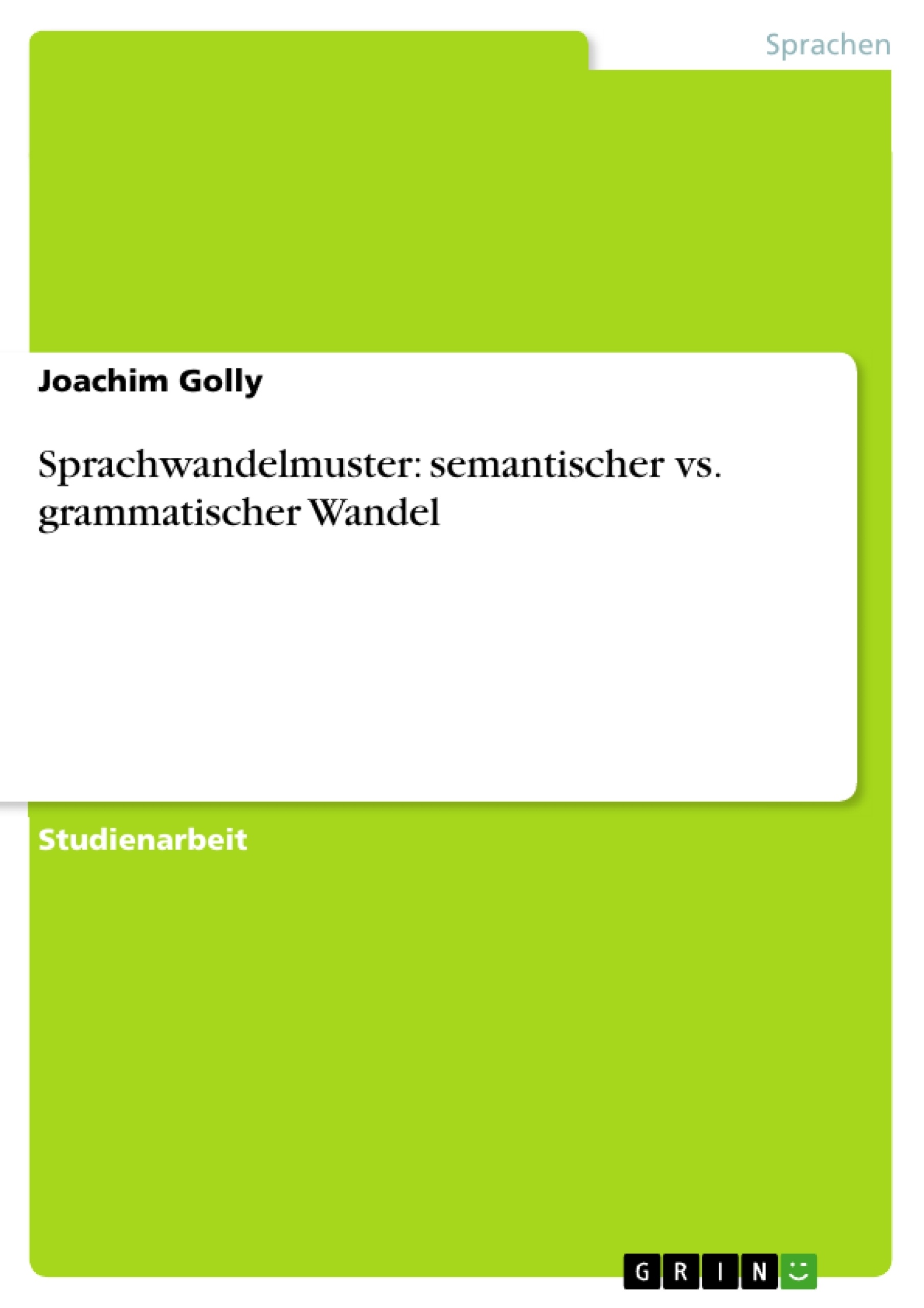Die gesprochene Sprache ist im Vergleich zur geschriebenen Sprache stets im
Wandel und unterzieht sich stets Veränderungen. Der Sprachwandelprozess an und für
sich ist schwierig zeitlich einzugrenzen. Gibt es einen Anfang einer Sprache? Wo liegt er?
Sicherlich hat sich die Sprache parallel zur Evolution den Menschen und ihrer
Umgebung angepasst. Im Laufe der Zeit haben sich immer neue Wörter gebildet, denen
eine bestimmte Bedeutung zuzuordnen ist. Auf der anderen Seite gibt es heute
bestimmte Wörter nicht mehr, die einmal alltäglich waren. Oder es gibt heute Wörter,
die in ihrer Erscheinungsform anders auftreten, als noch in ihrer eigentlichen
Ursprungsform. Signifikat und Signifikant, um hier Saussures exemplarische und
allgemeingültige Darstellung eines Wortes zu erwähnen, wie wir es in seiner Bedeutung
und in seiner Form erkennen, sind ständig im Wandel.
In der vorliegenden Hausarbeit soll an Hand von Beispielen zunächst untersucht
werden, was semantischer und was grammatischer Wandel ist, also die Bedeutung eines
Wortes und auf der anderen Seite die Grammatikalisierung eines Wortes.Die
Ergebnisse werden im Anschluss gegenübergestellt und in ihrer Abhängigkeit zu
einander untersucht. Der Frage, ob es eine gewisse Reihenfolge in der Abfolge des
Wandels gibt, soll ebenso im Verlauf der Arbeit nachgegangen werden.
Die Forschung über Wandelprozesse in der Sprachwissenschaft ist vor allem durch
Eugenio Coserius Untersuchungen geprägt, der in seinen Forschungen der
Sprachwissenschaft ein leitendes Bild ausmacht. Im Juni 2010 veröffentlichte Professor
Christian Lehmann, Professor für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft der
Universität Erfurt, auf seiner Homepage (s.u.) seine Forschungsergebnisse zu den
Bereichen grammatischer und semantischer Wandel. Die Untersuchungen zu
semantischen oder grammatikalischen Sprachwandelprozessen ist jedoch meines
Erachtens vor allem Paul Gévaudan gelungen, der in seinem Buch Typologie des
lexikalischen Wandels. Bedeutungswandel, Wortbildung und Entlehnung am Beispiel der
romanischen Sprachen, das in Deutschland 2007 erschien, an verschiedenen Beispielen
deutlich macht, wie sich Sprachwandel in semantischer und grammatikalischer Hinsicht
vollzieht. Er bezieht sich in seinen Forschungen, wie man es dem Titel leicht entnehmen
kann, ausschließlich auf die romanischen Sprachen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Vom Lateinischen ins Spanische
- 2. Bedeutungswandel
- 3. Wortbildung
- 4. Entlehnung
- III. Semantischer Wandel
- 1. Definition
- 2. Die Ullmannsche Theorie
- 3. Aktuelle Definition nach Lehmann
- 4. Bedeutungsschwund, Bedeutungsinnovation und Polysemie
- 5. Tropen
- a. Metapher
- b. Metonymie
- c. Generalisierung
- d. Spezialisierung
- IV. Grammatischer Wandel
- 1. Aktuelle Definition nach Lehmann
- 2. Beispiele für grammatischen Wandel
- 3. Bedingen sich semantischer und grammatischer Wandel?
- 4. Motiviertheit des Wandels
- V. Schluss Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht semantischen und grammatischen Wandel in der Sprachwissenschaft, basierend auf Beispielen aus der romanischen Sprachfamilie, vor allem Spanisch und Französisch. Die Arbeit widmet sich der Frage, wie diese Wandelprozesse funktionieren, welche Theorien zur Erklärung existieren und ob es eine Abhängigkeit zwischen semantischen und grammatischen Veränderungen gibt.
- Semantischer Wandel: Definition, Theorien von Ullmann und Lehmann, Bedeutungsinnovation, Polysemie, Bedeutungsschwund und Tropen
- Grammatischer Wandel: Definition, Grammatikalisierung, Beispiele für grammatischen Wandel, Abhängigkeit von semantischen Veränderungen
- Motiviertheit des Wandels: Rolle des Sprechers und des Rezipienten, Bedeutung der „ständigen Anstrengung“
- Historische Entwicklungen: Einfluss von Rechtschreibreformen und gesellschaftlichen Veränderungen
- Forschungslandschaft: Überblick über wichtige Beiträge von Wissenschaftlern wie Coseriu, Lehmann, Ullmann und Gévaudan
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor, die Sprachwandelprozesse in semantischer und grammatischer Hinsicht. Sie beleuchtet die Bedeutung von Sprachwandel und die Schwierigkeit, diesen Prozess zeitlich einzugrenzen.
- II. Hauptteil: Vom Lateinischen ins Spanische: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten des lexikalischen Wandels – Bedeutungswandel, Wortbildung und Entlehnung – anhand von Beispielen aus dem Spanischen erläutert. Es wird gezeigt, wie sich Wörter vom Lateinischen ins Spanische entwickelt haben und welche Veränderungen dabei stattgefunden haben.
- III. Semantischer Wandel: Dieses Kapitel behandelt die Definition und die unterschiedlichen Theorien des semantischen Wandels. Es werden die Konzepte von Bedeutungsschwund, Bedeutungsinnovation und Polysemie eingeführt und verschiedene Tropen, wie Metapher und Metonymie, als Ursachen für semantischen Wandel erläutert.
- IV. Grammatischer Wandel: Dieses Kapitel widmet sich dem grammatischen Wandel. Es wird die Definition von grammatischem Wandel sowie das Konzept der Grammatikalisierung vorgestellt. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Sprachen wird der grammatische Wandel erläutert und die Abhängigkeit zu semantischen Veränderungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Sprachwandel, semantischer Wandel, grammatischer Wandel, Bedeutungswandel, Grammatikalisierung, Tropen, Polysemie, Bedeutungsschwund, Bedeutungsinnovation, Morphologie, Semantik, Signifikant, Signifikat, Reanalyse, Sprecher, Rezipient, und Kommunikation.
- Quote paper
- Joachim Golly (Author), 2010, Sprachwandelmuster: semantischer vs. grammatischer Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/169297