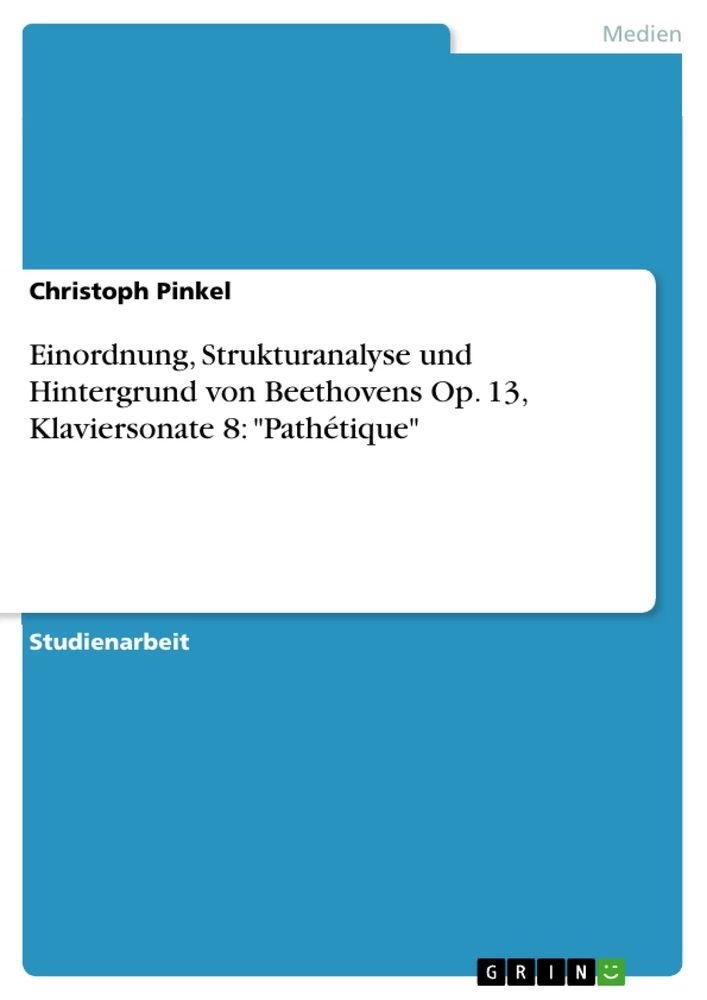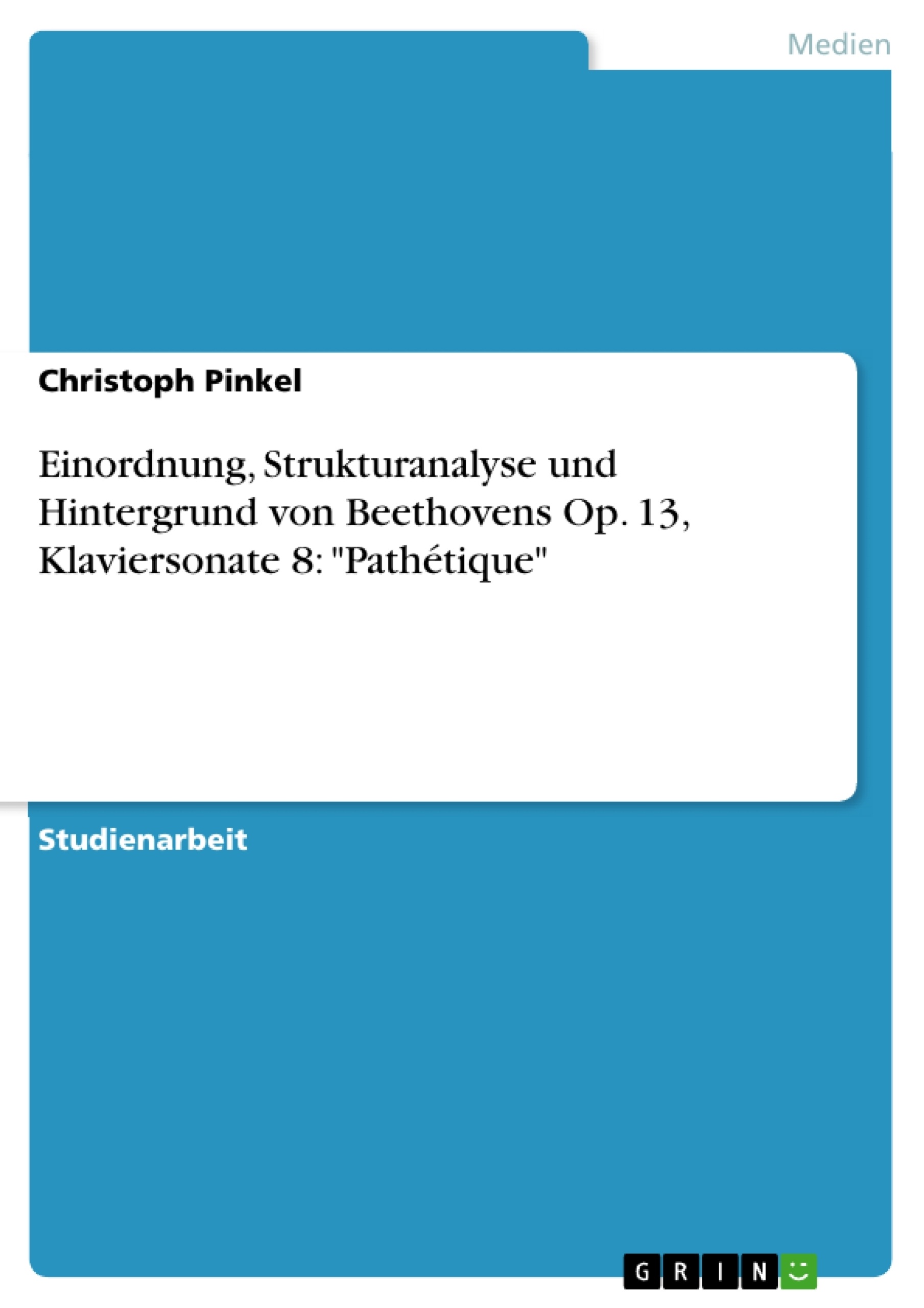Beethovens Klaviersonate Nr. 8, op. 13 in c-Moll ist nach der eigenen Bezeichnung des Komponisten ”Grande Sonate Pathétique” unter dem leicht verkürzten Namen ”Pathétique” bekannt geworden. Bis heute gehört sie zu den bekanntesten Frühwerken des Komponisten und zu seinen populärsten Sonaten. In der Literatur wurden Beethovens Klaviersonaten im Allgemeinen sowie die Pathétique im Speziellen umfangreich untersucht. Unter den zahlreichen Artikeln befinden sich neben Strukturanalysen auch solche, die dezidierte Spezialfragen betrachten, wie etwa jene der besonderen Rolle des Werkstitels.
Die vorliegende Arbeit versteht sich als Überblick aller werksrelevanter Aspekte in angemessener Tiefe. Ziel ist es, einen guten Überblick über die Pathétique als Gesamtes zu geben um hierdurch nicht nur dem Zweck der Arbeit bestmöglich gerecht zu werden, sondern auch Beethovens eigener Forderung, seine Werke stets als Gesamtes zu verstehen. Das Spektrum der vorliegenden Literatur wie auch der historische und biographische Kontext der Entstehung der Pathétique und ihre besondere Rolle innerhalb des frühen Gesamtwerks Beethovens legen dabei eine Herangehensweise nahe, die nicht ausschließlich analytisch auf den Notentext bezogen ist. Statt dessen werden neben einer detaillierten Strukturanalyse aller drei Sätze auch eine historische und biographische Einordnung gegeben sowie insbesondere auch der programmatische Gehalt des Titels und dessen Einfluss auf Rezeption und Interpretation diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Historischer und biographischer Kontext
- 3 Aufbau und Strukturanalyse
- 3.1 Erster Satz Grave und Allegro di molto con brio
- 3.1.1 Grave
- 3.1.2 Exposition
- 3.1.3 Durchführung
- 3.1.4 Reprise
- 3.1.5 Coda
- 3.2 Zweiter Satz - Adagio cantabile
- 3.3 Dritter Satz - Rondo. Allegro
- 3.1 Erster Satz Grave und Allegro di molto con brio
- 4 "La Grande Sonate Pathétique"
- 4.1 Pathos in Rhetorik und Ästhetik
- 4.1.1 Pathos in beethovenschem Verständnis
- 4.2 Rhetorischer Bezug
- 4.2.1 Rhetorik als Programm
- 4.3 Der Pathos in der Pathétique
- 4.1 Pathos in Rhetorik und Ästhetik
- 5 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über Beethovens Klaviersonate Nr. 8, op. 13, "Pathétique", zu geben. Sie soll Beethovens eigene Forderung, seine Werke als Gesamtkunstwerk zu betrachten, gerecht werden. Hierzu werden sowohl technische als auch hermeneutische Analysen durchgeführt, die werksgeschichtliche Einbettung berücksichtigt und extramusikalische Faktoren miteinbezogen.
- Der historische und biographische Kontext der Entstehung der Sonate.
- Die Strukturanalyse der Sonate, gegliedert nach Sätzen.
- Der programmatische Gehalt des Titels "Pathétique" und dessen Einfluss auf Rezeption und Interpretation.
- Die Bedeutung der Sonate innerhalb des frühen Gesamtwerks Beethovens.
- Die Darstellung der sich widerspiegelnden Aspekte von Beethovens Zukunftsaussichten in der Sonate.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beethovenschen Klaviersonate Nr. 8, op. 13, "Pathétique" ein. Sie hebt die Popularität des Werkes hervor und verweist auf die umfangreiche existierende Literatur. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung betont, die über eine rein analytische Herangehensweise hinausgeht und den historischen Kontext sowie den programmatischen Aspekt des Titels berücksichtigt.
2 Historischer und biographischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den Entstehungszeitraum der "Pathétique" zwischen 1798 und 1799, situiert ihn innerhalb Beethovens erster Wiener Periode und verbindet ihn mit den damals herrschenden künstlerischen und persönlichen Umständen. Es werden Beethovens wachsende Anerkennung als Pianist, sein noch nicht gefestigter Ruf als Komponist, seine zunehmende Ertaubung und die ambivalenten Aspekte seines Lebens und seiner Zukunftsaussichten als wichtige Einflussfaktoren hervorgehoben. Der Tod seines Freundes Lorenz von Breuning und der Beginn neuer Freundschaften werden als zusätzliche Kontextfaktoren erwähnt. Die Einordnung der Sonate in die erste Periode Beethovens Schaffens nach Schindler und Schlosser wird diskutiert.
3 Aufbau und Strukturanalyse: Dieses Kapitel bietet eine Strukturanalyse der "Pathétique", aufgeteilt in ihre drei Sätze (Grave und Allegro di molto con brio, Adagio cantabile, Rondo. Allegro). Obwohl detaillierte technische Analysen aus Platzgründen verkürzt dargestellt werden, wird die grundlegende Struktur und der Aufbau jedes Satzes erläutert. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel der verschiedenen Sätze und ihrer Bedeutung für das Gesamtwerk.
4 "La Grande Sonate Pathétique": Dieses Kapitel widmet sich einer tiefergehenden Analyse der "Pathétique" als Ganzes. Es untersucht den programmatischen Gehalt des Titels "Pathétique" und dessen Bedeutung für die Rezeption und Interpretation. Es werden Aspekte der Rhetorik und Ästhetik des Pathos im Werk Beethovens und im Kontext der "Pathétique" speziell beleuchtet, um ein umfassenderes Verständnis des Werkes zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Beethoven, Klaviersonate Nr. 8, op. 13, Pathétique, Strukturanalyse, Historischer Kontext, Biographischer Kontext, Pathos, Rhetorik, frühes Werk, Wiener Periode, Rezeption, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zur Klaviersonate Nr. 8 op. 13 "Pathétique" von Beethoven
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Beethovens Klaviersonate Nr. 8, op. 13, "Pathétique". Sie beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Strukturanalyse der Sonate (aufgeteilt in die drei Sätze), eine Untersuchung des historischen und biographischen Kontextes ihrer Entstehung, eine Analyse des programmatischen Titels "Pathétique" unter Berücksichtigung rhetorischer und ästhetischer Aspekte, sowie eine Schlussbemerkung. Die Arbeit zielt darauf ab, Beethovens Werk als Gesamtkunstwerk zu betrachten und verbindet technische Analysen mit hermeneutischen Interpretationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen und biographischen Kontext der Entstehung der Sonate (1798-1799), die Strukturanalyse der drei Sätze (Grave und Allegro di molto con brio, Adagio cantabile, Rondo. Allegro), den programmatischen Gehalt des Titels "Pathétique" und dessen Einfluss auf Rezeption und Interpretation, die Bedeutung der Sonate im Kontext von Beethovens frühen Werken, sowie die Darstellung der sich in der Sonate widerspiegelnden Aspekte von Beethovens Zukunftsaussichten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Einleitung, 2. Historischer und biographischer Kontext, 3. Aufbau und Strukturanalyse (unterteilt nach den drei Sätzen und deren Unterabschnitten), 4. "La Grande Sonate Pathétique" (Analyse des Titels und des Pathos), 5. Schlussbemerkung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte der "Pathétique" werden analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl die formale Struktur der Sonate (Aufbau, Satzstruktur, Melodik, Harmonik etc.) als auch den programmatischen Gehalt des Titels "Pathétique". Es wird untersucht, wie der Titel die Rezeption und Interpretation beeinflusst und wie sich Aspekte des Pathos in der Musik manifestieren. Der historische und biographische Kontext wird herangezogen, um das Werk besser zu verstehen.
Welchen Zeitraum umfasst der historische Kontext?
Der historische und biographische Kontext konzentriert sich auf den Zeitraum der Entstehung der Sonate zwischen 1798 und 1799, Beethovens erste Wiener Periode. Er berücksichtigt Beethovens wachsende Anerkennung als Pianist, seinen noch nicht gefestigten Ruf als Komponist, seine zunehmende Ertaubung und die ambivalenten Aspekte seines Lebens und seiner Zukunftsaussichten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beethoven, Klaviersonate Nr. 8, op. 13, Pathétique, Strukturanalyse, Historischer Kontext, Biographischer Kontext, Pathos, Rhetorik, frühes Werk, Wiener Periode, Rezeption, Interpretation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über Beethovens Klaviersonate Nr. 8, op. 13, "Pathétique", zu geben und Beethovens eigene Forderung, seine Werke als Gesamtkunstwerk zu betrachten, gerecht zu werden. Sie kombiniert technische und hermeneutische Analysen und berücksichtigt werksgeschichtliche Einbettung sowie extramusikalische Faktoren.
- Quote paper
- Christoph Pinkel (Author), 2009, Einordnung, Strukturanalyse und Hintergrund von Beethovens Op. 13, Klaviersonate 8: "Pathétique", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/169166