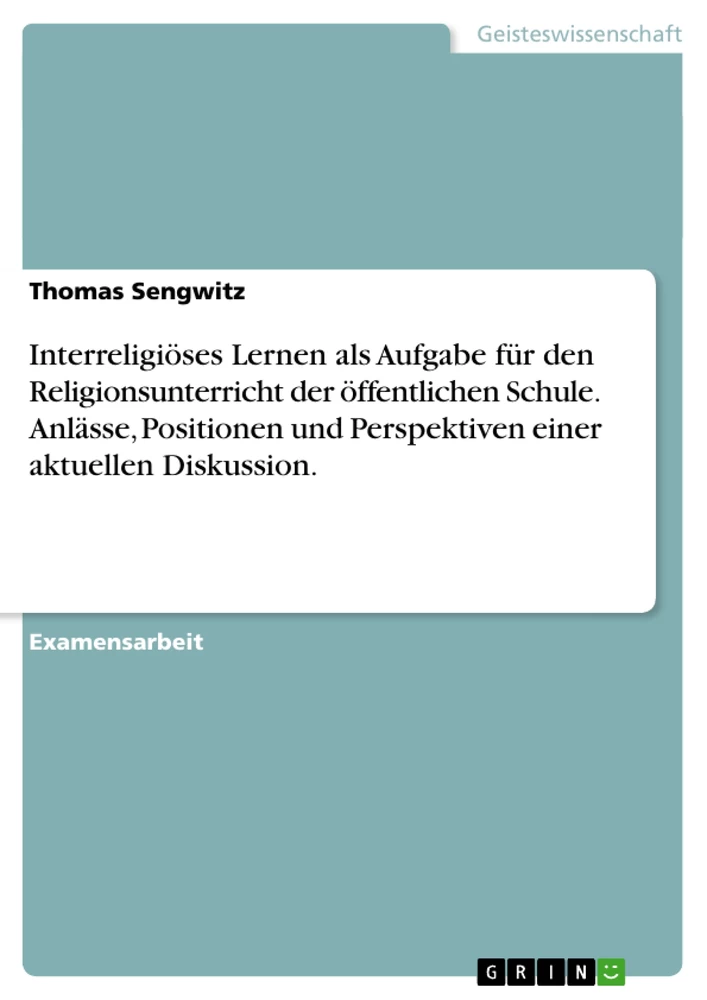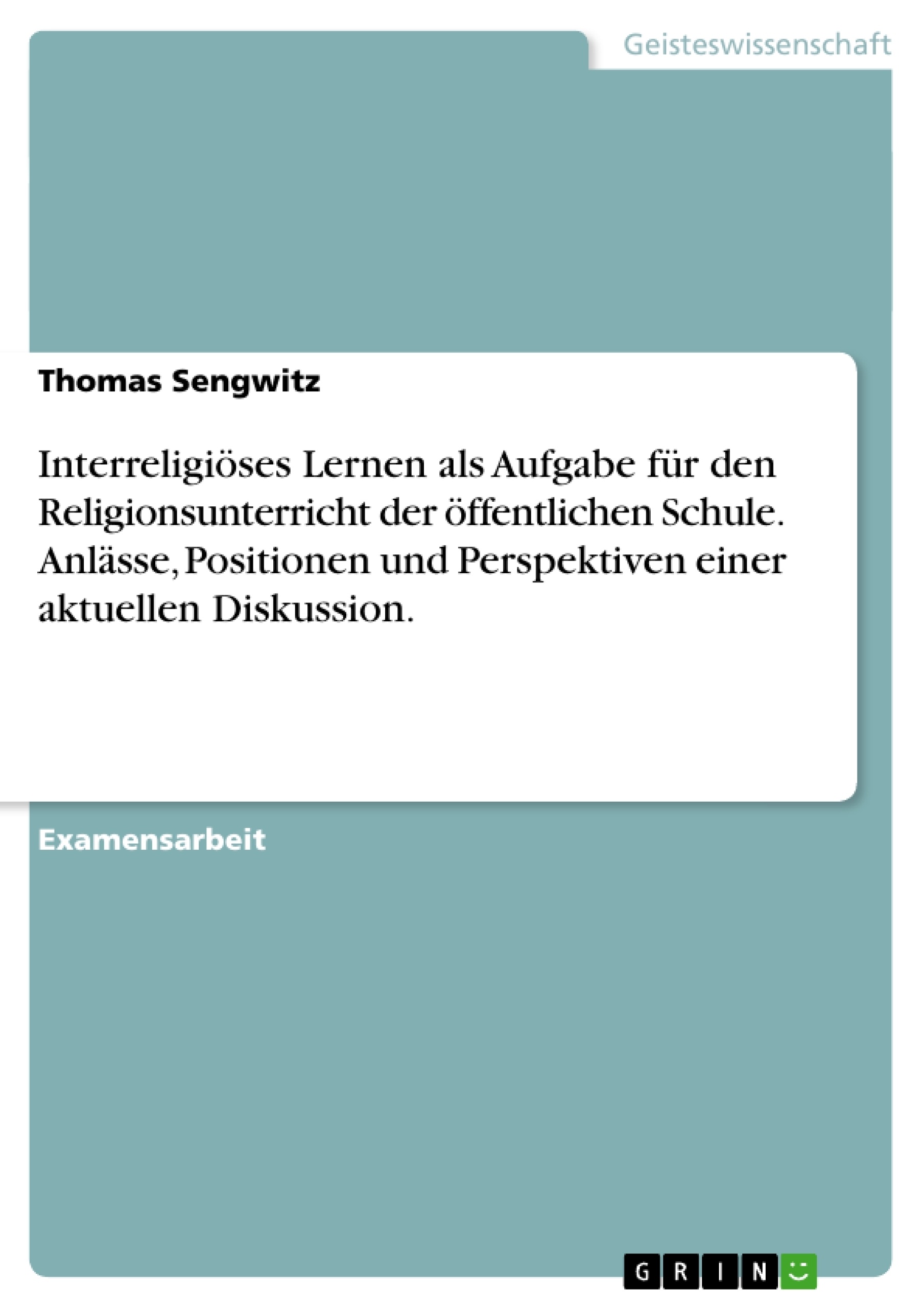[...] Angesichts dieser Brennpunkte befinden sich an der Gesellschaft partizipierende
Menschen in einem Spannungsverhältnis von Positionalität und Vielfalt, in der sie
ihre Identität entfalten. Der Religionsunterricht steht als Teil der
Bildungsinstitution in der Pflicht, sie dabei auf möglichst effektive Weise zu
begleiten, doch er findet sich zwischen den selben Polen wieder und muss eine
Bildung herbeiführen, die beide Momente im Sinne einer pluralitätsfähigen
Ausbildung miteinander vereint. Die Kardinalsfrage lautet, wie beide zueinander
gewichtet werden müssen. Dabei spielen sowohl die Kirchen als auch der Staat
mit seinen Ansprüchen eine tragende Rolle.
Im „Braunschweiger Ratschlag“1, einem der frühesten und damit grundlegendsten
Dokumente im Hinblick auf die aktuelle Diskussion, wird eine
verfassungsrechtliche Anpassung des Religionsunterrichts an die gesellschaftliche
Situation gefordert. Demnach sollte den Autoren zufolge der Religionsunterricht
entweder durch eine Veränderung des Art. 7,3GG ein „Allgemeiner
Religionsunterricht“, durch eine Neuinterpretation in einen Lernbereich
„Religion, Ethik, Philosophie“ integriert, zumindest aber interkonfessionell,
interreligiös und damit auch lebensweltlich geöffnet werden. Stellvertretend für alle in der Arbeit dargestellten Positionen verdeutlicht dieser Beitrag, dass
Religionsunterricht in der Bringschuld steht, sich der Aufgabe interreligiösen
Lernens zu stellen.
Auf dieser Problematik und Herauforderung basierend, verfolgt die vorliegende
Arbeit den Anspruch, die Anlässe für die Diskussion um ein interreligiöses
Lernen im Unterricht detailliert darzustellen. Aus ihnen resultierend, soll
anschließend untersucht werden, welche markanten Positionen der Diskussion
ihre offensichtliche Schärfe verleihen. Dies beinhaltet die Untersuchung der
Argumentationen und die daraus resultierenden Vorstellungen von einem
Religionsunterricht, der interreligiöses Lernen konzeptionell einschließt. Aus den
Ergebnissen soll gefolgert werden, ob und inwiefern sich den vorgebrachten
Argumentationslinien und Positionen eine Perspektive zuordnen lässt. Aus dieser
Wertung soll abschließend ein Fazit hinsichtlich der Thematik im
Religionsunterricht der Zukunft gezogen werden.
1 Hahn/Linke/Noormann: Welchen Religionsunterricht braucht die öffentliche Schule? In: Ru
3/1991, S. 114ff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anlässe der Diskussion
- Der multikulturelle Anlass
- Die religiöse Vielfalt der BRD
- Interreligiöses Lernen als Teil interkultureller Bildung?
- Multikulturelle Bildungspolitik?
- Interreligiöses Lernen im Kontext schulischer Fremdheit
- Religionsunterricht im Umbruch gesellschaftlicher Relevanz
- Der multikulturelle Anlass
- Positionen in der Diskussion
- Das Spannungsfeld interreligiösen Lernens
- Die Hamburger Perspektive
- Zu Gast sein - Interreligiöses Lernen bei Johannes Lähnemann
- Römisch-Katholische Konkretionen
- Die Arbeitstelle für interreligiöses Lernen (AiL)
- Perspektiven
- Zur Identitäts(B)ildung im Religionsunterricht
- Kirchliche Positionen zur interreligiösen Bildung
- Welche Bildung für welche Gesellschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die aktuelle Diskussion um interreligiöses Lernen im Religionsunterricht der öffentlichen Schule. Sie beleuchtet die Anlässe, die diese Debatte auslösen, und stellt verschiedene Positionen zur Gestaltung eines interreligiösen Religionsunterrichts vor. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Chancen zu zeichnen, die sich im Spannungsfeld von Religionsvielfalt, Säkularisierung und Identitätsbildung für die Gestaltung des Religionsunterrichts ergeben.
- Religiöse Vielfalt und Interkulturelle Bildung
- Säkularisierung und Pluralität in der Gesellschaft
- Identitätsbildung im Kontext interreligiösen Lernens
- Konfessioneller und interreligiöser Religionsunterricht
- Rollen von Kirchen und Staat in der Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Anlässe für die Diskussion um interreligiöses Lernen im Religionsunterricht. Es analysiert die wachsende religiöse Vielfalt in der Bundesrepublik, die durch Migration und Säkularisierung geprägt ist. Zudem wird die Bedeutung von interreligiösem Lernen im Kontext der Interkulturellen Pädagogik und der Bildungspolitik beleuchtet.
- Kapitel zwei widmet sich verschiedenen Positionen in der Debatte um interreligiöses Lernen. Es stellt das Konzept des „Religionsunterrichts für alle“ aus Hamburg, Johannes Lähnemanns Ansatz des „Zu Gast Seins“ und die römisch-katholischen Konkretionen zum Thema vor. Zudem werden die Aktivitäten der Arbeitstelle für interreligiöses Lernen (AiL) dargestellt.
- Im dritten Kapitel werden Perspektiven für die Gestaltung eines interreligiösen Religionsunterrichts aufgezeigt. Es geht um die Frage der Identitätsbildung im Religionsunterricht und die Bedeutung von religiöser Bildung. Weiterhin werden die Positionen der Kirchen und die Frage nach der Bildung für eine pluralistische Gesellschaft diskutiert.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, Religionsunterricht, öffentliche Schule, multikulturelle Gesellschaft, Säkularisierung, Pluralität, Identitätsbildung, Interkulturelle Pädagogik, Bildungspolitik, Kirchen, Staat.
- Quote paper
- Thomas Sengwitz (Author), 2003, Interreligiöses Lernen als Aufgabe für den Religionsunterricht der öffentlichen Schule. Anlässe, Positionen und Perspektiven einer aktuellen Diskussion., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16855