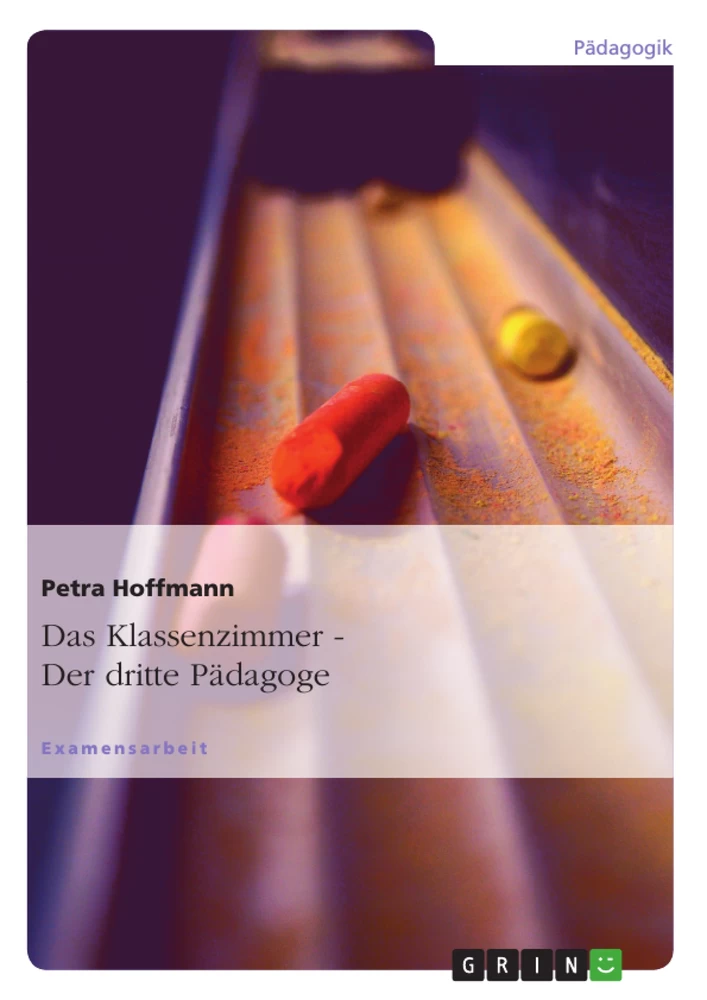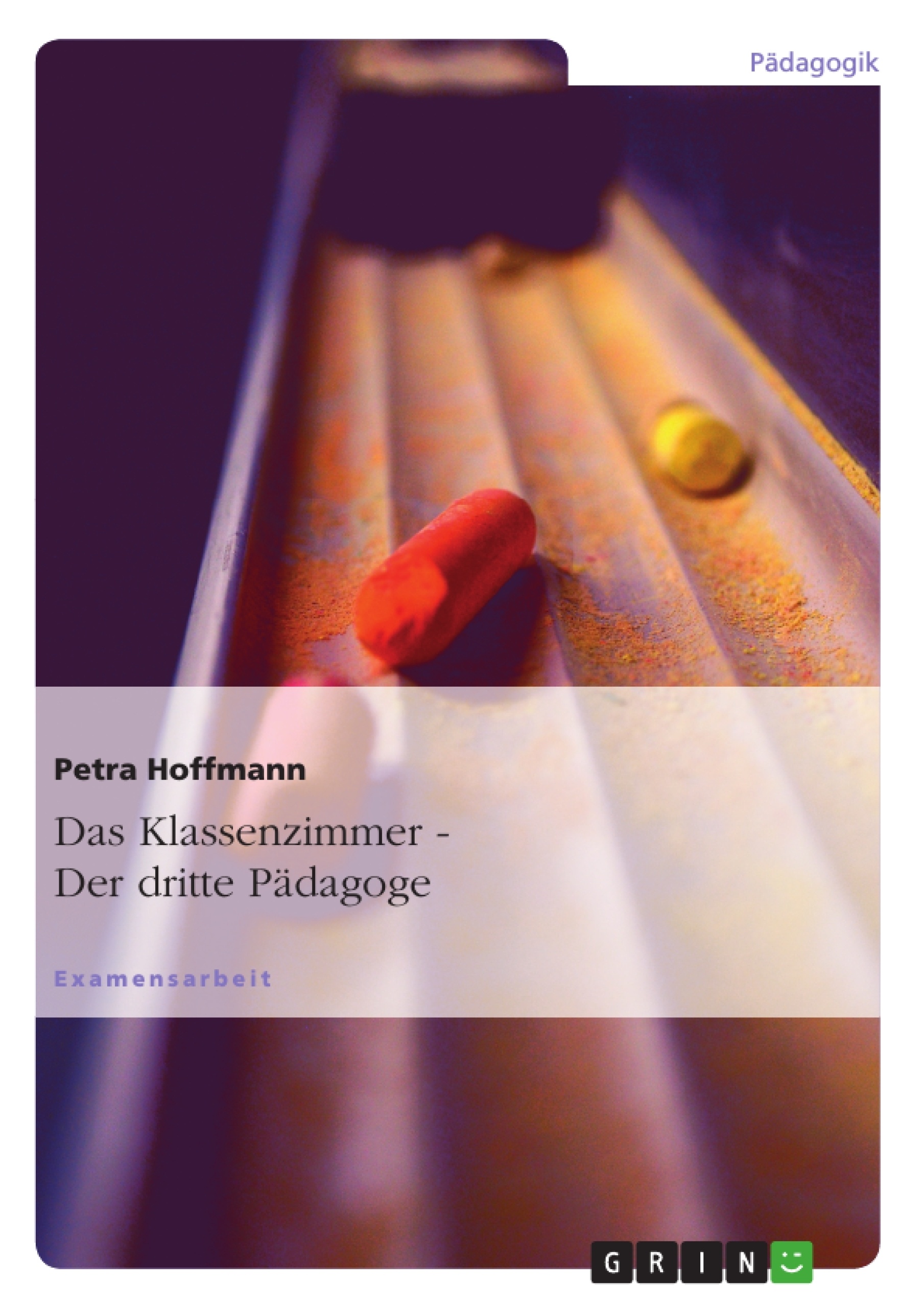Fragestellung und Bedeutsamkeit des Themas
Unterricht und Erziehung finden seit jeher in bestimmten räumlichen Kontexten statt. Ein Vorläufer des heutigen Klassenzimmers entstand bereits im 17. Jahrhundert unter dem Begriff der Schulstube (vgl. Schmidt, R. 1967, S. 14). Das Klassenzimmer durchlief bis hin zur Gegenwart eine enorme Wandlung. Schlagworte wie Lernwerkstatt, Lernlandschaft, Lern- und Lebensraum oder Lernecke wurden durch verschiedene Arten der Raumgestaltung geprägt und verleihen dem Klassenzimmer bis heute viele Gesichter.
Lehren, Lernen, Erziehung und das Zusammenleben von Schülern und Lehrer findet im Schulalltag überwiegend hier statt. Circa 90 Prozent des Unterrichts in der Bundesrepublik Deutschland wird innerhalb von Schulgebäuden erteilt (vgl. Mayer-Behrens 1987, S. 9). Nur wenige Unterrichtsstunden davon finden in der Grundschule in Fachräumen, wie dem Werkraum oder der Turnhalle, statt. Die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht sowie Englisch, Ethik und Religion werden in der Regel in demselben Klassenzimmer unterrichtet. Einen großen Teil der Lern- und Lebenszeit verbringen Grundschüler und ihre Klassenlehrer demnach innerhalb der Wände eines einzigen Raumes.
Dieser Umstand ist Anlass genug, um zu untersuchen, welchen Einfluss die Innenarchitektur, die Raumeinrichtung und in diesem Zusammenhang die pädagogische Gestaltung des Klassenraums auf die darin agierenden Personen haben. Die zentralen Fragen meiner Examensarbeit mit dem Thema „Das Klassenzimmer - Der dritte Pädagoge“ untersuchen diesen Einfluss:
Welche Auswirkungen haben Architektur, Raumgestaltung und Raumeinrichtung des Klassenzimmers der Grundschule auf die Lernmöglichkeiten der Schüler, auf die Umsetzung erzieherischer Lernziele und auf das Zusammenleben in der Klasse? Welche Chancen gibt es, die Lernmöglichkeiten, die Umsetzung erzieherischer Lernziele sowie das Zusammenleben in der Klasse mit Hilfe der Umgestaltung des Klassenzimmers zu verbessern?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Fragestellung und Bedeutsamkeit des Themas
- 1.2 Aufbau der Arbeit und Eingrenzung des Themas
- 2. Zur Geschichte des Schulbaus und des Klassenzimmers
- 2.1 Anfänge des elementaren Schulbaus und des Klassenzimmers
- 2.2 Johann Heinrich Pestalozzi: Die Idee der „Schulwohnstube“
- 2.3 Reformpädagogische Einflüsse
- 2.3.1 Maria Montessori: Selbsttätigkeit durch kindgerechte Möbel und Materialien
- 2.3.2 Peter Petersen: Die Schule als Handlungsraum einer Lebensgemeinschaft
- 2.3.3 Célestin Freinet: Kommunikation und Kooperation als Kriterien für die Raumgestaltung
- 2.4 Zur Klassenraumgestaltung in DDR und BRD
- 3. Aktuelle Rahmenbedingungen der Klassenraumgestaltung
- 3.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen - Veränderte Kindheit
- 3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen in Sachsen
- 4. Architektur und Klassenraumgestaltung
- 4.1 Mensch und Raum – Kind und Raum
- 4.2 Schulraumformen und Platzbedarf
- 4.3 Farben
- 4.4 Licht
- 4.5 Akustik
- 4.6 Raumhygiene
- 4.7 Raumaufteilung
- 4.8 Mobiliar
- 4.9 Sitzordnung
- 5. Das Klassenzimmer - „Der dritte Pädagoge“
- 5.1 Das Klassenzimmer als Lernfaktor
- 5.2 Das Klassenzimmer als Erziehungsfaktor
- 5.3 Das Klassenzimmer als Lebensraum für Schüler und Lehrer
- 5.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Innenarchitektur, der Raumeinrichtung und der pädagogischen Gestaltung des Grundschulklassenzimmers auf Schüler, Lehrer und das Klassenklima. Ziel ist es, die Auswirkungen der Raumgestaltung auf Lernmöglichkeiten, erzieherische Lernziele und das Zusammenleben in der Klasse zu analysieren und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
- Geschichtliche Entwicklung des Klassenzimmers und Einfluss verschiedener Pädagogen
- Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Klassenraumgestaltung
- Architektur und raumgestalterische Aspekte (Licht, Farbe, Akustik, Mobiliar)
- Der Klassenraum als Lern-, Erziehungs- und Lebensraum
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Klassenraumgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: den Einfluss der Architektur, Raumgestaltung und -einrichtung des Grundschulklassenzimmers auf Lernmöglichkeiten, erzieherische Ziele und das Klassenklima. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und grenzt das Thema ein, indem sie beispielsweise Fachräume und die Lernumgebung im Freien ausschließt. Die Bedeutsamkeit des Themas wird anhand der langen Geschichte des Klassenzimmers und seiner Wandlung bis heute hervorgehoben.
2. Zur Geschichte des Schulbaus und des Klassenzimmers: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Klassenzimmers, beginnend mit den Anfängen des elementaren Schulbaus im 17. Jahrhundert. Es werden die Einflüsse von Pädagogen wie Pestalozzi, Montessori, Petersen und Freinet auf die Raumgestaltung detailliert beschrieben, wobei jeweils die pädagogischen Konzepte und ihre Auswirkungen auf die Einrichtung und Ausstattung der Klassenräume im Fokus stehen. Der Vergleich der Klassenraumgestaltung in der DDR und BRD rundet das Kapitel ab.
3. Aktuelle Rahmenbedingungen der Klassenraumgestaltung: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Veränderungen (veränderte Kindheit, Medienkonsum, kleinere Spielgruppen) und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachsen (VwVSächsBO, SächsSchulbauR) im Hinblick auf die Klassenraumgestaltung. Es wird deutlich, dass gesetzliche Vorschriften oft auf Sicherheit und Funktionalität, weniger auf pädagogische Aspekte ausgerichtet sind.
4. Architektur und Klassenraumgestaltung: Das Kapitel befasst sich eingehend mit architektonischen und gestalterischen Aspekten. Es werden verschiedene Schulraumformen (Flurschule, Hallenschule, Großraumschule, Wabenschule) vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für moderne pädagogische Konzepte bewertet. Die Bedeutung von Farbe, Licht, Akustik, Raumhygiene und Mobiliar für das Lern- und Lebensklima wird umfassend diskutiert. Der Platzbedarf pro Schüler und Möglichkeiten der Raumoptimierung werden ebenfalls behandelt.
5. Das Klassenzimmer - „Der dritte Pädagoge“: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und betrachtet den Klassenraum als aktiven Mitgestalter des Lern- und Erziehungsprozesses ("dritter Pädagoge"). Es werden die Funktionen des Klassenzimmers als Lernfaktor, Erziehungsfaktor und Lebensraum für Schüler und Lehrer herausgearbeitet. Eine abschließende Kontrollliste dient als praktische Hilfestellung für die Gestaltung eines lernfördernden und wohlfühlenden Klassenraumes.
Schlüsselwörter
Grundschulpädagogik, Klassenraumgestaltung, Raumdidaktik, Reformpädagogik, Montessori, Pestalozzi, Petersen, Freinet, Lernumgebung, Schulbau, Architektur, Licht, Farbe, Akustik, Raumhygiene, Mobiliar, Sitzordnung, Sozialkompetenz, Selbstständigkeit, Lernfaktor, Erziehungsfaktor, Lebensraum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Einfluss der Klassenraumgestaltung auf Lernmöglichkeiten, erzieherische Ziele und das Klassenklima"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Innenarchitektur, der Raumeinrichtung und der pädagogischen Gestaltung des Grundschulklassenzimmers auf Schüler, Lehrer und das Klassenklima. Ziel ist die Analyse der Auswirkungen der Raumgestaltung auf Lernmöglichkeiten, erzieherische Lernziele und das Zusammenleben in der Klasse sowie die Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen.
Welche Aspekte der Klassenraumgestaltung werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Klassenraumgestaltung, darunter die historische Entwicklung, aktuelle gesellschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen in Sachsen, architektonische und gestalterische Elemente (Licht, Farbe, Akustik, Mobiliar, Raumaufteilung, Sitzordnung), sowie die Rolle des Klassenzimmers als Lern-, Erziehungs- und Lebensraum.
Welche historischen Einflüsse auf die Klassenraumgestaltung werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Klassenzimmers von seinen Anfängen bis heute. Dabei werden die Einflüsse wichtiger Pädagogen wie Pestalozzi, Montessori, Petersen und Freinet detailliert beschrieben, inklusive deren pädagogischer Konzepte und deren Auswirkungen auf die Einrichtung und Ausstattung von Klassenräumen. Ein Vergleich der Klassenraumgestaltung in der DDR und BRD wird ebenfalls vorgenommen.
Welche aktuellen Rahmenbedingungen beeinflussen die Klassenraumgestaltung?
Das Kapitel zu den aktuellen Rahmenbedingungen analysiert gesellschaftliche Veränderungen (veränderte Kindheit, Medienkonsum, kleinere Spielgruppen) und gesetzliche Rahmenbedingungen in Sachsen (VwVSächsBO, SächsSchulbauR). Es wird gezeigt, dass gesetzliche Vorschriften oft stärker auf Sicherheit und Funktionalität als auf pädagogische Aspekte ausgerichtet sind.
Welche architektonischen und gestalterischen Aspekte werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt verschiedene Schulraumformen (Flurschule, Hallenschule, Großraumschule, Wabenschule) und bewertet deren Eignung für moderne pädagogische Konzepte. Die Bedeutung von Farbe, Licht, Akustik, Raumhygiene und Mobiliar für das Lern- und Lebensklima wird umfassend diskutiert. Der Platzbedarf pro Schüler und Möglichkeiten der Raumoptimierung werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt das Klassenzimmer als "dritter Pädagoge"?
Die Arbeit betrachtet den Klassenraum als aktiven Mitgestalter des Lern- und Erziehungsprozesses ("dritter Pädagoge"). Es werden die Funktionen des Klassenzimmers als Lernfaktor, Erziehungsfaktor und Lebensraum für Schüler und Lehrer herausgearbeitet. Eine abschließende Kontrollliste dient als praktische Hilfestellung für die Gestaltung eines lernfördernden und wohlfühlenden Klassenraumes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundschulpädagogik, Klassenraumgestaltung, Raumdidaktik, Reformpädagogik, Montessori, Pestalozzi, Petersen, Freinet, Lernumgebung, Schulbau, Architektur, Licht, Farbe, Akustik, Raumhygiene, Mobiliar, Sitzordnung, Sozialkompetenz, Selbstständigkeit, Lernfaktor, Erziehungsfaktor, Lebensraum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Geschichte des Schulbaus und des Klassenzimmers, Aktuelle Rahmenbedingungen der Klassenraumgestaltung, Architektur und Klassenraumgestaltung, und Das Klassenzimmer - "Der dritte Pädagoge". Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Petra Hoffmann (Author), 2010, Der dritte Pädagoge. Das Klassenzimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/168372