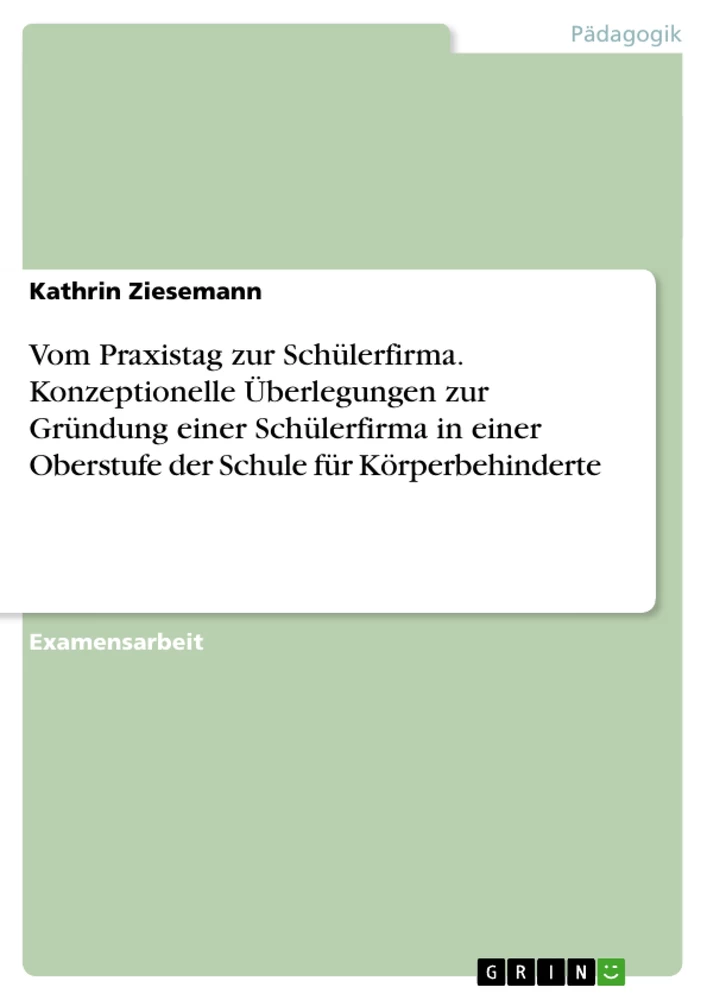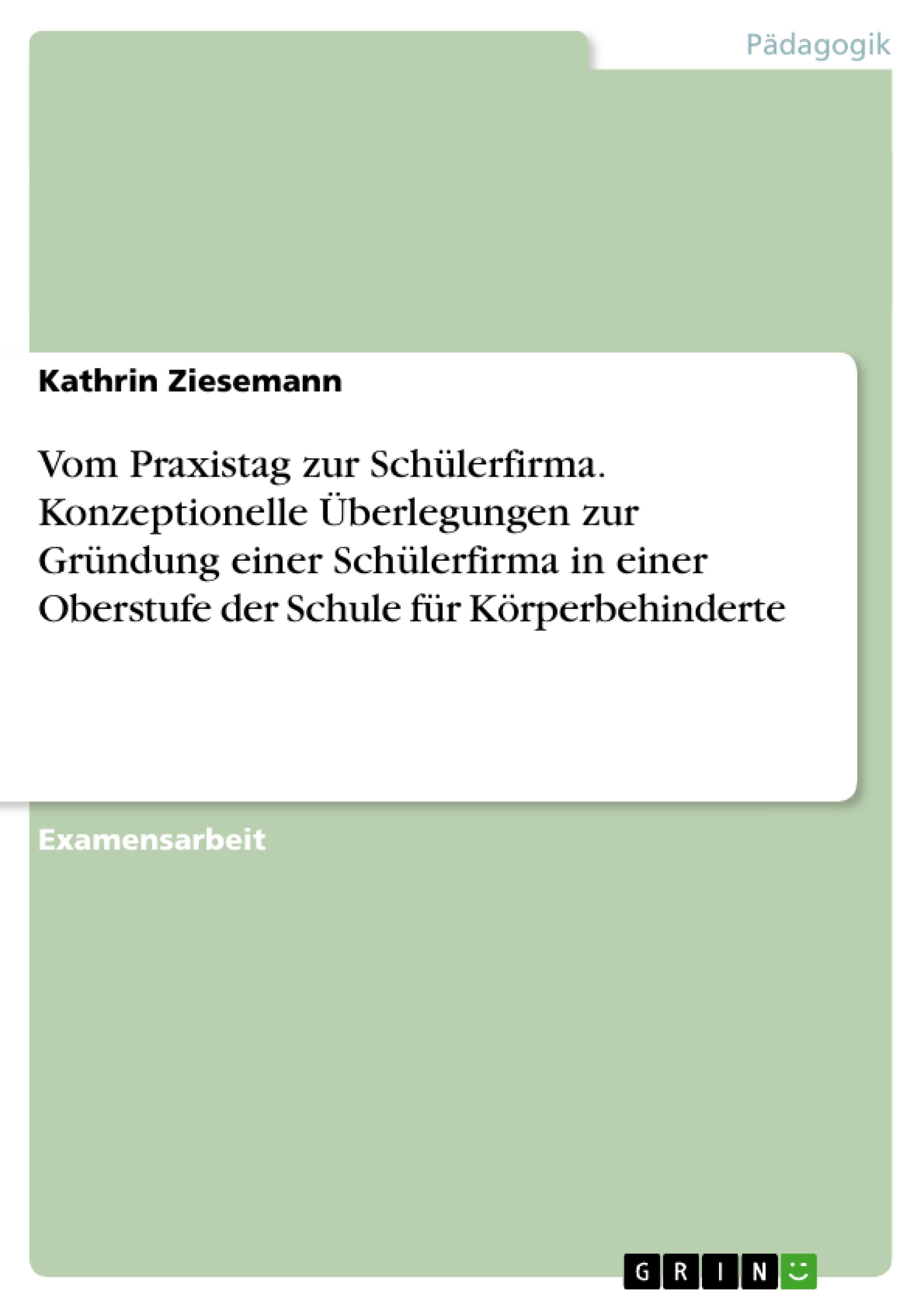Der Institution Schule kommt in der heutigen Zeit immer mehr die Aufgabe zu, Schüler auf das nachschulische (Berufs-) Leben vorzubereiten. Dies gilt im gleichen Maße für Sonder- als auch für allgemein bildende Schulen. Die Verknüpfung von Schule, Wirtschaft und Arbeitsleben stellt daher eine wichtige Aufgabe der schulischen Arbeit dar, denn Grundkenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe im Berufsleben sind in jeder Hinsicht für die Lernenden von großer Bedeutsamkeit. Dennoch wird in der Praxis deutlich, dass die Inhalte, die in der Schule gelehrt werden, oft wenig Lebensbezug haben und sich [...] die allmähliche Hinführung an die Ausbildungs- und Berufswelt als Illusion erweist, weil sie zu abstrakt und zu wenig handlungsbezogen ist (MÖHRLEIN 2002, 2).
Um dem entgegen zu wirken, habe ich in der vorliegenden Arbeit die Projektidee der Schülerfirma aufgegriffen, denn auch im Entwurf „Richtlinien für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung“ aus dem Jahre 2002 werden offene, handlungsbezogene Unterrichtsformen für die Schule für Körperbehinderte (SfKb) gefordert (KMK 2002, 8). Dieser Forderung kommt die Schülerfirma nach. Sie hat zum Ziel, Schülern in einem handlungsorientierten Unterrichtsprojekt Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen und sie allmählich an die Ausbildungs- und Berufswelt heranzuführen. Diese Aspekte erachte ich für die Schüler einer Oberstufe der SfKb als besonders wertvoll, denn ein wichtiges Ziel der Arbeit in einer Oberstufe der SfKb ist es, ihre Schüler auf ein Leben nach der Schule vorzubereiten.
Auch das Schulprogramm der Christy-Brown-Schule, an welcher ich meinen Vorbereitungsdienst absolviere, sieht als generelle Zielsetzung für die Arbeit in der Oberstufe vor, die Schüler auf ein Leben nach der Schule vorzubereiten. Daher zählen zu den wesentlichen Aufgaben der Unterrichtsarbeit u. a. die zukünftigen Lebensbereiche „Arbeiten“ und „Berufstätigkeit“. Neben dem vierwöchigen Betriebspraktikum werden den Schülern sowohl Betriebserkundungen als auch individuelle Beratungen in Zusammenarbeit mit Lehrern, Eltern, dem Arbeitsamt, Arbeitgebern sowie Betrieben ermöglicht. Kernpunkt der Unterrichtsarbeit in der Oberstufe der Christy-Brown-Schule ist jedoch der Praxistag, welcher einmal wöchentlich in klassenübergreifenden Arbeitsgruppen stattfindet (www.lwl.org/christy-brown-schule/verwaltung/v1.htm).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Begriffsbestimmungen
- 1.1 Schule für Körperbehinderte
- 1.2 Oberstufe der Schule für Körperbehinderte
- 1.3 Praxistag
- 1.4 Schülerfirma
- 2 Grundlegende Aspekte zur Gründung einer Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte
- 2.1 Begründung der Projektidee Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte
- 2.2 Zielgruppe der Schülerfirma
- 2.3 Ziele der Schülerfirma
- 2.3.1 Öffnung der Schule
- 2.3.2 Motivation statt Schulmüdigkeit und Schulunlust
- 2.3.3 Vermittlung praktischer Erfahrungen mit Arbeitsprozessen, Betriebsabläufen und Betriebsstrukturen
- 2.3.4 Vermittlung von Erfahrungen mit den Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt
- 2.3.5 Bereitstellung von Berufswahlkriterien auf der Basis eigener Erfahrungen
- 2.3.6 Erwerb von Schlüsselqualifikationen
- 2.4 Einbettung der Schülerfirma in Lehrpläne und Unterricht
- 2.5 Beurteilungskriterien zur Mitarbeit in der Schülerfirma
- 3 Schulorganisatorische Rahmenbedingungen zur Gründung einer Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte
- 3.1 Einholung des Einverständnisses des Schulleiters
- 3.2 Zeitlicher Rahmen
- 3.3 Räumliche, sächliche und personelle Organisation
- 3.3.1 Räumliche Organisation
- 3.3.2 Sächliche Organisation
- 3.3.3 Personelle Organisation
- 4 Abteilungen der Schülerfirma
- 4.1 Allgemeine Darstellung der Abteilungen
- 4.2 Büroabteilung
- 4.3 Abteilung Werken/Gestaltung
- 4.4 Abteilung Kantine
- 5 Gründung einer Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte
- 5.1 Wahl der Rechtsform
- 5.1.1 Schülerfirmen als Schulprojekte ohne eigenen Rechtsstatus
- 5.1.2 Schülerfirmen unter dem Dach des Fördervereins
- 5.1.3 Schülerfirmen in Partnerschaft mit einer Institution oder Firma
- 5.1.4 Schülerfirmen als Wirtschaftsunternehmen
- 5.2 Auswahl eines Firmennamens und -Logos für die Schülerfirma
- 5.3 Gründungsvertrag der Schülerfirma
- 5.4 Startkapital
- 5.4.1 Fremdfinanzierung
- 5.4.1.1 Aufnahme eines Kredits
- 5.4.1.2 Darlehen vom schulischen Förderverein
- 5.4.1.3 Sponsoring
- 5.4.2 Eigenfinanzierung
- 5.4.2.1 Gründung einer Genossenschaft
- 5.4.2.2 Gründung einer Aktiengesellschaft
- 5.5 Klärung der Zuständigkeitsbereiche
- 5.6 Bewerbungsverfahren
- 5.7 Rotationsprinzip
- 5.8 Mitgliederversammlungen
- 5.8.1 Versammlung der Abteilungen
- 5.8.2 Hauptversammlung
- 5.9 Ablauf des Firmenalltags
- 5.10 Kundenkreis
- 5.11 Gewinn
- 6 Ausblick und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Gründung einer Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte (SfKb) konzeptionell zu beleuchten. Sie beleuchtet die pädagogischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte der Gründung einer solchen Schülerfirma.
- Die Bedeutung der Schülerfirma als Instrument der Berufsorientierung und Vorbereitung auf das Berufsleben.
- Die Integration von Schülerfirmen in den schulischen Alltag und die Einbindung in Lehrpläne und Unterricht.
- Die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gründung einer Schülerfirma.
- Die Auswahl von Abteilungen, Rechtsformen und Finanzierungsmodellen für Schülerfirmen.
- Die Rolle der Schülerfirma als Plattform für die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und sozialer Kompetenz.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs "Schule für Körperbehinderte" und beleuchtet die Oberstufe sowie den Praxistag in diesem Kontext. Anschließend widmet sie sich den grundlegenden Aspekten der Gründung einer Schülerfirma, einschließlich der Begründung der Projektidee, der Zielgruppe, der Ziele, der Einbettung in Lehrpläne und der Beurteilungskriterien. Kapitel 3 analysiert die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen, wie z.B. die Einholung des Einverständnisses des Schulleiters, den zeitlichen Rahmen und die räumliche, sächliche und personelle Organisation. Kapitel 4 präsentiert verschiedene Abteilungen, die innerhalb einer Schülerfirma eingerichtet werden können, wie z.B. die Büroabteilung, die Abteilung Werken/Gestaltung und die Abteilung Kantine. Das letzte Kapitel, Kapitel 5, konzentriert sich auf die konkrete Gründung einer Schülerfirma, einschließlich der Wahl der Rechtsform, der Auswahl eines Firmennamens und -logos, der Finanzierungsmöglichkeiten und der Organisation des Firmenalltags.
Schlüsselwörter
Schülerfirma, Schule für Körperbehinderte, Berufsorientierung, Praxisbezug, Unterrichtsentwicklung, Schulorganisatorische Rahmenbedingungen, Rechtsformen, Finanzierung, Schlüsselqualifikationen, soziale Kompetenz.
- Quote paper
- Kathrin Ziesemann (Author), 2003, Vom Praxistag zur Schülerfirma. Konzeptionelle Überlegungen zur Gründung einer Schülerfirma in einer Oberstufe der Schule für Körperbehinderte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16821