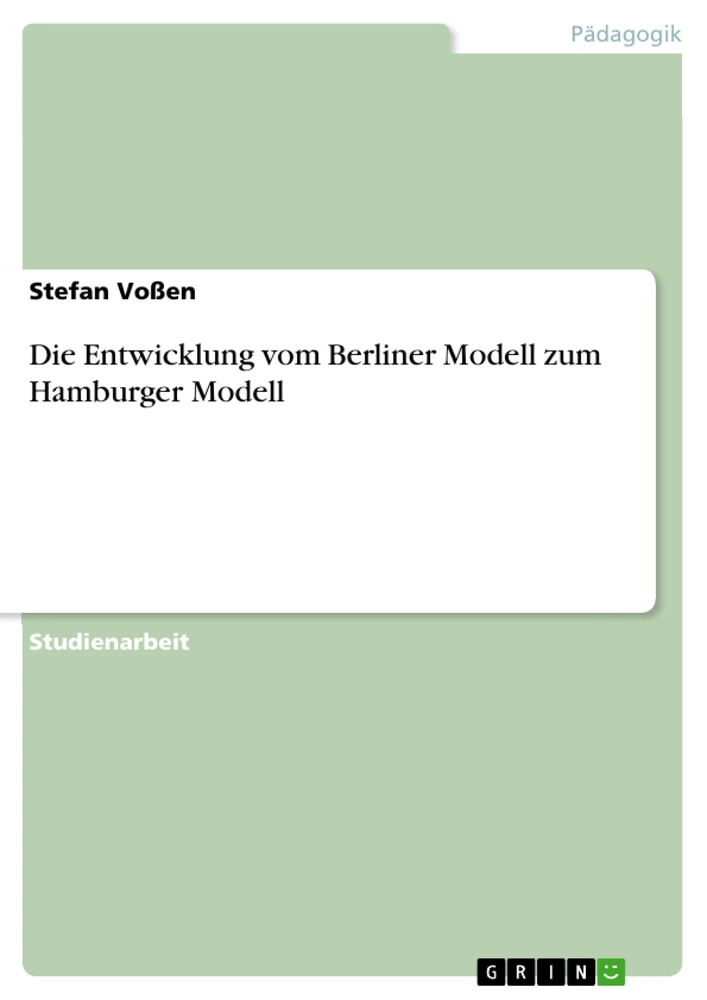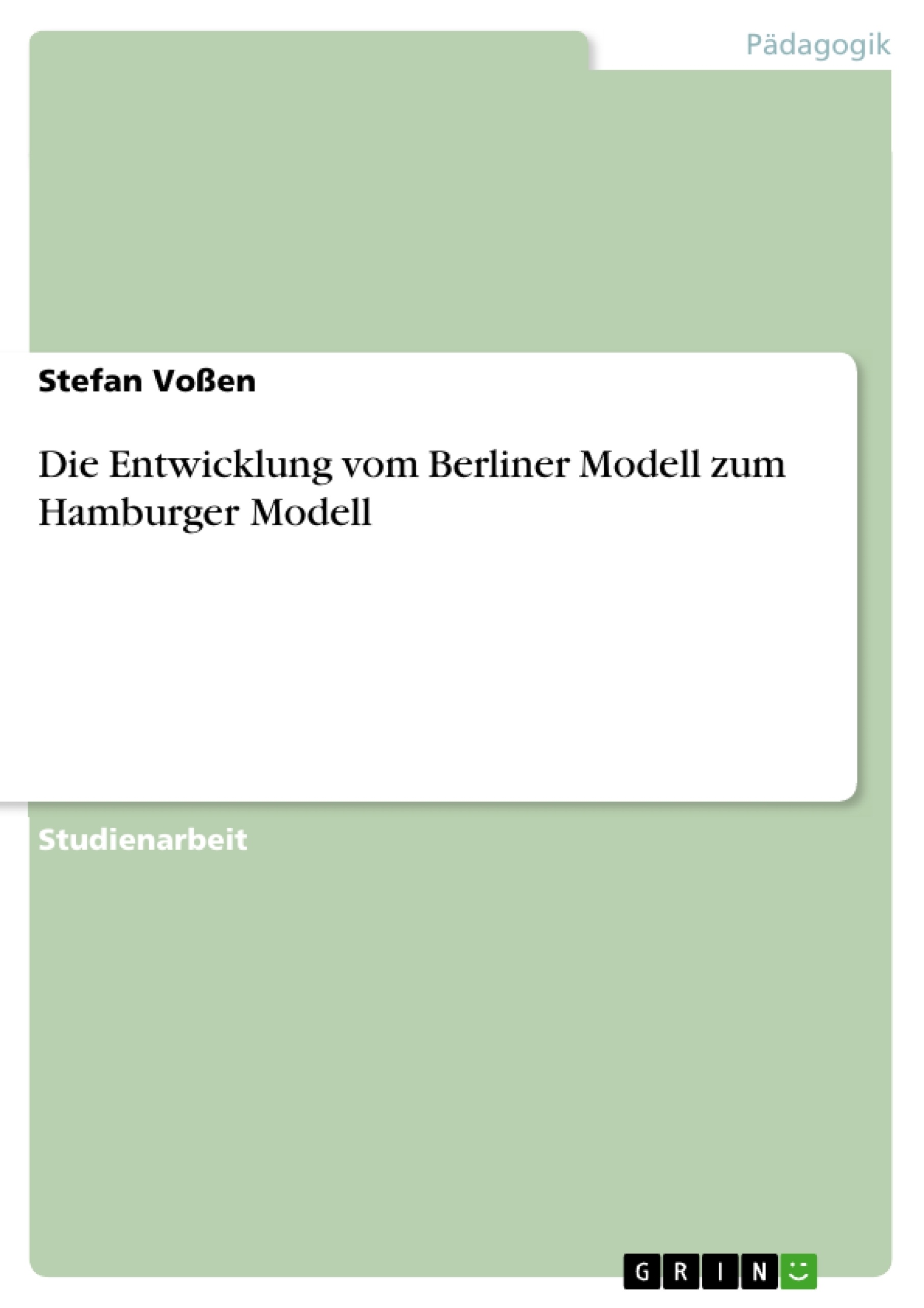Eine universelle und erfolgreiche Schulausbildung für jeden Menschen ist in unserer modernen Gesellschaft ein klares Muss geworden und obwohl diese von viele heutzutage als selbst-verständliche Gegebenheit gesehen wird, ist ein gelungener Unterricht ein schwer erreichbares Ziel und abhängig von einer Fülle von Faktoren. Bis eine Institution Schule wirklich effizient funktioniert und einen Ort bildet, der die Erziehung und Bildung vieler Kinder und Jugendlicher übernimmt, ist eine adäquate Ausbildung der Lehrer unabdingbar. Dabei ist nicht nur von Relevanz, dass Lehrer in der Lage sind, sozial kompetent agieren und erziehen zu können sowie ihren fachlichen Stoff beherrschen. Es ist auch von fundamentaler Wichtigkeit, dass Lehrer sich über ihre eigene Tätigkeit im Klaren sind und wissen, auf welche Art und Weise der Lehrende dem Lernenden bestmöglich zur Weiterbildung hilft. Diese sogenannte Didaktik, griechisch für Unterrichtslehre, stellt also einen elementaren Bestandteil in der Lehrerbildung dar. Es gibt mittlerweile eine große Zahl an didaktischen Theorien, Modellen und Methoden, die diverse Teilbereiche des Lehrerberufs abdecken. Manche Theorien sind häufig in negative Kritik geraten, andere scheinen eine wesentlich bessere Hilfe zu sein.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich inhaltlich mit einigen didaktischen Theorien, die in direktem Zusammenhang zueinander stehen und in ihrer Entstehung und ihrem Inhalt eng miteinander verflochten sind. Sie behandelt die inhaltlichen Schwerpunkte des sogenannten Berliner Modells, das in Abgrenzung zu Klafkis Theorie vom Wissenschaftler Paul Heimann entwickelt worden ist. Ein weiteres Thema der Hausarbeit ist die Kritik, die dem Berliner Modell entgegengebracht wird und die Verwirklichung einer Neuentwicklung des Berliner Modells vom ehemaligen Assistenten Heimanns, Wolfgang Schulz, und dem daraus resultierten Hamburger Modell für didaktische Unterrichtsplanung, dessen Inhalte ebenfalls vorgestellt werden. Obwohl das Hamburger Modell aus dem Berliner Modell entstanden ist, sind doch elementare Unterschiede zu erkennen, sodass beide als eigenständige, aber eng verbundene didaktische Modelle zu betrachten sind. Eben diese Unterschiede werden in dieser Arbeit aufgegriffen, hervorgehoben und begründet. Außerdem wird ein Augenmerk darauf gelegt, inwiefern die Kritikpunkte am Berliner Modell in der Entwicklung zum Hamburger Modell auch tatsächlich gewichtet und ausgemerzt worden sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Konzepte der lehr-lerntheoretischen Didaktik
- 2.1. Das Berliner Modell – der erste Entwurf
- 2.1.1. Begründung des Modells
- 2.1.2. Die Reflexionsebenen
- 2.2. Kritikpunkte und vermeintliche Mängel des Berliner Modells.
- 2.3. Das Hamburger Modell - Die Revolutionierung des Berliner Modells
- 2.3.1. Das Handlungsmodell
- 2.3.2. Das Ouidy-Rad
- 2.3.3. Das Planungsmodell
- 2.1. Das Berliner Modell – der erste Entwurf
- 3. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der lehr-lerntheoretischen Didaktik, insbesondere mit dem Berliner Modell und seiner Weiterentwicklung zum Hamburger Modell. Die Arbeit analysiert die Begründung und Struktur des Berliner Modells sowie die Kritikpunkte, die zu seiner Weiterentwicklung führten. Im Fokus steht dabei die Frage, inwiefern das Hamburger Modell die Kritikpunkte am Berliner Modell berücksichtigt und ob es eine eigenständige didaktische Theorie darstellt.
- Analyse des Berliner Modells und seiner Entstehung
- Kritikpunkte am Berliner Modell
- Die Weiterentwicklung zum Hamburger Modell
- Vergleich des Berliner und Hamburger Modells
- Relevanz der didaktischen Modelle für die Lehrerbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert die Bedeutung der Didaktik für die Lehrerbildung. Sie stellt das Berliner Modell und das Hamburger Modell als zentrale Themen der Arbeit vor.
2. Die Konzepte der lehr-lerntheoretischen Didaktik
Dieses Kapitel beschreibt die Konzepte der lehr-lerntheoretischen Didaktik, insbesondere das Berliner Modell von Paul Heimann und Wolfgang Schulz. Die Begründung des Modells, die Reflexionsebenen und die Kritikpunkte werden behandelt.
2.1. Das Berliner Modell – der erste Entwurf
Dieses Unterkapitel erklärt die Entstehung des Berliner Modells und seine Begründung im Kontext der damaligen Lehrerbildung. Es beleuchtet die Kritik an Klafkis Theorie und die Intentionen von Heimann und Schulz bei der Entwicklung des Modells. Die zentralen Elemente des Modells, die Strukturanalyse und die Faktorenanalyse, werden vorgestellt.
2.2. Kritikpunkte und vermeintliche Mängel des Berliner Modells.
Dieses Unterkapitel beleuchtet die Kritik am Berliner Modell, die von verschiedenen Seiten geäußert wurde. Es werden die Kritikpunkte hinsichtlich der Praxisrelevanz, der Komplexität und der Einseitigkeit des Modells diskutiert.
2.3. Das Hamburger Modell - Die Revolutionierung des Berliner Modells
Dieses Unterkapitel stellt das Hamburger Modell von Wolfgang Schulz vor, das als Weiterentwicklung des Berliner Modells verstanden werden kann. Es beschreibt die zentralen Elemente des Hamburger Modells, das Handlungsmodell, das Ouidy-Rad und das Planungsmodell.
Schlüsselwörter
Lehr-lerntheoretische Didaktik, Berliner Modell, Hamburger Modell, Unterrichtsplanung, Strukturanalyse, Faktorenanalyse, Kritikpunkte, Handlungsmodell, Ouidy-Rad, Planungsmodell, Lehrerbildung.
- Quote paper
- Stefan Voßen (Author), 2010, Die Entwicklung vom Berliner Modell zum Hamburger Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/167419