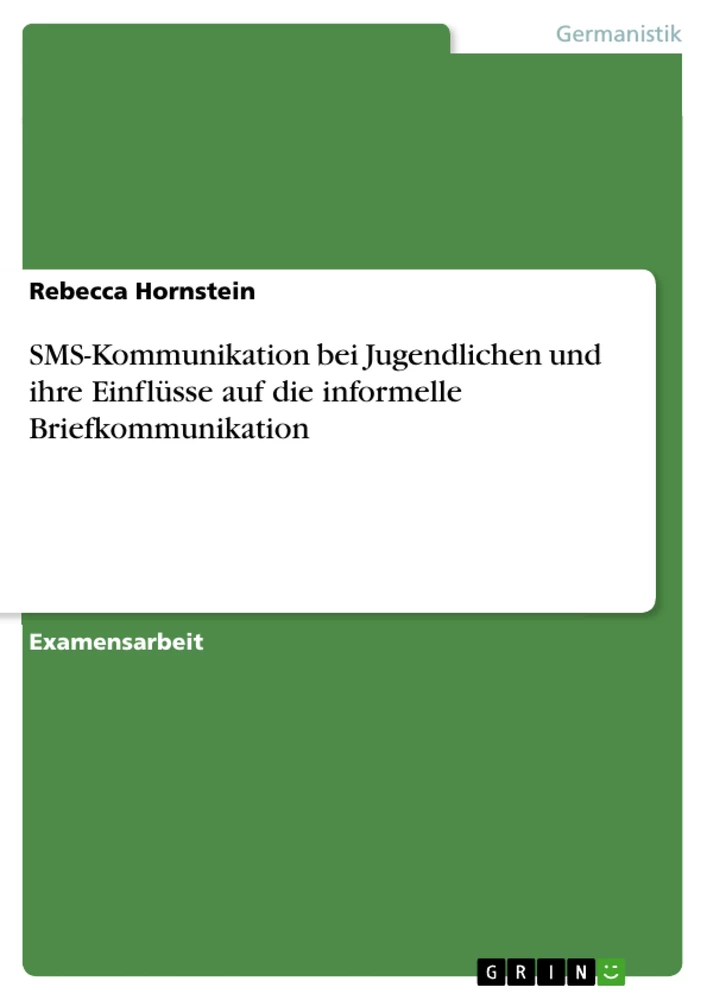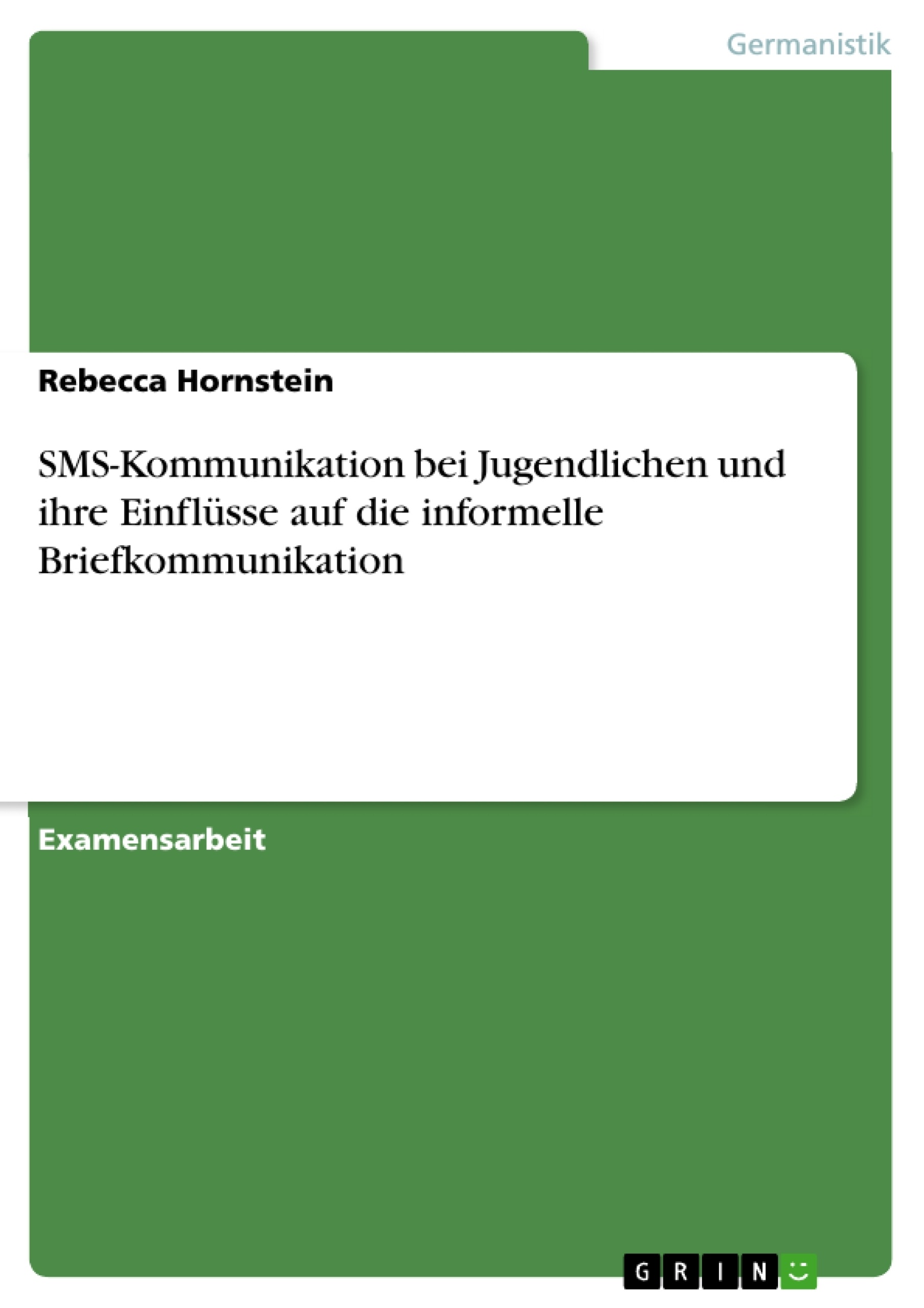Die Kommunikation per SMS gehört für einen Großteil der Bevölkerung mittlerweile zum Alltag und ist für viele Menschen aus diesem überhaupt nicht mehr wegzudenken. Inhaltlich hat die SMS-Kommunikation dabei innerhalb kürzester Zeit nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens erfasst: Verabredungen werden via SMS getroffen, verschoben oder abgesagt, Glückwünsche werden per Kurznachricht übermittelt, Beziehungen durch SMS-Liebesbotschaften begonnen, am Leben gehalten und mitunter auch beendet, wichtige Informationen weitergeleitet oder erfragt.
Das Versenden und Empfangen von SMS erfreut sich dabei inzwischen in breiten Kreisen der Bevölkerung einer großen Beliebtheit. Dennoch sind es nach wie vor die Jugendlichen, die den Short Message Service vorwiegend in Anspruch nehmen.
Die SMS-Kommunikation Jugendlicher zeichnet sich dabei vor allem in sprachlicher Hinsicht durch eine Reihe von Besonderheiten aus, so dass vielfach sogar davon gesprochen wird, dass sich die Jugendlichen beim Schreiben von Kurznachrichten einer eigenen „SMS-Sprache“ bedienen (vgl. etwa Dürscheid 2002a: 108), die sich u.a. durch den Hang zu systematischen Verkürzungen und Reduktionen, durch die Vernachlässigung geltender Orthographie- und Interpunktionsregeln sowie durch die Verwendung spezieller graphostilistischer Mittel kennzeichnen lässt.
In Bezug auf die eigentümliche Verwendung der Sprache in SMS wird immer öfter die Befürchtung laut, dass sich diese auch auf den allgemeinen Sprachgebrauch auswirken und Sprachwandelprozesse herbeiführen könnte.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die „SMS-Sprache“ von Jugendlichen näher betrachtet werden. Von Interesse sind neben den sprachlichen Strukturen auch die spezifischen SMS-Nutzungsweisen der Jugendlichen. Fragen nach der Häufigkeit der SMS-Kommunikation, nach der Art und Anzahl der Kommunikationspartner sowie nach den häufigsten kommunikativen Funktionen sollen in diesem Zusammenhang u.a. Beachtung finden. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit besteht darin, zu untersuchen, ob sich die Verwendung der speziellen SMS-Sprache tatsächlich auf den allgemeinen schriftlichen Sprachgebrauch auswirkt. Hierbei soll im Speziellen der Einfluss auf die traditionelle Textform der informellen Kommunikation, den Brief, im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Zum Stand der Forschung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der Short-Message-Service
- 2.1.1 Definition und Funktionsweise
- 2.1.2 Die Erfolgsgeschichte der SMS
- 2.2 Die SMS-Kommunikation
- 2.2.1 SMS als Kommunikationsform und kommunikative Gattung
- 2.2.1.1 Bestimmung der SMS als Kommunikationsform
- 2.2.1.2 SMS eine kommunikative Gattung?
- 2.2.2 Charakteristika der SMS-Kommunikation
- 2.2.3 SMS als Kommunikationsform zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- 3. Die empirische Untersuchung
- 3.1 Die Untersuchungsgruppe
- 3.2 Methodik
- 3.2.1 Die eingesetzten Erhebungsmethoden
- 3.2.1.1 Befragung mit Fragebogen
- 3.2.1.2 Textproduktion
- 3.2.1.3 SMS-Protokoll
- 3.2.1.4 Leitfadeninterview
- 3.2.2 Kritische Anmerkungen zur Datenerhebung
- 3.3 Auswertung der empirischen Untersuchung
- 3.3.1 Zur Darstellung der Ergebnisse
- 3.3.2 Das SMS-Nutzungsverhalten der Schüler
- 3.3.2.1 Nutzung des Mobiltelefons und Wichtigkeit der einzelnen Handy-Applikationen
- 3.3.2.2 Kommunikative und funktionale Aspekte der SMS-Nutzung
- 3.3.2.3 Einschätzung der Vor- und Nachteile der SMS-Kommunikation
- 3.3.3 Linguistische Analyse der protokollierten Kurznachrichten
- 3.3.3.1 Orthographie und Interpunktion
- 3.3.3.2 Reduktionsphänomene: Tilgungen, Synkopen und Eklisen
- 3.3.3.3 Lexikalische Kurzformen
- 3.3.3.4 Syntaktische Reduktionen
- 3.3.3.5 Lexikalische Aspekte
- 3.3.3.6 Dialektismen
- 3.3.3.7 Graphostilistische Besonderheiten
- 3.3.3.8 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.3.4 Auswertung der Textproduktion
- 3.3.4.1 Orthographie und Interpunktion
- 3.3.4.2 Reduktionsphänomene: Tilgungen, Synkopen und Enklisen
- 3.3.4.3 Lexikalische Kurzformen
- 3.3.4.4 Syntaktische Reduktionen
- 3.3.4.5 Lexikalische Aspekte
- 3.3.4.6 Dialektismen
- 3.3.4.7 Graphostilistische Besonderheiten
- 3.3.4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.3.5 Die Schreibgewohnheiten der Schüler: Sprache in den SMS - Sprache in den Briefen
- 3.3.5.1 Typ A: Standardsprache in SMS und Briefen
- 3.3.5.2 Typ B: Abweichungen in SMS, Standardsprache in Briefen
- 3.3.5.3 Typ C: Abweichungen in SMS und Briefen
- 4. Diskussion: Einfluss der SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation
- 5. Resümee und Ausblick
- Der Einfluss von SMS auf die Sprachentwicklung Jugendlicher
- Vergleich der sprachlichen Merkmale von SMS und Briefen
- Kommunikative Funktionen von SMS im Vergleich zu traditionellen Briefen
- Analyse sprachlicher Reduktionsphänomene in SMS
- Untersuchung des Verhältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der SMS-Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation bei Jugendlichen. Ziel ist es, die Veränderungen in der schriftlichen Kommunikation aufzuzeigen und zu analysieren, die durch die zunehmende Nutzung von SMS entstehen. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen der Kommunikationswissenschaft mit empirischen Daten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt den Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird der Forschungsstand zum Thema SMS-Kommunikation und deren Einfluss auf andere Kommunikationsformen dargestellt, um den Kontext der Untersuchung zu verdeutlichen und die Forschungslücke zu definieren. Die Einleitung dient der Begründung der Relevanz des Themas und der methodischen Vorgehensweise.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der SMS-Kommunikation. Es werden der Short-Message-Service, seine Funktionsweise und seine Erfolgsgeschichte erläutert. Es folgt eine eingehende Analyse der SMS als Kommunikationsform und kommunikative Gattung, unter Berücksichtigung ihrer Charakteristika und ihrer Positionierung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Diese Kapitel dient der fundierten Einordnung der empirischen Untersuchung in den wissenschaftlichen Diskurs.
3. Die empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die durchgeführt wurde, um den Einfluss der SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation zu analysieren. Es werden die Methodik, die Untersuchungsgruppe und die eingesetzten Erhebungsmethoden (Fragebogen, Textproduktion, SMS-Protokoll, Leitfadeninterview) detailliert dargestellt. Die Auswertung der empirischen Daten wird präsentiert, inklusive der linguistischen Analyse der protokollierten Kurznachrichten und des Vergleichs der Schreibgewohnheiten in SMS und Briefen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Limitationen der Datenerhebung rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
SMS-Kommunikation, informelle Briefkommunikation, Jugendliche, Sprachwandel, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, linguistische Analyse, empirische Untersuchung, Kommunikationsformen, Textproduktion, Kurznachrichten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Einfluss von SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation bei Jugendlichen"
Was ist der Gegenstand und die Zielsetzung dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation bei Jugendlichen. Das Ziel ist es, Veränderungen in der schriftlichen Kommunikation durch die zunehmende SMS-Nutzung aufzuzeigen und zu analysieren. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen der Kommunikationswissenschaft mit empirischen Daten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den Einfluss von SMS auf die Sprachentwicklung Jugendlicher, den Vergleich sprachlicher Merkmale von SMS und Briefen, die kommunikativen Funktionen von SMS im Vergleich zu traditionellen Briefen, die Analyse sprachlicher Reduktionsphänomene in SMS und die Untersuchung des Verhältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der SMS-Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) stellt den Gegenstand und die Zielsetzung vor und beschreibt den Forschungsstand. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) beleuchtet den Short-Message-Service, seine Funktionsweise und die SMS als Kommunikationsform. Kapitel 3 (Empirische Untersuchung) beschreibt die Methodik, die Untersuchungsgruppe und die Auswertung der Daten (Fragebogen, Textproduktion, SMS-Protokoll, Leitfadeninterview), inklusive linguistischer Analysen. Kapitel 4 (Diskussion) diskutiert den Einfluss der SMS-Kommunikation auf die informelle Briefkommunikation. Kapitel 5 (Resümee und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung eingesetzt?
Die empirische Untersuchung nutzte verschiedene Erhebungsmethoden: Befragung mit Fragebogen, Textproduktion (Brief), SMS-Protokoll und Leitfadeninterview. Die Daten wurden sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet, inklusive linguistischer Analysen der SMS-Nachrichten und des Vergleichs von SMS- und Brieftexten.
Welche Aspekte der SMS-Kommunikation wurden linguistisch analysiert?
Die linguistische Analyse der SMS umfasste die Untersuchung von Orthographie und Interpunktion, Reduktionsphänomenen (Tilgungen, Synkopen, Eklisen), lexikalischen Kurzformen, syntaktischen Reduktionen, lexikalischen Aspekten, Dialektismen und graphostilistischen Besonderheiten. Diese Analysen wurden sowohl für die protokollierten SMS als auch für die von den Teilnehmern produzierten Briefe durchgeführt.
Wie wurden die Schreibgewohnheiten der Schüler in SMS und Briefen verglichen?
Die Schreibgewohnheiten wurden anhand von drei Typen kategorisiert: Typ A (Standardsprache in SMS und Briefen), Typ B (Abweichungen in SMS, Standardsprache in Briefen) und Typ C (Abweichungen in SMS und Briefen). Dieser Vergleich verdeutlicht den Einfluss der SMS-Kommunikation auf die formale Sprache der Schüler in verschiedenen Schreibsituationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: SMS-Kommunikation, informelle Briefkommunikation, Jugendliche, Sprachwandel, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, linguistische Analyse, empirische Untersuchung, Kommunikationsformen, Textproduktion, Kurznachrichten.
- Quote paper
- Rebecca Hornstein (Author), 2008, SMS-Kommunikation bei Jugendlichen und ihre Einflüsse auf die informelle Briefkommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/165627