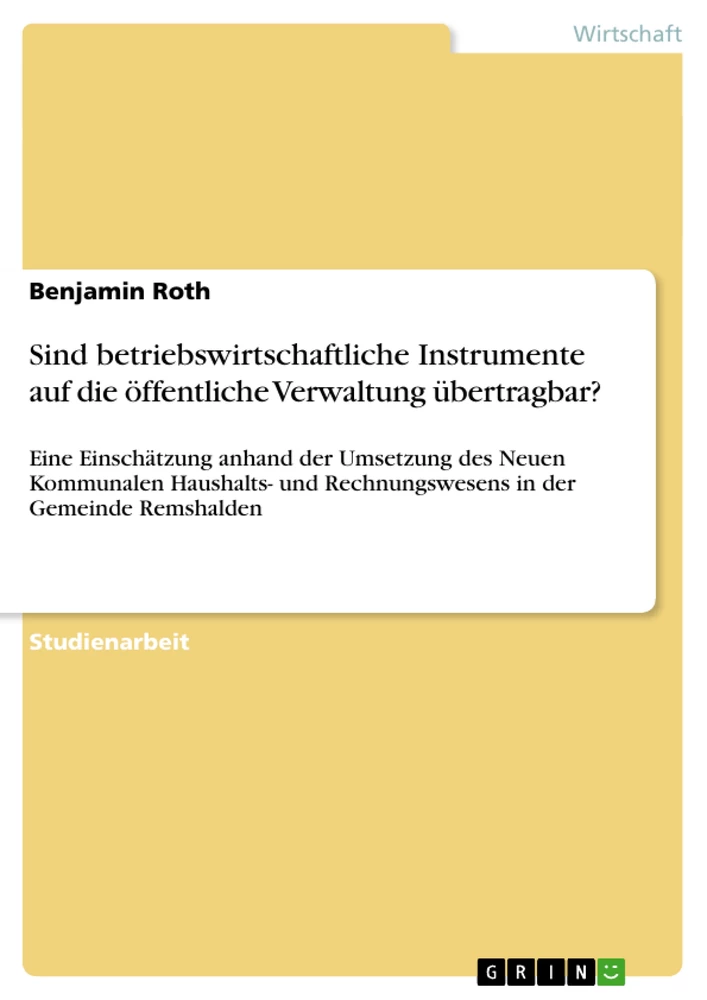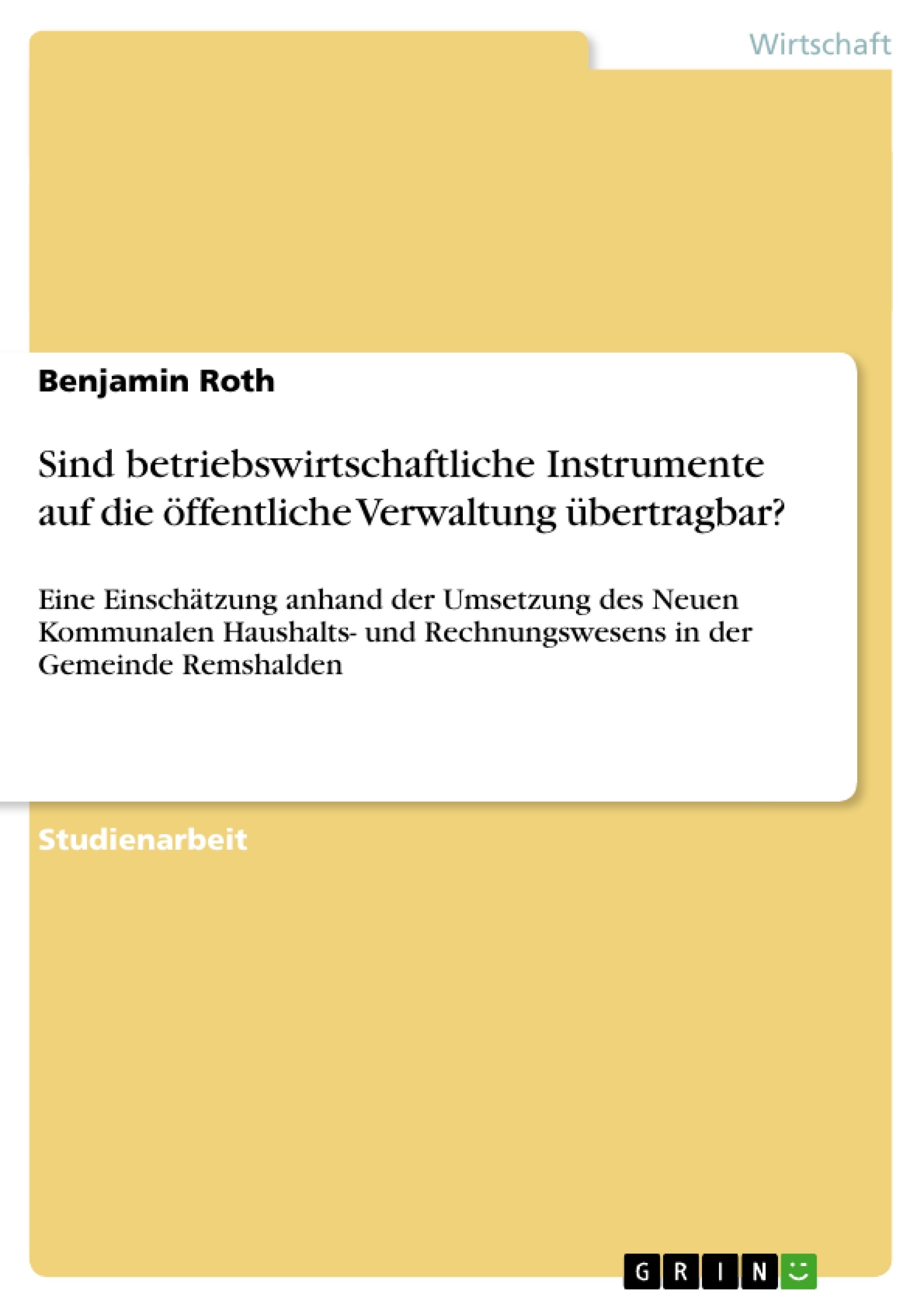Unter dem Eindruck immer größerer Probleme der öffentlichen Haushalte, setzte sich Anfang der 90er Jahre in Deutschland ein Prozess in Gang, der unter dem Namen des „Neuen Steuerungsmodells (NSM)“ bekannt wurde. Dieses Modell verfolgte unter andrem den Ansatz, das öffentliche Rechnungswesen um- und auszubauen (Lüder 1994: 189). Die veraltete Buchführung in der öffentlichen Verwaltung, die Kameralistik, wird auch für die Handlungsunfähigkeit bis hin zur Zahlungsunfähigkeit verantwortlich gemacht (Kuban 1999: 481). Dies liegt vor allem an der Funktion, die der Kameralistik zugewiesen wird. Denn zu den Hauptaufgaben zählt die Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen bzw. Ausgaben und den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Raupach & Stangenberg 2006: 3). Die Diskussion über die Kameralistik und die Kritik an ihr gibt es schon lange, aber die Kameralistik konnte sich bis heute noch behaupten. Die Kritik richtet sich unter anderem auf den bereits genannten Aspekt, dass das kamerale Buchführungssystem als ein reines Geldverbrauchskonzept gesehen wird. Vielmehr ist die Aufgabe eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu planen und dokumentieren (Budäus 2007: 46).
Die zentrale Frage, ob betriebswirtschaftliche Instrumente auf die öffentliche Verwaltung übertragbar sind, soll am Beispiel des NKHR in Baden-Württemberg beschrieben werden. Das Kapitel 2 erklärt das methodische Vorgehen dieser Arbeit. Anschließend wird in Kapitel 3 die Problemstellung nochmals ausführlicher dargestellt und Reformansätze beschrieben. In Kapitel 4 wird das Konzept des NKHR anhand der rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen, sowie anhand der Ziele der Reform vorgestellt. Darauf folgt im nächsten Kapitel ein empirisches Beispiel, wie das NKHR in der Gemeinde Remshalden umgesetzt wurde. Im letzten Kapitel erfolgen ein Fazit und eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 3. Problemstellung und Reformansätze
- 3.1 Probleme der Kameralistik
- 3.2 Reformansätze
- 4. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
- 4.1 Rechtliche Grundlagen
- 4.2 Ziele der Reform
- 4.3 Inhaltliche Grundlagen
- 5. Erfahrungen bei der Einführung des NKHR
- 5.1 Bisheriger Entwicklungsstand
- 5.2 Der Umsetzungsprozess in der Gemeinde Remshalden
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob betriebswirtschaftliche Instrumente wie die doppelte Buchführung auf die öffentliche Verwaltung übertragbar sind. Sie analysiert die Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg, insbesondere die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).
- Die Probleme der traditionellen Kameralistik in der öffentlichen Verwaltung
- Die Ziele und Inhalte des NKHR, das sich stark an der Doppik orientiert
- Die Erfahrungen bei der Einführung des NKHR in Baden-Württemberg
- Die Übertragbarkeit des NKHR auf die Gemeinde Remshalden als Fallbeispiel
- Die Herausforderungen und Chancen der Reform für die öffentliche Verwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die Problemstellung der Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens dar. Kapitel 2 erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 3 analysiert die Probleme der Kameralistik und beschreibt verschiedene Reformansätze. Kapitel 4 präsentiert das NKHR, seine rechtlichen Grundlagen, Ziele und inhaltlichen Bestandteile. Kapitel 5 beleuchtet die Erfahrungen bei der Einführung des NKHR in Baden-Württemberg, insbesondere in der Gemeinde Remshalden. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Kameralistik, Doppik, Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), öffentliche Verwaltung, Gemeinde Remshalden, Reform, Übertragbarkeit, betriebswirtschaftliche Instrumente, Finanz- und Vermögensrechnung, Ressourcenverbrauch, Handlungsunfähigkeit.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Roth (Autor:in), 2010, Sind betriebswirtschaftliche Instrumente auf die öffentliche Verwaltung übertragbar?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164817