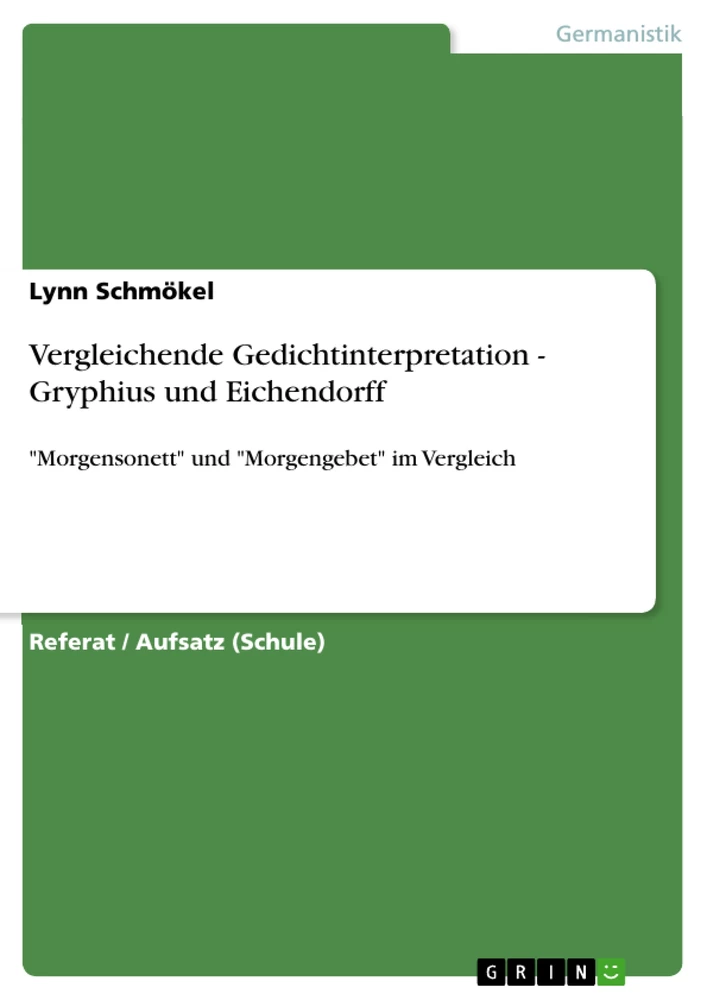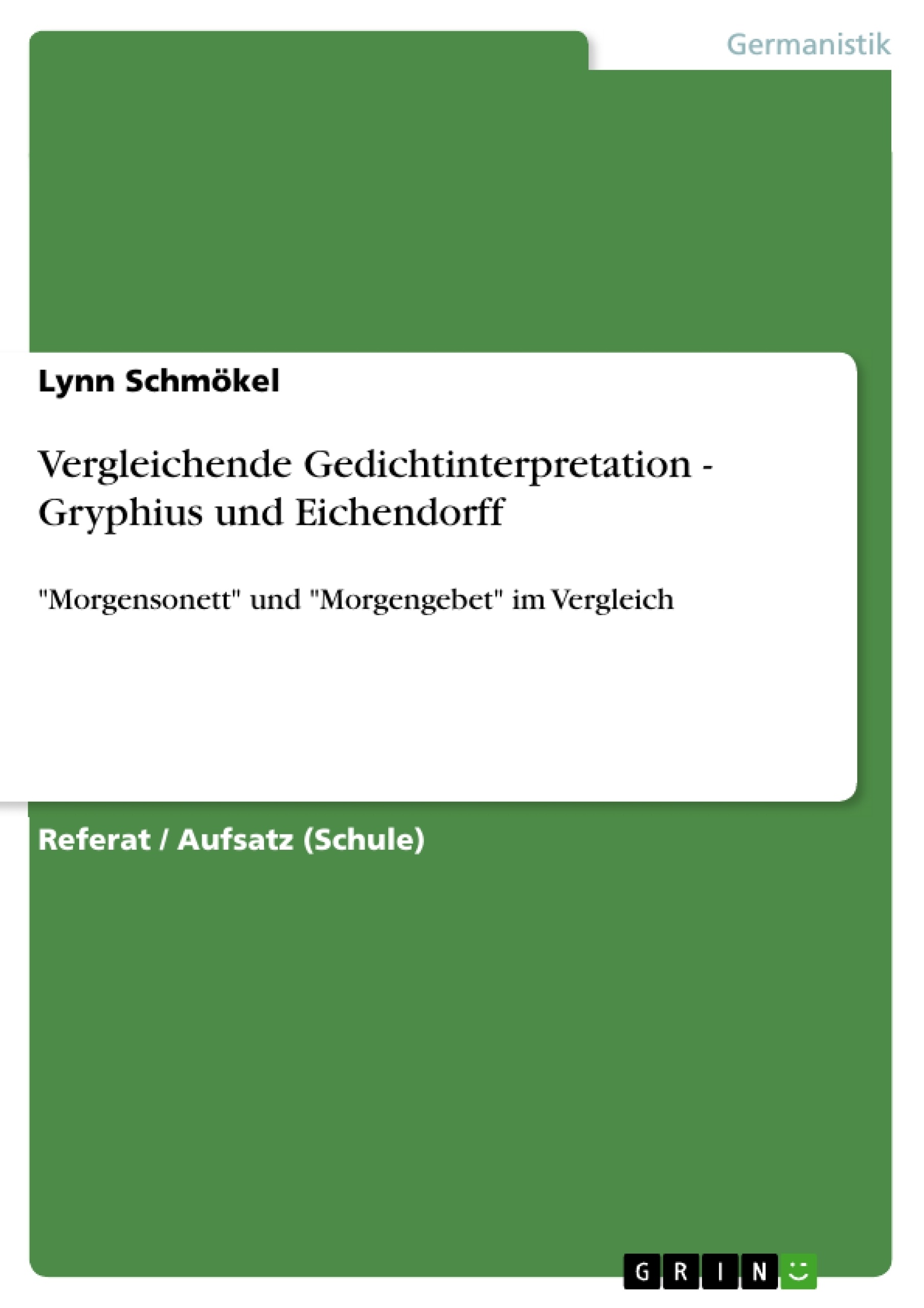Das Barock und die Romantik sind zwei Stilepochen, die nicht nur ein beachtlicher zeitlicher Abstand trennt, sondern die sich auch in ihren Kunstauffassungen stark unterscheiden, so steht zum Bespiel das Barock mit seiner poetologischen Forderung nach Formgebundenheit in starker Abgrenzung zur Romantik, die diese auflöst. Trotz der Unterschiede der äußeren Form und der inhaltlichen Struktur gibt es eine Gemeinsamkeit beider Gedichte, die Religiosität. Sowohl Andreas Gryphius „Morgen Sonett“ und Joseph von Eichendorffs „Morgengebet“ liegt ein starker religiöser Grundgedanke zugrunde, da beide lyrischen Sprecher angesichts des Morgens in Dialog mit Gott treten.
Inhaltsverzeichnis
- Gryphius „Morgen Sonett“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht zwei Gedichte aus unterschiedlichen Epochen, das Barock und die Romantik, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Kunstauffassung und religiösen Ausrichtung aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse der formalen Gestaltung und der inhaltlichen Interpretation, insbesondere im Hinblick auf die religiösen Themen.
- Vergleich der formalen Gestaltung barocker und romantischer Lyrik
- Analyse religiöser Motive und Symbole in den Gedichten
- Interpretation der Naturdarstellung und ihrer Bedeutung
- Untersuchung der Rolle des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zu Gott
- Bedeutung der verwendeten Metaphern und Allegorien
Zusammenfassung der Kapitel
Gryphius „Morgen Sonett“: Das Sonett von Andreas Gryphius beschreibt den Übergang von der Nacht zum Tag und interpretiert diesen als Triumph des Lichts über die Dunkelheit, als Metapher für den Sieg des Guten über das Böse. Durch die detailreiche Schilderung der Natur, die Verwendung von Personifikationen (z.B. „die Morgenrötte lacht“) und Allegorien (z.B. Diane als Mondgöttin), und die Signaturenlehre wird Gottes Wirken in der Welt verdeutlicht. Der Wechsel von der objektiven Naturbeschreibung zu einem direkten Gebet an die „dreymal höchste Macht“ markiert einen inhaltlichen und formalen Bruch im Gedicht, wobei die zweite Hälfte des Sonetts die Bitte um Erleuchtung, Stärkung im Glauben und Schutz vor Leid beinhaltet, und das barocke „memento mori“ und „carpe diem“ aufgreift. Die strenge Form des Sonetts, die sich in den Quartetten zeigt, steht im Kontrast zum freieren Reimschema in den Terzetten, was den inneren Konflikt des lyrischen Ichs symbolisiert. Die Sonne fungiert als zentrale Metapher für Gott, deren Licht Leben und Erlösung verspricht.
Schlüsselwörter
Barocklyrik, Romantik, Gedichtinterpretation, Andreas Gryphius, Morgen Sonett, Religiosität, Naturdarstellung, Metapher, Allegorie, Signaturenlehre, Gott, Sonne, Licht, Dunkelheit, „memento mori“, „carpe diem“, Formgebundenheit.
Häufig gestellte Fragen zu Gryphius „Morgen Sonett“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht zwei Gedichte aus dem Barock und der Romantik, wobei der Fokus auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Kunstauffassung und religiösen Ausrichtung liegt. Die vorliegende HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht, inklusive Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern.
Welche Gedichte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht ein Gedicht aus dem Barock und ein weiteres aus der Romantik. Die vorliegende Vorschau konzentriert sich auf Andreas Gryphius' „Morgen Sonett“ als Beispiel barocker Lyrik.
Was ist das Ziel der Analyse von Gryphius' „Morgen Sonett“?
Die Analyse von Gryphius' „Morgen Sonett“ zielt darauf ab, die religiösen Motive, die Naturdarstellung, die Rolle des lyrischen Ichs und die Bedeutung der verwendeten Metaphern und Allegorien zu untersuchen. Es wird die formale Gestaltung des Sonetts (Quartette und Terzette) im Hinblick auf den dargestellten inneren Konflikt des lyrischen Ichs analysiert.
Welche Themen werden in Gryphius' „Morgen Sonett“ behandelt?
Das „Morgen Sonett“ behandelt den Übergang von Nacht zu Tag als Metapher für den Sieg des Guten über das Böse, Gott, Licht und Dunkelheit. Es werden religiöse Motive, die Signaturenlehre, sowie barocke Topoi wie „memento mori“ und „carpe diem“ aufgegriffen. Die Sonne dient als zentrale Metapher für Gott.
Wie wird die Natur in Gryphius' „Morgen Sonett“ dargestellt?
Die Natur wird detailreich beschrieben und durch Personifikationen (z.B. „die Morgenrötte lacht“) und Allegorien (z.B. Diane als Mondgöttin) veranschaulicht. Die Naturbeschreibung dient dazu, Gottes Wirken in der Welt zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt das lyrische Ich in Gryphius' „Morgen Sonett“?
Das lyrische Ich wendet sich in einem direkten Gebet an Gott und bittet um Erleuchtung, Stärkung im Glauben und Schutz vor Leid. Der formale Bruch im Gedicht (strenge Form der Quartette im Kontrast zum freieren Reimschema der Terzette) symbolisiert den inneren Konflikt des lyrischen Ichs.
Welche literarischen Mittel werden in Gryphius' „Morgen Sonett“ verwendet?
Es werden Metaphern (z.B. die Sonne als Metapher für Gott), Allegorien, Personifikationen und die Signaturenlehre verwendet. Die strenge Form des Sonetts und der Kontrast zwischen Quartetten und Terzetten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit und Gryphius' „Morgen Sonett“?
Schlüsselwörter sind: Barocklyrik, Gedichtinterpretation, Andreas Gryphius, Morgen Sonett, Religiosität, Naturdarstellung, Metapher, Allegorie, Signaturenlehre, Gott, Sonne, Licht, Dunkelheit, „memento mori“, „carpe diem“, Formgebundenheit.
- Arbeit zitieren
- Lynn Schmökel (Autor:in), 2010, Vergleichende Gedichtinterpretation - Gryphius und Eichendorff, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164633