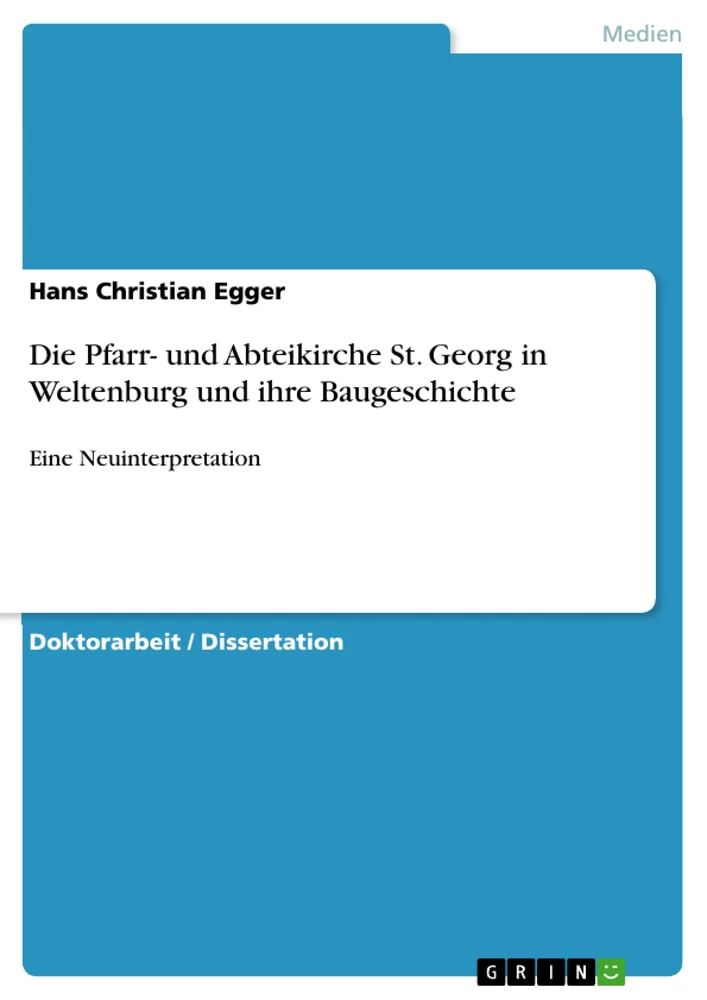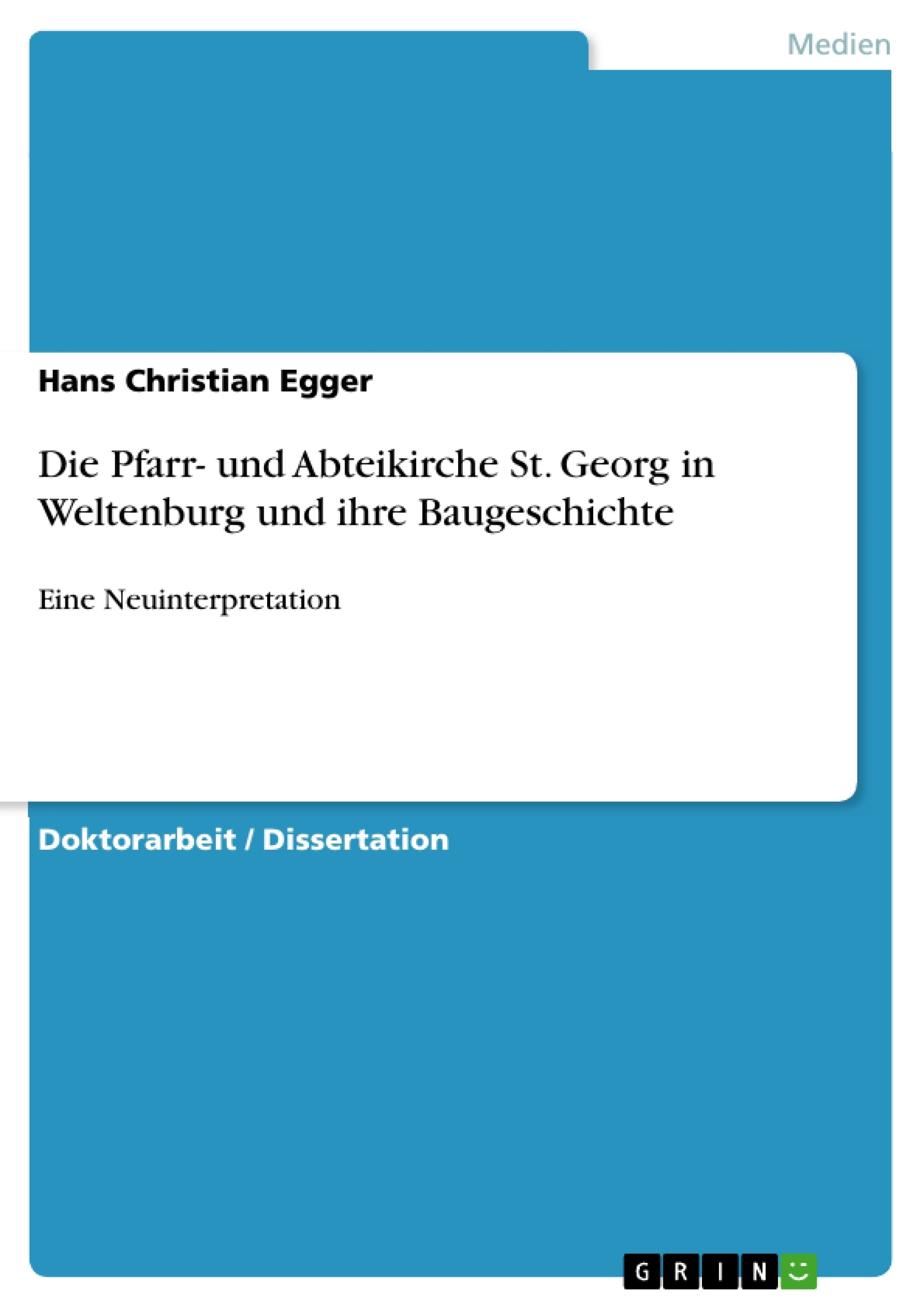Das Kloster Weltenburg an der Donau wurde im frühen 18. Jahrhundert neu erbaut und ausgestattet. Die Abteikirche stellt einen der Höhepunkte des bayerischen Spätbarock dar, was als Verdienst der Gebrüder Cosmas Damian und Egid Quirin Asam gewertet wird, die hier als Architekten und Raumausstatter die entscheidende Rolle gespielt haben sollen. Beschäftigt man sich näher mit der Baugeschichte, so wird erkennbar, dass das Brüderpaar keineswegs jene dominante Rolle gespielt haben kann. Der Autor kommt in der vorliegende Arbeit zum Schluss, dass der Zentralbau nicht aus stilistischen Erwägungen, sondern aus Gründen der örtlichen Lichtproblematik gewählt wurde und wohl auf einen Vorschlag von Philipp Plank, dem wichtigsten Baumeister der Franziskaner zurückgeht, der auch das Gesamtkonzept der Abtei entwarf und das Konventgebäude errichtete. Die Innenausstattung hingegen trägt nicht die Mendikanten-Handschrift von Plank, sondern von Andreas Pozzo, aus dessen Stichwerk jene konzeptionellen Anregungen stammen, die Abt Bächl letztendlich zum leitenden stilistischen Prinzip im Sinne des klassisch-römischen Barocks erhoben hat.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der seit Jahrzehnten heftig umstrittenen Baugeschichte des Hauptaltars, in welcher der Umbau der Ostfassade eine wichtige Zäsur darstellt. Ein Durchgang durch den Sockel des Reiterstandbildes des Hl. Georg und andere bislang von der Forschung unbeachtete Details führten zu einer neuen Bauchronik die durch das dendrochonologische Gutachten der Bauforscher der Gesamt-instandsetzung im Herbst 2008 bestätigt wurde. Demnach wurde der Altar 1721 von Egid Asam durch den hl. Georg, zwei Heilige und das Kurfürstenwappen ergänzt und die Decke im gleichen Jahr von Bruder Cosmas Asam freskiert. Dies machte es möglich die Kirche im Herbst 1721 bei einer Primizfeier als fertig zu präsentieren. Als sich nach der Gerüstentfernung herausstellte, dass das Presbyterium zu wenig Licht erhielt, schliff man die Ostfassade 1722, ersetzte sie durch eine Apsis mit großen Fenstern und ergänzte den Altar mit zusätzlichen Figuren. Wenn sich die Kirche nach ergänzenden Arbeiten in den 1730er Jahren heute als einer der Höhepunkte des bayerischen Barocks darstellt, so ist sie nicht als "Asamkirche" sondern als "Regiekunstwerk" des kunstsinnigen Abtes Maurus Bächl zu rezipieren, dem es gelang die künstlerischen Beiträge der Gebrüder Asam mit jenen der anderen Künstler zu einem Ausnahmebauwerk zu verschmelzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 1.1. Das Forschungsobjekt
- 1.2. Forschungslage und Forschungsfragen
- 1.3. Methodik und Quellen
- 2. Der historische Kontext
- 3. Der kunsthistorische Kontext
- 3.1. Die Barockarchitektur in Bayern
- 3.2. Gesamt- und Regiekunstwerke, das Theatrum Sacrum und Weltenburg
- 3.3. Die Künstler des bayerischen Barock
- 3.3.1. Künstlerlaufbahnen
- 3.3.2. Die Künstlerfamilie Asam
- 3.3.3. Frater Philipp Plank
- 3.3.4. Abt Maurus Bächl
- 4. Die Baugeschichte von Weltenburg (1709-1803)
- 4.1. Der Weg zum neuen Konventgebäude (1709-1716)
- 4.1.1. Zerfallende Mauern, bröckelnde Disziplin
- 4.1.2. Abt Maurus Bächl ergreift die Initiative
- 4.1.3. Die Errichtung des Konventgebäudes (1714-1716)
- 4.2. Die Planung der neuen Abteikirche
- 4.2.1. Die alte Kirche
- 4.2.2. Die Vorgaben für den Neubau
- 4.2.3. Der Weg von den Vorgaben zum Zentralbau
- 4.2.4. Die Vorbilder
- 4.2.5. Baupläne
- 4.2.6. Die Architektenfrage
- 4.3. Der Rohbau der Abteikirche
- 4.4. Die Kirch- und Altarweihe
- 4.5. Die Ausstattungsphase 1718 bis 1721
- 4.6. Der Besuch des Kurfürsten
- 4.7. Die erste Asam-Ausstattungsphase (1721 bis 1723)
- 4.8. Das Kirchweih- und Primizfest 1721
- 4.9. Die Errichtung des Hochaltars der Abteikirche
- 4.9.1. Der barocke Altar im Sinne des Tridentinums
- 4.9.2. Der Hochaltar und das Patrozinium
- 4.9.3. Das Konzept des Hochaltars und seine Bestandteile
- 4.10. Der Umbau der Ostfassade
- 4.11. Die Fertigstellung des Hochaltars (1722-1723)
- 4.12. Die zweite Asam-Ausstattungsphase (1734-1736)
- 4.13. Ergänzungen und Restaurierungen (1736-1803)
- 4.14. Säkularisierung und Neubeginn (1803 – 2010)
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Baugeschichte der Abteikirche St. Georg in Weltenburg neu zu interpretieren. Sie analysiert die historischen und kunsthistorischen Kontexte des Baus und beleuchtet die verschiedenen Phasen der Baugeschichte von der Planung bis zur Fertigstellung. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Rolle der Künstlerfamilie Asam, die entscheidend an der Ausstattung der Kirche beteiligt war.
- Die Rolle der Künstlerfamilie Asam bei der Ausstattung der Abteikirche
- Die Bedeutung der Barockarchitektur in Bayern
- Die historischen und kunsthistorischen Kontexte des Baus
- Die Entwicklung der Baupläne und die architektonischen Vorbilder
- Die Einflussnahme des historischen Kontexts auf die Baugeschichte der Abteikirche
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Forschungsobjekt ein und präsentiert die Forschungslage, Forschungsfragen und die Methodik. Das zweite Kapitel untersucht den historischen Kontext der Abtei Weltenburg und die Geschichte des Ortes. Das dritte Kapitel beleuchtet den kunsthistorischen Kontext, insbesondere die Barockarchitektur in Bayern, die Gesamt- und Regiekunstwerke und die Rolle der Künstlerfamilie Asam. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Baugeschichte der Abteikirche von 1709 bis 1803 und behandelt die Planung, den Bauprozess und die Ausstattung. Es konzentriert sich dabei auf die unterschiedlichen Phasen der Baugeschichte und die beteiligten Künstler.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Barockarchitektur, Abtei Weltenburg, Asam-Familie, Baugeschichte, Kunstgeschichte, Bayern, historische Kontexte, kunsthistorische Kontexte, Theatrum Sacrum, Altarbau, Planungsgeschichte, Ausstattungsgeschichte.
- Quote paper
- Hans Christian Egger (Author), 2010, Die Pfarr- und Abteikirche St. Georg in Weltenburg und ihre Baugeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/164537