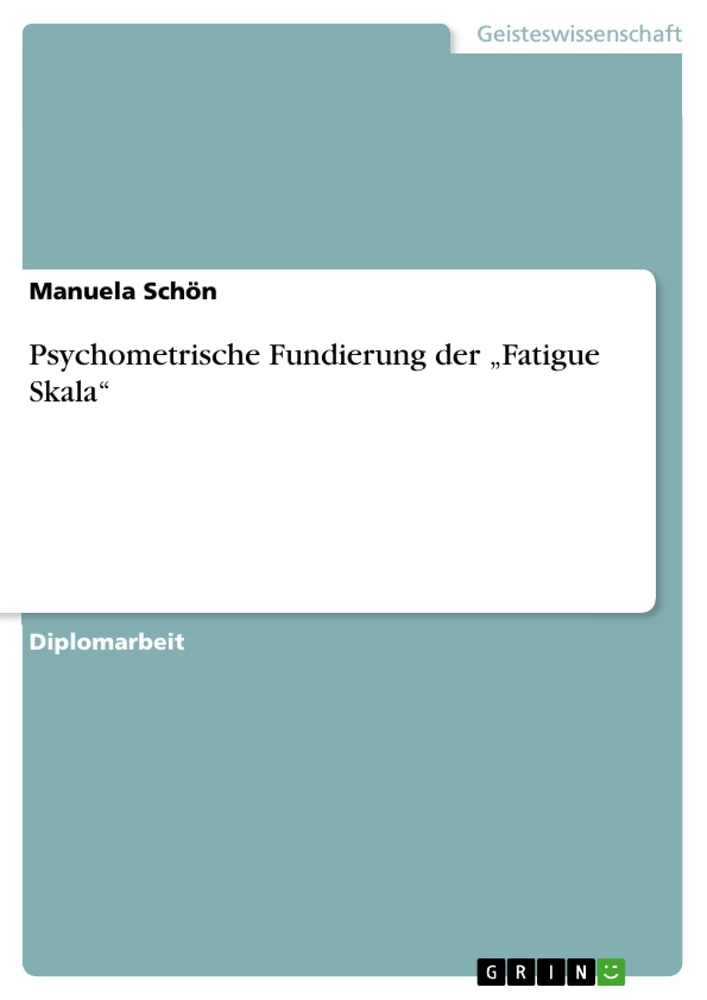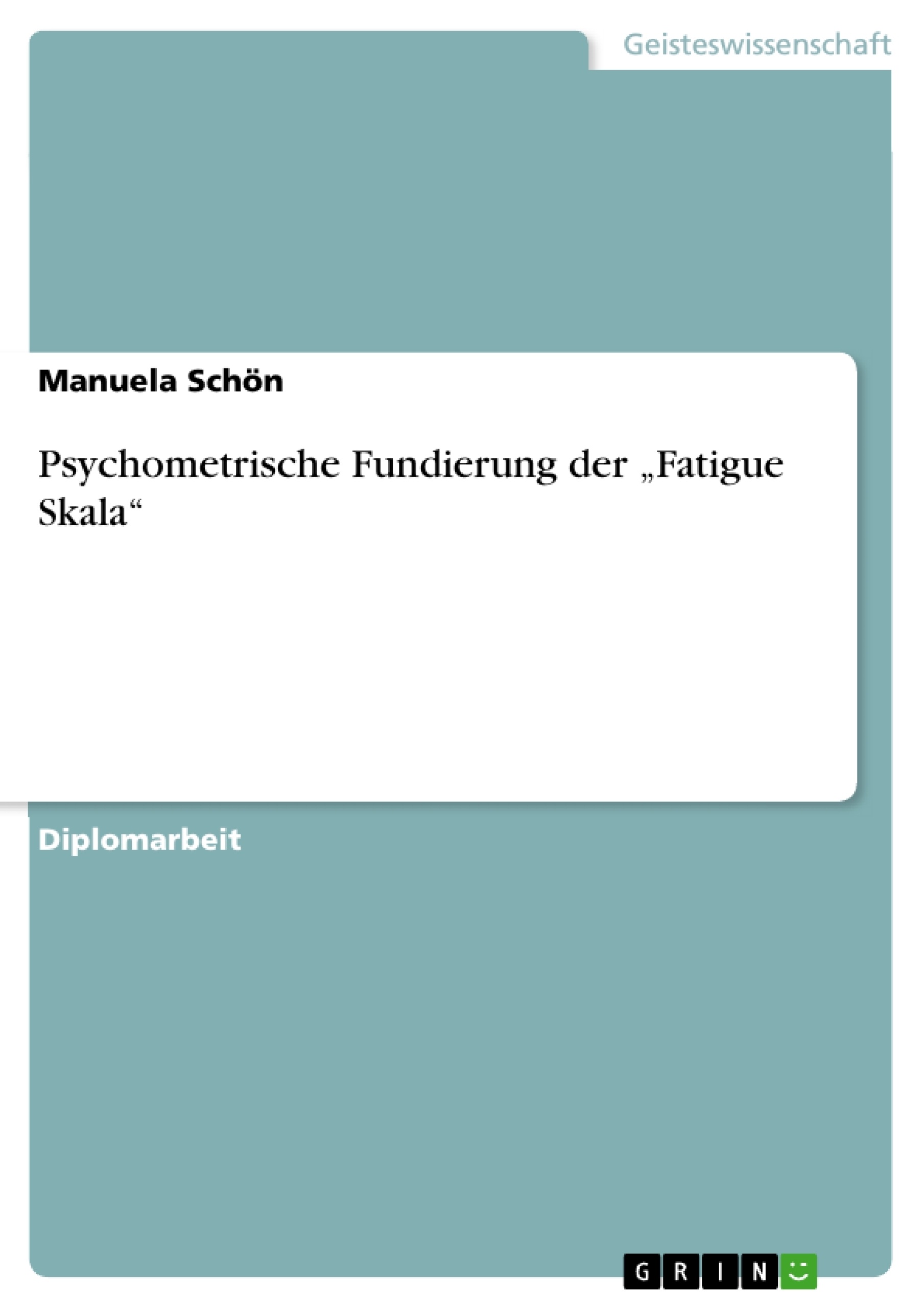Chronische Erschöpfung stellt als ein allgemein anerkanntes und häufig auftretendes Syndrom ein äußerst belastendes Problem sowohl im klinischen Bereich als auch in der Allgemeinbevölkerung dar.
Da sich die zuverlässige Erfassung verschiedener Erschöpfungssymptomatiken als schwierig erweist, wurden erst in den letzten Jahren einige Messinstrumente, vorwiegend in englischer Sprache, entwickelt. Als ein sehr gutes und international erfolgreich eingesetztes Messinstrument konnte sich die „Chalder Fatigue Scale“ in der Erschöpfungsdiagnostik etablieren. Die „Fatigue Skala“ (FS) stellt die deutsche Übersetzung dieses Messinstrumentes dar und soll dem Mangel an vergleichbaren und ausreichend evaluierten Instrumenten zur Erschöpfungserfassung im deutschen Sprachraum entgegenwirken.
Daher ist das Ziel dieser Arbeit die psychometrische Fundierung der Fatigue Skala.
Zu diesem Zweck wurde eine unspezifische klinische Stichprobe untersucht, indem zum einen das Strukturierte Klinische Interview für DSM-IV durchgeführt und zum anderen eine Fragebogenbatterie, bestehend aus der Fatigue Skala und acht weiteren Fragebögen, vorgelegt wurde.
Es ergaben sich eine interne Konsistenz gemessen über Chronbach´s von .94 und eine Test-Retest-Reliabilität von .90. Die Itemschwierigkeiten und -trenn-schärfen erwiesen sich als gut.
Die durchgeführte Hauptachsenanalyse ergab für eine Zweifaktorenlösung eine aufgeklärte Gesamtvarianz von 73,37%, wodurch die von den Autoren postulierte Faktorenstruktur als bestätigt angesehen werden kann. Allerdings klärte der erste Faktor bereits 61,85% der Varianz auf und beide Subskalen korrelierten mit r = .71 nicht unerheblich untereinander. Daher sollte die Zweifaktorenlösung gegenüber einem Generalfaktorenmodell abgewogen werden.
Die Konstruktvalidität der FS konnte belegt werden.
Die diskriminante Validität konnte dagegen nur teilweise durch den Vergleich mit zwei verschiedenen Depressionsmaßen gestützt werden.
Sensitivität und Spezifität der Fatigue Skala stellten sich als befriedigend heraus, wobei sich in der verwendeten Stichprobe ein etwas höher gewählter Cutoff-Wert von 5 oder 6 als sinnvoll erwies, um Sensitivität und Spezifität zu maximieren.
Es kann resümiert werden, dass die Fatigue Skala sich als ein zuverlässiger und valider Fragebogen zur Erfassung von Erschöpfungssymptomatiken erweisen konnte und somit ein vielversprechendes Instrument für den deutschen Sprachraum darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zusammenfassung
- 2 Einleitung
- 3 Hintergrund
- 3.1 Chronische Erschöpfung und Chronisches Erschöpfungssyndrom
- 3.1.1 Definition
- 3.1.2 Symptome
- 3.1.3 Gesunde vs. krankhafte Erschöpfung
- 3.1.4 Diagnostische Einordnung
- 3.1.5 Komorbidität und Differentialdiagnose
- 3.1.6 Epidemiologie
- 3.1.7 Beginn, Verlauf und Prognose
- 3.1.8 Ein integratives Störungsmodell
- 3.1.9 Diagnostisches Vorgehen
- 3.2 Diagnostische Verfahren
- 3.2.1 Interview
- 3.2.2 Verlaufsmessung
- 3.2.3 Fragebögen
- 3.2.3.1 Die Fatigue Severity Scale (FSS)
- 3.2.3.2 Die Schedule of Fatigue and Anergia (SOFA)
- 3.2.3.3 Die Checklist Individual Strengh (CIS)
- 3.2.3.4 Die Chalder Fatigue Scale (FQ/CFS/FS)
- 3.2.3.5 Der Fatigue Assessment Questionnaire (FAQ)
- 3.1 Chronische Erschöpfung und Chronisches Erschöpfungssyndrom
- 4 Forschungsintention und Fragestellung
- 4.1 Forschungsintention
- 4.2 Fragestellung und Hypothesen
- 5 Methode
- 5.1 Versuchspersonen
- 5.2 Instrumente
- 5.2.1 Diagnostisches Interview
- 5.2.1.1 Das SKID-I
- 5.2.1.2 Das Mini-DIPS
- 5.2.2 Fragenbogenkatalog
- 5.2.2.1 Der Soziodemographische Fragebogen
- 5.2.2.2 Das SOMS-7T
- 5.2.2.3 Die FS
- 5.2.2.4 Der FAQ
- 5.2.2.5 Der BDI-II
- 5.2.1 Diagnostisches Interview
- 5.3 Durchführung
- 5.4 Statistische Analysen
- 5.4.1 Skalenkonstruktion
- 5.4.2 Charakterisierung der Stichprobe
- 5.4.3 Reliabilitätsanalysen
- 5.4.4 Itemanalyse
- 5.4.5 Validitätsanalysen
- 5.4.5.1 Überprüfung der Faktoriellen Validität
- 5.4.5.2 Überprüfung der Konstruktvalidität
- 5.4.5.2.1 Güte der Schweregradskala: Überprüfung der konvergenten und diskriminanten Validität
- 5.4.5.2.2 Güte der Fallidentifikationsskala: Vergleich der FS mit verschiedenen Außenkriterien
- 5.4.5.2.3 Überprüfung der Konstruktvalidität anhand operationalisierter Hypothesen
- 5.4.5.3 Überprüfung der Kriteriumsvalidität
- 5.4.6 Analyse von Sensitivität und Spezifität
- 5.4.7 Berechnung von Prozenträngen
- 6 Ergebnisse
- 6.1 Charakterisierung der Stichprobe
- 6.1.1 Soziodemografische Deskription
- 6.1.2 Klinische Deskription
- 6.2 Reliabilität der FS
- 6.3 Itemanalyse
- 6.4 Validität
- 6.4.1 Faktorielle Validität
- 6.4.2 Güte der Schweregradskala
- 6.4.2.1 Konvergente Validität
- 6.4.2.2 Diskriminante Validität
- 6.4.3 Güte der Fallidentifikationsskala
- 6.4.3.1 Zusammenhang der FS mit dem Neurastheniemaβ
- 6.4.3.2 Zusammenhang der FS mit der Unspezifischen Somatoformen Störung
- 6.4.3.3 Zusammenhang der FS mit dem Depressionsmaß
- 6.4.4 Überprüfung der Konstruktvalidität anhand operationalisierter Hypothesen
- 6.4.5 Kriteriumsvalidität
- 6.5 Überprüfung von Sensitivität und Spezifität
- 6.6 Berechnung von Prozenträngen
- 6.7 Post-Hoc-Analysen
- 6.7.1 Analyse der Abweichungen zwischen den CF-Case-Variablen Test und Retest
- 6.7.2 Reanalysen des Zusammenhangs zwischen Erschöpfung und Neurasthenie
- 6.7.3 Reanalysen des Zusammenhangs zwischen FS und BDI
- 6.1 Charakterisierung der Stichprobe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt auf die psychometrische Fundierung der „Fatigue Skala“ ab. Es soll untersucht werden, ob die Skala die Anforderungen an ein zuverlässiges und valides Messinstrument erfüllt.
- Reliabilität der Fatigue Skala
- Validität der Fatigue Skala (faktorielle, konvergente, diskriminante, Kriteriumsvalidität)
- Zusammenhang der Fatigue Skala mit anderen relevanten Konstrukten (z.B. Depression, Neurasthenie)
- Sensitivität und Spezifität der Fatigue Skala
- Charakterisierung der Stichprobe
Zusammenfassung der Kapitel
3 Hintergrund: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über das Phänomen der chronischen Erschöpfung und des Chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS). Es beleuchtet Definitionen, Symptome, den Unterschied zwischen gesunder und krankhafter Erschöpfung, die diagnostische Einordnung, Komorbiditäten und Differentialdiagnosen. Epidemiologische Daten, Verlaufs- und Prognoseinformationen sowie ein integratives Störungsmodell werden präsentiert. Schließlich wird das diagnostische Vorgehen beschrieben, einschließlich verschiedener Verfahren wie Interviews, Verlaufsmessungen und Fragebögen (FSS, SOFA, CIS, CFS/FS, FAQ). Der Fokus liegt auf der Einordnung der "Fatigue Skala" in den Kontext bestehender diagnostischer Ansätze und der Beschreibung der relevanten Forschungsliteratur zum Thema Erschöpfung.
5 Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es werden die Stichprobenbeschreibung, die verwendeten Instrumente (diagnostische Interviews wie SKID-I und Mini-DIPS, Fragebögen wie den soziodemografischen Fragebogen, SOMS-7T, die Fatigue Skala (FS), FAQ und BDI-II) und das statistische Vorgehen (Skalenkonstruktion, Reliabilitäts-, Item- und Validitätsanalysen, Sensitivitäts- und Spezifitätsberechnung) erläutert. Die Beschreibung der Methoden ist umfassend und wissenschaftlich fundiert, um die Reproduzierbarkeit der Studie zu gewährleisten.
6 Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen. Es beginnt mit der Charakterisierung der Stichprobe hinsichtlich soziodemografischer und klinischer Merkmale. Anschließend werden die Ergebnisse zur Reliabilität der FS, der Itemanalyse, und der Validitätsprüfung (faktorielle, konvergente, diskriminante, Kriteriumsvalidität) detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Sensitivitäts- und Spezifitätsanalyse sowie die Berechnung von Prozenträngen schließen den Hauptteil ab. Zusätzlich werden Post-Hoc-Analysen zu Abweichungen zwischen Test und Retest, zum Zusammenhang von Erschöpfung und Neurasthenie, sowie zum Zusammenhang zwischen FS und BDI präsentiert. Die Ergebnisse werden präzise und übersichtlich dargeboten, um eine klare Interpretation zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Fatigue, Chronisches Erschöpfungssyndrom, Psychometrie, Reliabilität, Validität, Fragebogen, Skalenkonstruktion, Konstruktvalidität, Kriteriumsvalidität, Konvergente Validität, Diskriminante Validität, Sensitivität, Spezifität, Diagnostik, Epidemiologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Fatigue Skala
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der psychometrischen Evaluation der „Fatigue Skala“ (FS). Ziel ist es, die Reliabilität und Validität der Skala als Messinstrument für Fatigue (Erschöpfung) zu überprüfen.
Welche Aspekte der Fatigue Skala werden untersucht?
Die Studie untersucht verschiedene Aspekte der FS, darunter die Reliabilität (Zuverlässigkeit), die Validität (Gültigkeit – faktorielle, konvergente, diskriminante und Kriteriumsvalidität), den Zusammenhang mit anderen relevanten Konstrukten (z.B. Depression, Neurasthenie), sowie die Sensitivität und Spezifität der Skala. Darüber hinaus wird die Stichprobe umfassend charakterisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Zusammenfassung, Einleitung, ein Hintergrundkapitel (mit Definitionen, Symptomen und Diagnostik von chronischer Erschöpfung und CFS), ein Kapitel zur Forschungsintention und Fragestellung, ein Methodenkapitel (mit Beschreibung der Stichprobe, der verwendeten Instrumente und der statistischen Analysen), ein Ergebniskapitel (mit Darstellung der Reliabilitäts-, Validitäts- und weiteren Analysen) und ggf. Schlussfolgerungen und Diskussion.
Welche Instrumente wurden in der Studie verwendet?
Die Studie verwendet verschiedene diagnostische Interviews (SKID-I, Mini-DIPS), Fragebögen (soziodemografischer Fragebogen, SOMS-7T, Fatigue Skala (FS), FAQ, BDI-II) und statistische Verfahren (Skalenkonstruktion, Reliabilitätsanalysen, Itemanalysen, Validitätsanalysen (faktorielle, konvergente, diskriminante, Kriteriumsvalidität), Sensitivitäts- und Spezifitätsberechnung).
Welche Arten von Validität wurden untersucht?
Die Studie untersucht die faktorielle Validität (Faktorenstruktur der Skala), die konvergente Validität (Zusammenhang mit ähnlichen Maßen), die diskriminante Validität (Unterschied zu unähnlichen Maßen) und die Kriteriumsvalidität (Zusammenhang mit externen Kriterien) der Fatigue Skala.
Welche weiteren Konstrukte wurden in Beziehung zur Fatigue Skala gesetzt?
Die Fatigue Skala wurde in Beziehung zu anderen relevanten Konstrukten wie Depression und Neurasthenie gesetzt, um die Konstruktvalidität und den klinischen Nutzen der Skala zu untersuchen.
Wie wurde die Stichprobe charakterisiert?
Die Stichprobe wurde sowohl soziodemografisch (Alter, Geschlecht, etc.) als auch klinisch (z.B. Vorliegen von weiteren Erkrankungen) beschrieben.
Welche statistischen Analysen wurden durchgeführt?
Die statistischen Analysen umfassten die Skalenkonstruktion, Reliabilitätsanalysen, Itemanalysen, Validitätsanalysen (faktorielle, konvergente, diskriminante, Kriteriumsvalidität), die Berechnung von Sensitivität und Spezifität sowie die Berechnung von Prozenträngen. Zusätzlich wurden Post-Hoc-Analysen durchgeführt.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Fatigue, Chronisches Erschöpfungssyndrom, Psychometrie, Reliabilität, Validität, Fragebogen, Skalenkonstruktion, Konstruktvalidität, Kriteriumsvalidität, Konvergente Validität, Diskriminante Validität, Sensitivität, Spezifität, Diagnostik, Epidemiologie.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Ergebnissen?
Die Ergebnisse der Studie, einschließlich der Reliabilität, Validität und der Zusammenhänge mit anderen Konstrukten, sind im Kapitel „Ergebnisse“ detailliert beschrieben. Dieses Kapitel umfasst die Charakterisierung der Stichprobe, die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse, der Itemanalyse, sowie der verschiedenen Validitätsanalysen (faktorielle, konvergente, diskriminante, Kriteriumsvalidität), Sensitivität, Spezifität und Post-Hoc Analysen.
- Quote paper
- Manuela Schön (Author), 2008, Psychometrische Fundierung der „Fatigue Skala“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/163970