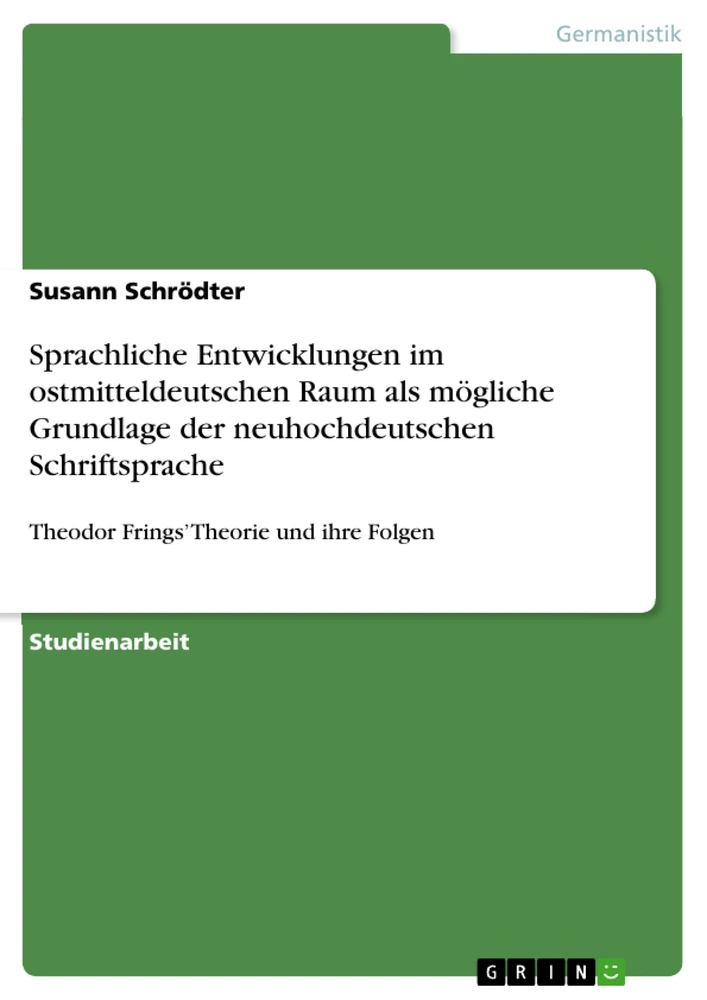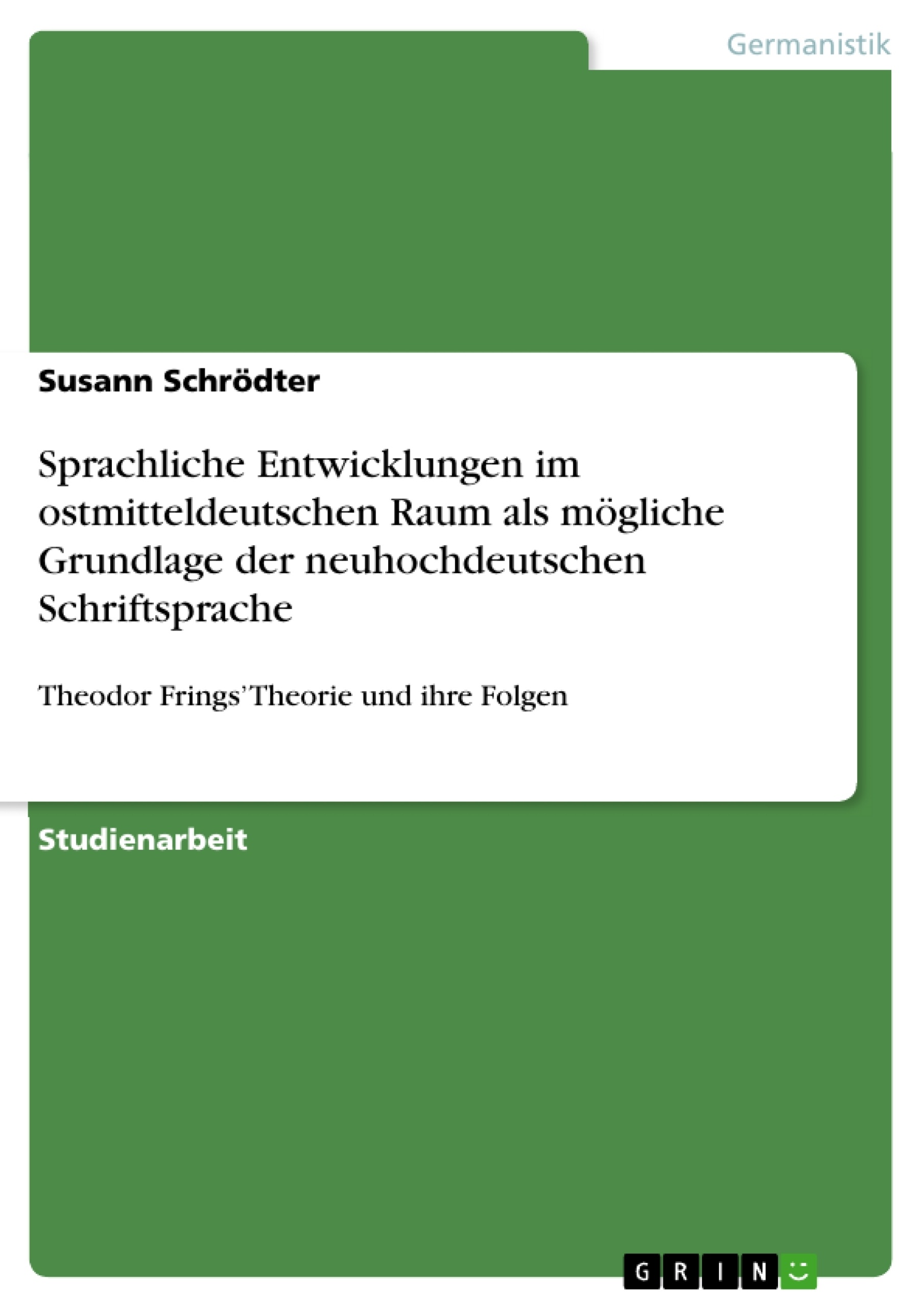Die umstrittene Frage nach dem Ursprung der neuhochdeutschen Schriftsprache beschäftigt die Germanisten seit vielen Jahren. Über die Entstehung des Neuhochdeutschen wurden im Laufe der Jahre zahlreiche Theorien aufgestellt.
Besonders interessant erscheinen in diesem Zusammenhang die völlig konträren Entstehungstheorien von Konrad Burdach und Theodor Frings.
Burdachs Theorie, in der dieser sich vor allem auf die deutschen Kanzleien beruft, galt über längere Zeit unanfechtbar. Widerlegt wurde sie erstmals von Theodor Frings, welcher der Theorie Burdachs eine völlig andere Betrachtungsweise entgegenstellte.
Theodor Frings wurde 1886 als Sohn eines Buchbinders in Dülken bei Krefeld geboren. Er promovierte 1911 in Marburg und habilitierte 1915 an der Universität in Bonn. Ab 1927 war er als Professor für Germanistik an der Universität Leipzig angestellt. Zu seinen Verdiensten gehört unter anderem der Entwurf eines komplett neuen Bildes vom Werdegang der neuhoch-deutschen Schriftsprache. „Zu einer von Frings’ Grundkonzeptionen gehört die Auffassung, daß Sprachgeschichte Menschheitsgeschichte im tiefsten Sinne des Wortes sei.“ Seine dialektgeographischen Untersuchungen zeigen deutlich, dass charakterisierende Eigenschaften der modernen deutschen Schriftsprache Gemeinsamkeiten mit der Meißner Mundart aufweisen. Der Ursprung der Schriftsprache liege demzufolge nicht in der Schriftlichkeit, sondern fundiere vielmehr auf mündlicher Ebene. Frings’ Theorie wurde in den Jahren nach ihrer Veröffentlichung stark kritisiert, doch leistet sie in der komplexen Frage nach dem Ursprung der neuhochdeutschen Schriftsprache einen unumstößlich wichtigen Beitrag, auf den man sich in den Folgejahren noch häufig berief.
Die folgenden Darstellungen dienen dazu, die wichtigsten Punkte von Frings’ Theorie sowie seine dialektgeographische Beweisführung aufzuzeigen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der kritischen Betrachtung seiner Thesen und deren Gegenüberstellungen zu neueren Forschungsansätzen. Wir konzentrieren uns diesbezüglich auf die Arbeiten von Werner Besch und Mirra Guchmann, da jenen anhand der gegen Frings geäußerten Kritikpunkte interessante Gegenentwürfe zu dessen Theorie gelungen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Meißner Deutsch als mögliche Grundlage der neuhochdeutschen Schriftsprache
- Zur Bedeutung der ostmitteldeutschen Besiedlungsgeschichte
- Die Entstehung der kolonialen Ausgleichssprache
- Die Entstehung einer Geschäfts- und Verkehrssprache
- Die Bedeutung Luthers
- Zwischenfazit
- Kritik der neueren Forschung
- Neuere Forschungsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text beschäftigt sich mit der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache und stellt die Theorie von Theodor Frings, welche den Ursprung der Schriftsprache in den ostmitteldeutschen Mundarten sieht, gegenüber neueren Forschungsansätzen. Der Text analysiert die Argumentation von Frings anhand seiner dialektgeographischen Untersuchungen und setzt seine Thesen in Relation zu den kritischen Ausführungen von Werner Besch und Mirra Guchmann.
- Die ostmitteldeutsche Besiedlungsgeschichte als Einflussfaktor auf die Sprachentwicklung
- Die Entstehung einer kolonialen Ausgleichssprache im ostmitteldeutschen Raum
- Die Rolle der Geschäfts- und Verkehrssprache im Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit
- Die Bedeutung Martin Luthers für die Standardisierung der Schriftsprache
- Die kritische Auseinandersetzung mit Frings' Theorie und die Präsentation neuerer Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach dem Ursprung der neuhochdeutschen Schriftsprache und führt die unterschiedlichen Entstehungs-theorien von Konrad Burdach und Theodor Frings ein. Besonderes Augenmerk liegt auf der Theorie von Theodor Frings, welche den Ursprung der Schriftsprache in der Mündlichkeit und den ostmitteldeutschen Mundarten sieht.
- Kapitel 2 analysiert die dialektgeographischen Untersuchungen von Frings, die auf den Einfluss der ostmitteldeutschen Besiedlungsgeschichte und die Entstehung einer kolonialen Ausgleichssprache im ostmitteldeutschen Raum hinweisen. Frings argumentiert, dass der Raum um Meißen durch die Mischung verschiedener Siedlerströme und die politische Macht der Wettiner eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Schriftsprache spielte.
- Kapitel 2.1 geht näher auf die Bedeutung der ostmitteldeutschen Besiedlungsgeschichte ein und beschreibt die verschiedenen Phasen der Kolonisation im ostmitteldeutschen Raum.
- Kapitel 2.2 beleuchtet die Entstehung der kolonialen Ausgleichssprache und betont den Einfluss politischer und wirtschaftlicher Aspekte. Die Ausbreitung des wettinischen Territoriums und die damit verbundenen Handelsbeziehungen spielten dabei eine wichtige Rolle.
- Kapitel 2.3 untersucht die Entstehung der Geschäfts- und Verkehrssprache als Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit. Die Bedeutung der Stadt Meißen als Zentrum des Handels und der Kultur im ostmitteldeutschen Raum wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes umfassen: neuhochdeutsche Schriftsprache, Theodor Frings, dialektgeographische Untersuchungen, ostmitteldeutsche Mundarten, koloniale Ausgleichssprache, Geschäfts- und Verkehrssprache, Besiedlungsgeschichte, Wettiner, Meißen, Martin Luther, Werner Besch, Mirra Guchmann.
- Quote paper
- Susann Schrödter (Author), 2010, Sprachliche Entwicklungen im ostmitteldeutschen Raum als mögliche Grundlage der neuhochdeutschen Schriftsprache , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/162723