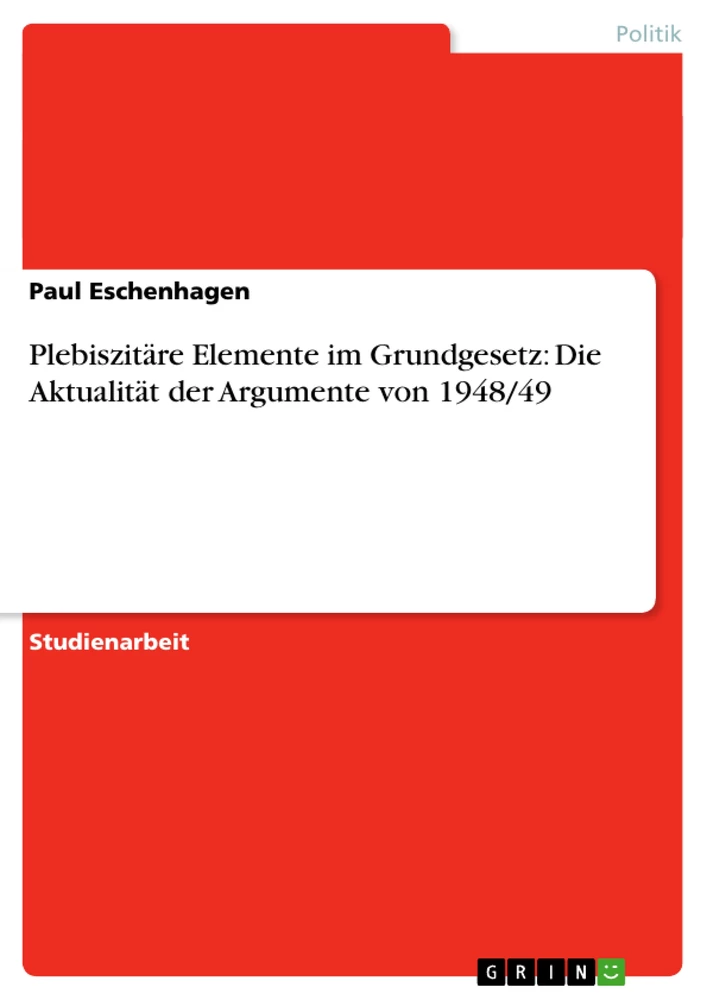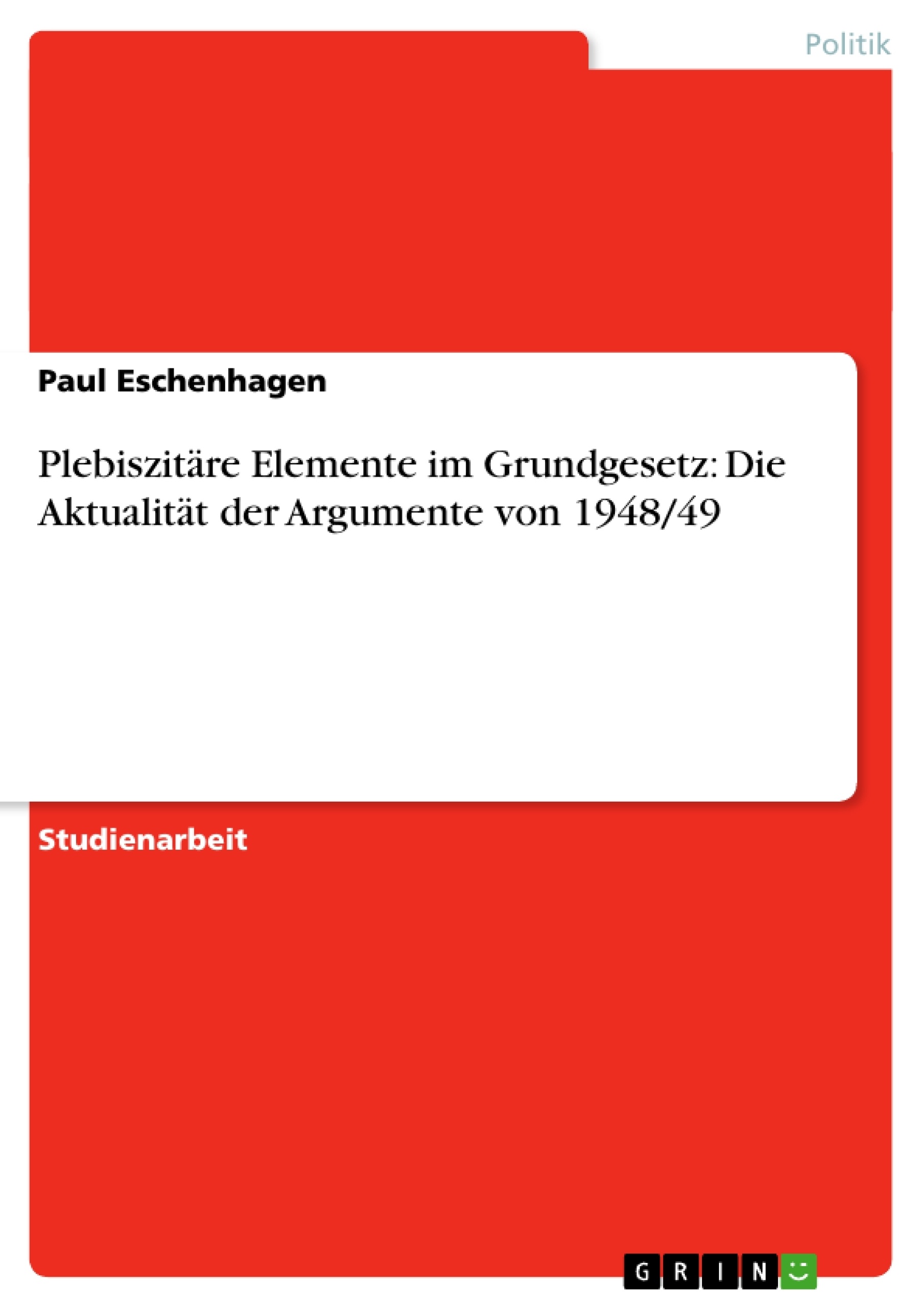Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Grundkurses „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ im Wintersemester 2002/03. Sie befasst sich mit den Argumenten des Parlamentarischen Rats von 1948/49 zur Gestaltung des Grundgesetzes als nahezu rein repräsentativer Verfassung.
Zunächst scheint eine Definition des Begriffs „plebiszitäre Elemente“ angebracht, um die Arbeit auch ohne großes Vorwissen verstehen zu können und um Missverständnissen vorzubeugen. Dann wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung plebiszitärer Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte, vor allem in der Weimarer Republik, gegeben. Im dritten Kapitel wird die Arbeit des Parlamentarischen Rats vorgestellt, der sich in seiner Argumentation, wie oft behauptet wird, direkt auf die Erfahrungen aus der Weimarer Republik bezog. Zunächst folgen in diesem Kapitel grundlegende Informationen über Rolle und Zusammensetzung des Parlamentarischen Rats sowie zur Entstehung des Grundgesetzes. Die weiteren Unterkapitel beschäftigen sich dann mit den einzelnen plebiszitären Elementen, unter dem Aspekt der Pro- und Contra-Argumente im Parlamentarischen Rat. Im weiteren wird dann auf die Diskussion zum Gesetzentwurf der rot- grünen Koalition von 2002 eingegangen, der das Grundgesetz um plebiszitäre Element erweitern sollte, um die Standpunkte der „modernen“ Politik mit denen von 1948/49 zu vergleichen. Zum Abschluss erfolgt die Erörterung der zentralen Frage: Sind die Argumente des Parlamentarischen Rates gegen plebiszitäre Elemente in der deutschen Verfassung heute noch überzeugend?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Definition: Plebiszitäre Elemente
- 2. Plebiszitäre Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte
- 2.1 Die Weimarer Reichsverfassung
- 2.2 Deutschland unter dem Nationalsozialismus
- 2.3 Die Bundesrepublik Deutschland
- 3. Der Parlamentarische Rat
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Das Gründungsplebiszit – Volksentscheid über das neue Grundgesetz?
- 3.3 Das Verfassungsreferendum – Darf das Volk die Verfassung ändern?
- 3.4 Die Volksgesetzgebung – Gesetze von Bürgern für Bürger?
- 3.5 Spezielle Volksabstimmungen – „Elternrecht“ und Territorialplebiszite
- 3.6 Artikel 20, Absatz 2 Grundgesetz – Basisnorm für direkte Demokratie?
- 3.7 Resümee – das deutsche Volk unter demokratischer Quarantäne
- 4. Die aktuelle politische Diskussion
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Argumente des Parlamentarischen Rates von 1948/49 gegen die Integration plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz und deren heutige Relevanz. Sie analysiert die historische Entwicklung plebiszitärer Elemente in Deutschland, insbesondere im Kontext der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Die Arbeit beleuchtet die Debatten des Parlamentarischen Rates zu verschiedenen Formen direkter Demokratie und vergleicht diese mit aktuellen politischen Diskussionen.
- Plebiszitäre Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte
- Die Argumentation des Parlamentarischen Rates zur Gestaltung des Grundgesetzes
- Vergleich der historischen und aktuellen Debatten um direkte Demokratie
- Bewertung der Aktualität der Argumente des Parlamentarischen Rates
- Analyse verschiedener Formen direkter Demokratie (Plebiszit, Referendum, Initiative)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Forschungsgegenstand: die Auseinandersetzung mit den Argumenten des Parlamentarischen Rates von 1948/49 bezüglich plebiszitärer Elemente im Grundgesetz und deren aktuelle Relevanz. Es wird die Struktur der Arbeit skizziert, die eine Definition plebiszitärer Elemente, einen historischen Überblick und die Analyse der Arbeit des Parlamentarischen Rates umfasst, sowie einen Vergleich mit aktuellen politischen Diskussionen. Der Zitat von Goethe unterstreicht die Bedeutung der Selbstregierung im Kontext der Arbeit.
1.2 Definition: Plebiszitäre Elemente: Dieses Kapitel definiert den Begriff "plebiszitäre Elemente" und unterscheidet zwischen verschiedenen Formen direkter Demokratie wie Plebisziten, Referenden und Initiativen nach Möckli (1991). Es wird die Unterscheidung zwischen bindenden und nicht bindenden Abstimmungen sowie die verschiedenen Arten der Auslösung von Abstimmungen (durch Staatsorgane oder Bürger) erläutert. Die Diskussion im Parlamentarischen Rat zu konkreten Beispielen, wie dem Gründungsplebiszit oder dem Verfassungsreferendum, wird angesprochen. Eine Abbildung veranschaulicht die verschiedenen Formen von Personen- und Sachabstimmungen.
2. Plebiszitäre Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung plebiszitärer Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte. Es beleuchtet die Erfahrungen der Weimarer Republik, wo plebiszitäre Elemente missbraucht wurden, und die Zeit des Nationalsozialismus, wo sie gänzlich unterdrückt wurden. Die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland wird ebenfalls betrachtet, um den historischen Kontext für die Entscheidungen des Parlamentarischen Rates zu schaffen. Die unterschiedlichen Erfahrungen mit direkter Demokratie in diesen Perioden bilden die Grundlage für die spätere Diskussion im Parlamentarischen Rat.
3. Der Parlamentarische Rat: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Arbeit des Parlamentarischen Rates und dessen Diskussionen über plebiszitäre Elemente im Grundgesetz. Es beschreibt die Rolle und Zusammensetzung des Rates und die Entstehung des Grundgesetzes. Die Unterkapitel analysieren die Argumente für und gegen verschiedene Formen der direkten Demokratie, wie das Gründungsplebiszit, das Verfassungsreferendum, die Volksgesetzgebung und spezielle Volksabstimmungen. Das Kapitel beleuchtet die Beweggründe des Rates, ein repräsentatives System zu bevorzugen und die damit verbundenen Vorbehalte gegenüber direkter Demokratie.
Schlüsselwörter
Grundgesetz, Plebiszit, Referendum, Volksabstimmung, Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Parlamentarischer Rat, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Verfassungsgeschichte, Politische Partizipation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Plebiszitäre Elemente im Grundgesetz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Argumente des Parlamentarischen Rates (1948/49) gegen die Integration plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz und deren heutige Relevanz. Sie untersucht die historische Entwicklung plebiszitärer Elemente in Deutschland, insbesondere im Kontext der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, und vergleicht historische und aktuelle Debatten um direkte Demokratie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen: plebiszitäre Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte; die Argumentation des Parlamentarischen Rates zur Gestaltung des Grundgesetzes; ein Vergleich historischer und aktueller Debatten um direkte Demokratie; eine Bewertung der Aktualität der Argumente des Parlamentarischen Rates; und eine Analyse verschiedener Formen direkter Demokratie (Plebiszit, Referendum, Initiative).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Struktur der Arbeit erläutert; ein Kapitel zur Definition plebiszitärer Elemente; ein Kapitel zur Entwicklung plebiszitärer Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte (Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik); ein Kapitel zur Arbeit des Parlamentarischen Rates und dessen Diskussionen über plebiszitäre Elemente im Grundgesetz; und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen sind enthalten.
Was sind plebiszitäre Elemente und wie werden sie definiert?
Die Arbeit definiert "plebiszitäre Elemente" und unterscheidet verschiedene Formen direkter Demokratie wie Plebiszite, Referenden und Initiativen. Es wird zwischen bindenden und nicht bindenden Abstimmungen und verschiedenen Arten der Auslösung von Abstimmungen unterschieden. Die Diskussion im Parlamentarischen Rat zu konkreten Beispielen wird behandelt.
Welche Rolle spielte der Parlamentarische Rat?
Das Kapitel über den Parlamentarischen Rat konzentriert sich auf dessen Diskussionen über plebiszitäre Elemente im Grundgesetz. Es analysiert die Argumente für und gegen verschiedene Formen der direkten Demokratie (Gründungsplebiszit, Verfassungsreferendum, Volksgesetzgebung, spezielle Volksabstimmungen) und die Beweggründe des Rates, ein repräsentatives System zu bevorzugen.
Welche historischen Erfahrungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die Erfahrungen mit plebiszitären Elementen in der Weimarer Republik (Missbrauch) und im Nationalsozialismus (Unterdrückung), um den historischen Kontext für die Entscheidungen des Parlamentarischen Rates zu schaffen. Die Entwicklung in der Bundesrepublik wird ebenfalls betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundgesetz, Plebiszit, Referendum, Volksabstimmung, Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Parlamentarischer Rat, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Verfassungsgeschichte, Politische Partizipation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Text nicht explizit zusammengefasst, jedoch lässt sich aus der Beschreibung der Kapitel schließen, dass die Arbeit die Argumente des Parlamentarischen Rates gegen plebiszitäre Elemente im Grundgesetz analysiert und deren heutige Relevanz bewertet, unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung und aktueller politischer Diskussionen.
- Quote paper
- Paul Eschenhagen (Author), 2003, Plebiszitäre Elemente im Grundgesetz: Die Aktualität der Argumente von 1948/49, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/16196