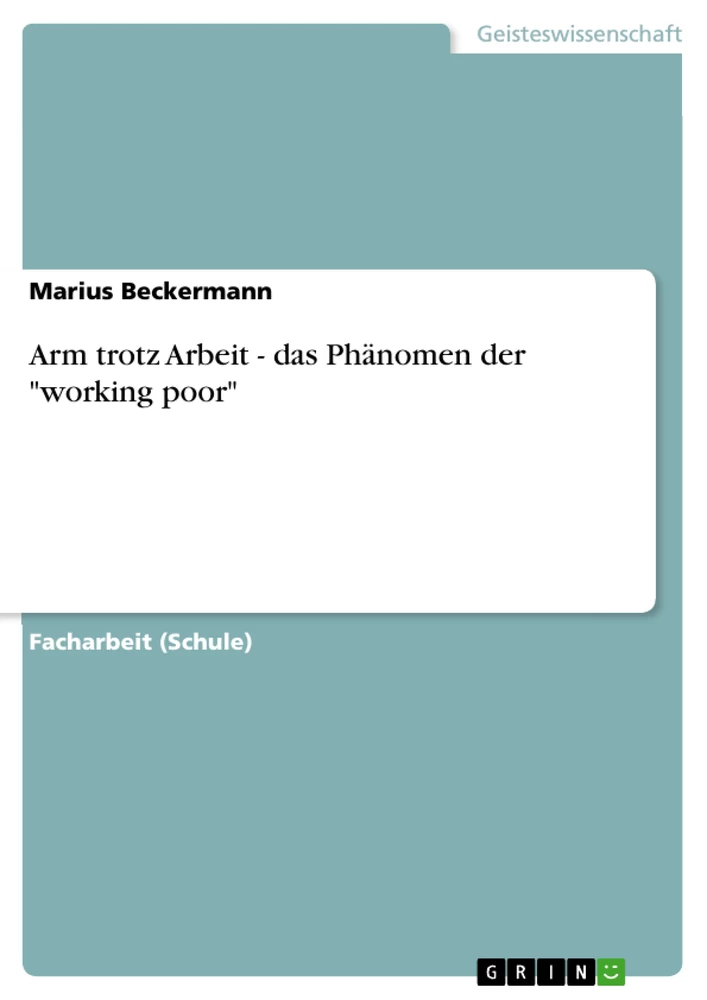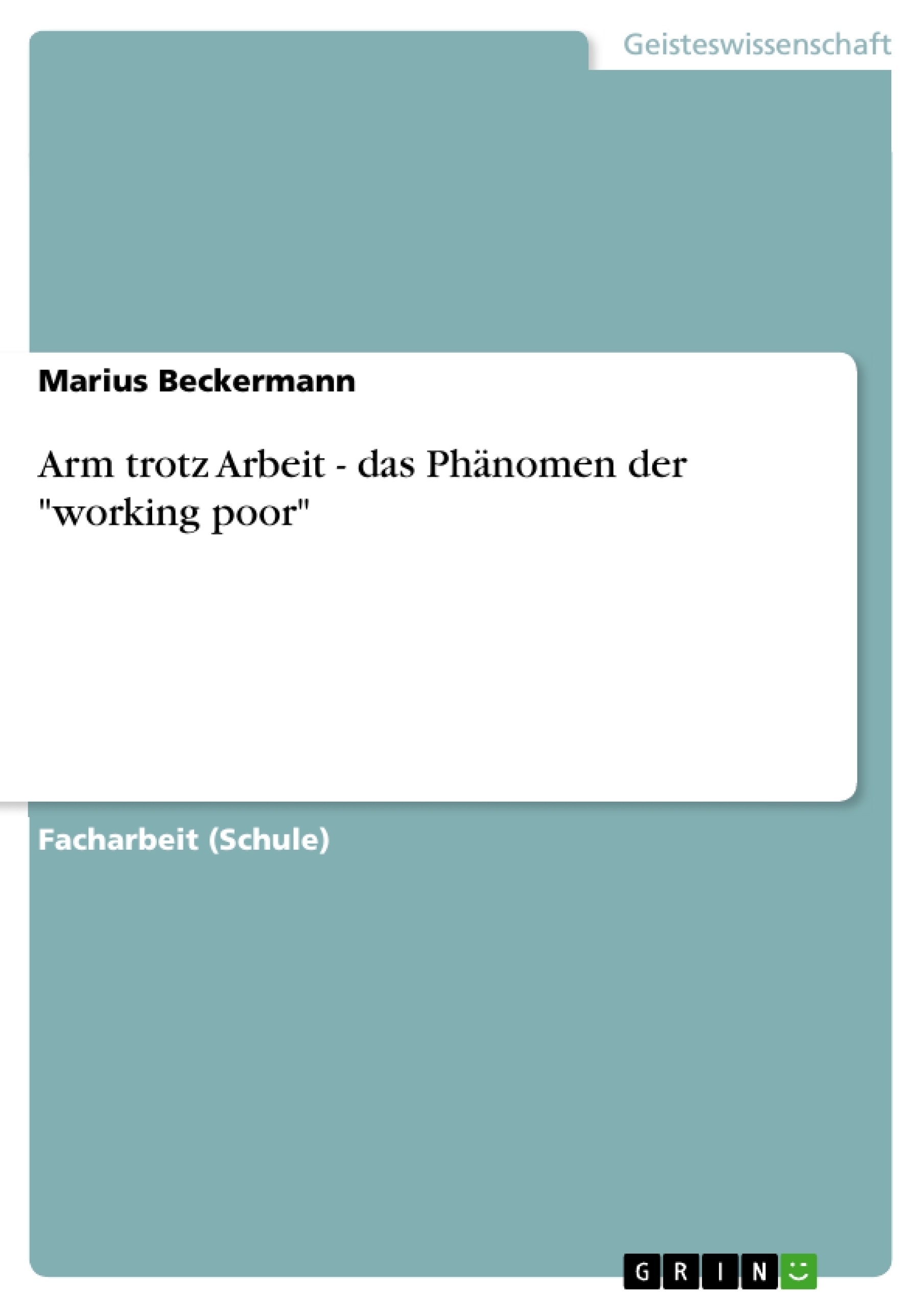Arm trotz Arbeit?! In diesem Satz scheint zunächst ein Widerspruch zu stecken. Armut: Damit assoziieren die meisten Menschen Obdachlose, Arbeitslose, Rentner und Alleinerziehende, also im Wesentlichen Personengruppen, die nicht erwerbstätig sind und deshalb nicht genug Geld zum Leben haben. Dass es aber auch Menschen gibt, die mit und trotz Arbeit arm sind, registrieren nicht nur in Deutschland recht Wenige als real existierendes Problem. Viele gehen wie selbstverständlich davon aus, dass Jemand, der arbeiten geht, auch genug finanzielle Mittel zum Leben zur Verfügung hat.
Armut trotz Erwerbstätigkeit, dieses im Amerikanischen als „working poor“ bezeichnete Phänomen, ist vor allem durch den US-amerikanischen Journalisten und Pulitzer-Preisträger David K. Shipler mit dessen Buch „The working poor“ (Shipler, 2005) geprägt und weltweit bekannt geworden. Shipler schildert den Alltag von erwerbstätigen Armen am Beispiel von einfachen Industriearbeitern, Servicekräften oder Erntehelfern in den USA. Inzwischen ist deutlich geworden: Das Phänomen „working poor“ ist kein ausschließlich US-amerikanisches Problem, sondern eines, das auch in den europäischen Wohlfahrtsstaaten vorzufinden ist. Dabei ist die Betrachtung der von Shipler beschriebenen hart arbeitenden, aber schlecht bezahlten Arbeitskräfte allerdings nur eine von vielen Seiten der „Armut von Erwerbstätigen“ (Lohmann, 2007, S. 11).
Ziel dieser Facharbeit ist es, zunächst einen Überblick darüber zu geben, was nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen heute unter „working poor“ in Deutschland zu verstehen ist. Zunächst wird dazu der Begriff „working poor“ selbst erläutert. Danach werden verschiedene Determinanten von Armut trotz Erwerbstätigkeit erörtert. Anhand eines Praxisbeispieles werden Auswirkungen von Armut trotz Erwerbstätigkeit dargelegt.
Nach der dann folgenden Darstellung und Diskussion unterschiedlicher Lösungsansätze zur Bekämpfung von „Armut trotz Erwerbstätigkeit“ folgt abschließend das Fazit mit einem Ausblick auf zukünftig anzugehende Problem- und Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- „Working poor“ – Eine Annäherung an den Begriff
- Determinanten von Armut trotz Erwerbstätigkeit
- Der Einfluss der Sozio-Demografie
- Faktor Alter
- Faktor Geschlecht
- Faktor Bildung
- Der Einfluss des Haushalts
- Der Einfluss der Erwerbstätigkeit
- Faktor Teilzeitjob
- Faktor Niedriglohn
- Faktor Selbstständigkeit
- Der Einfluss der Sozio-Demografie
- Auswirkungen der Erwerbsarmut gezeigt an einem Praxisbeispiel
- Lösungsansätze
- Existenzsichernde Lohnsubventionen
- Erhöhung der individuellen Löhne
- Mindestlöhne
- Erhöhung des Haushaltseinkommens
- Bedingungsloses Grundeinkommen
- Erwerbsförderung von Frauen
- Bildungs- und Qualifizierungsoffensive
- Existenzsichernde Lohnsubventionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht das Phänomen der „Working Poor“ in Deutschland. Ziel ist es, einen Überblick über den Begriff, die Ursachen und mögliche Lösungsansätze zu geben. Die Arbeit verzichtet auf die Präsentation eines Patentrezeptes zur Problemlösung.
- Begriffsbestimmung von „Working Poor“
- Faktoren, die zu Erwerbsarmut beitragen
- Auswirkungen von Erwerbsarmut
- Mögliche politische und gesellschaftliche Lösungsansätze
- Analyse der Problematik anhand von Praxisbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Armut trotz Erwerbstätigkeit vor und hebt den Widerspruch zwischen Arbeit und Armut hervor. Sie führt den Begriff „working poor“ ein, der aus den USA stammt, und betont, dass dieses Phänomen auch in Deutschland relevant ist. Das Ziel der Arbeit wird definiert: einen Überblick über den Begriff „working poor“, seine Determinanten, Auswirkungen und Lösungsansätze zu liefern.
„Working poor“ – Eine Annäherung an den Begriff: Dieses Kapitel nähert sich dem Begriff „working poor“ an. Es wird deutlich, dass eine einheitliche Definition schwierig ist, da sowohl „Armut“ als auch „Erwerbstätigkeit“ mehrdeutige Konzepte sind. Ältere Literatur gleichsetzte „working poor“ oft mit gering qualifizierten und niedrig bezahlten Jobs. Neuere Forschung betont jedoch den Einfluss des Haushaltskontextes und definiert Armut anhand aller verfügbaren Ressourcen, nicht nur des Erwerbseinkommens. Die Europäische Sozialcharta wird als Referenz für existenzsichernde Löhne genannt.
Determinanten von Armut trotz Erwerbstätigkeit: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Faktoren, die zu Erwerbsarmut beitragen. Es werden soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildung beleuchtet, sowie der Einfluss des Haushalts und der Art der Erwerbstätigkeit (Teilzeit, Niedriglohn, Selbstständigkeit).
Auswirkungen der Erwerbsarmut gezeigt an einem Praxisbeispiel: Dieses Kapitel beleuchtet die konkreten Auswirkungen von Erwerbsarmut anhand eines Praxisbeispiels. Die Details dieses Beispiels werden hier nicht weiter ausgeführt.
Lösungsansätze: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Lösungsansätze zur Bekämpfung von Erwerbsarmut. Es werden sowohl Maßnahmen zur Erhöhung der Löhne (z.B. Mindestlöhne, Lohnsubventionen) als auch Maßnahmen zur Erhöhung des Haushaltseinkommens (z.B. bedingungsloses Grundeinkommen, Erwerbsförderung von Frauen, Bildungsoffensive) betrachtet.
Schlüsselwörter
Working poor, Erwerbsarmut, Armut trotz Arbeit, Niedriglöhne, Teilzeitbeschäftigung, Soziodemografie, Haushaltseinkommen, Lösungsansätze, Mindestlohn, Existenzsicherung, Deutschland.
FAQ: Facharbeit: "Working Poor" in Deutschland
Was ist das Thema der Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht das Phänomen der „Working Poor“ in Deutschland. Sie beleuchtet den Begriff, die Ursachen und mögliche Lösungsansätze für Armut trotz Erwerbstätigkeit.
Was sind die Hauptziele der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über den Begriff „Working Poor“, seine Determinanten, Auswirkungen und Lösungsansätze zu liefern. Es wird kein Patentrezept zur Problemlösung präsentiert.
Wie wird der Begriff „Working Poor“ definiert?
Eine einheitliche Definition ist schwierig, da sowohl „Armut“ als auch „Erwerbstätigkeit“ mehrdeutig sind. Ältere Literatur assoziierte „Working Poor“ oft mit gering qualifizierten und niedrig bezahlten Jobs. Neuere Forschung betont den Einfluss des Haushaltskontextes und definiert Armut anhand aller verfügbaren Ressourcen.
Welche Faktoren tragen zu Erwerbsarmut bei?
Die Arbeit untersucht soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildung, den Einfluss des Haushalts und die Art der Erwerbstätigkeit (Teilzeit, Niedriglohn, Selbstständigkeit) als Determinanten von Erwerbsarmut.
Welche Auswirkungen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die konkreten Auswirkungen von Erwerbsarmut anhand eines Praxisbeispiels (Details werden nicht explizit genannt).
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Maßnahmen zur Erhöhung der Löhne (z.B. Mindestlöhne, Lohnsubventionen) und Maßnahmen zur Erhöhung des Haushaltseinkommens (z.B. bedingungsloses Grundeinkommen, Erwerbsförderung von Frauen, Bildungsoffensive).
Welche Kapitel umfasst die Facharbeit?
Die Facharbeit enthält ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsbestimmung von "Working Poor", ein Kapitel zu den Determinanten von Erwerbsarmut, ein Kapitel zu den Auswirkungen von Erwerbsarmut, ein Kapitel zu Lösungsansätzen und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Facharbeit?
Schlüsselwörter sind: Working poor, Erwerbsarmut, Armut trotz Arbeit, Niedriglöhne, Teilzeitbeschäftigung, Soziodemografie, Haushaltseinkommen, Lösungsansätze, Mindestlohn, Existenzsicherung, Deutschland.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die Arbeit beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, das die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auflistet.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Zusammenfassung der Facharbeit. Für detaillierte Informationen muss die vollständige Facharbeit konsultiert werden.
- Quote paper
- Marius Beckermann (Author), 2009, Arm trotz Arbeit - das Phänomen der "working poor", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161769