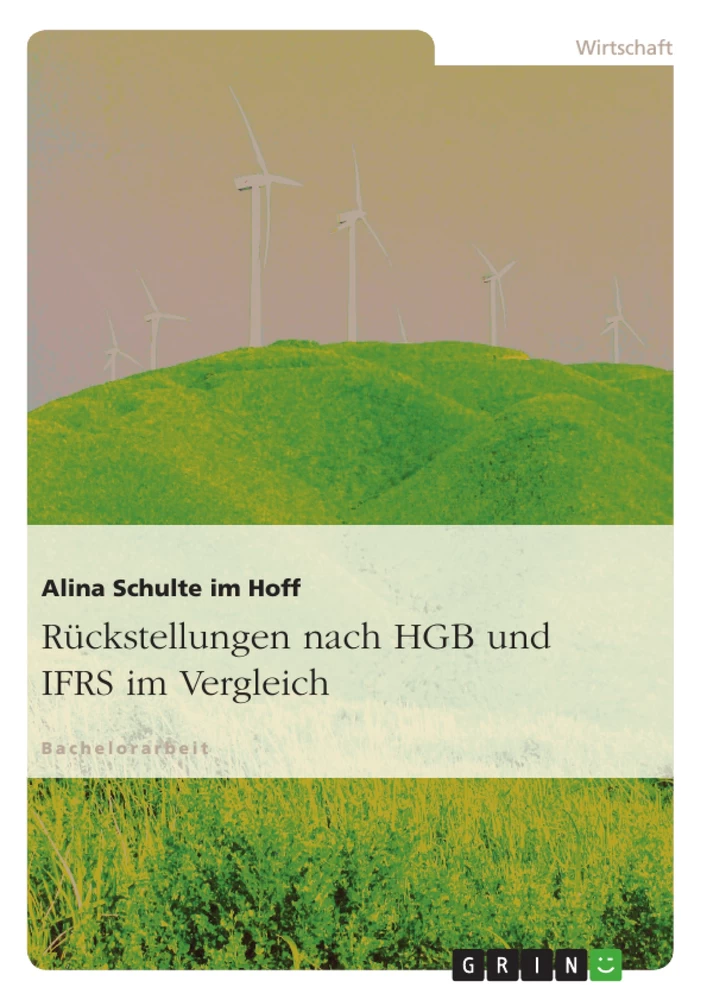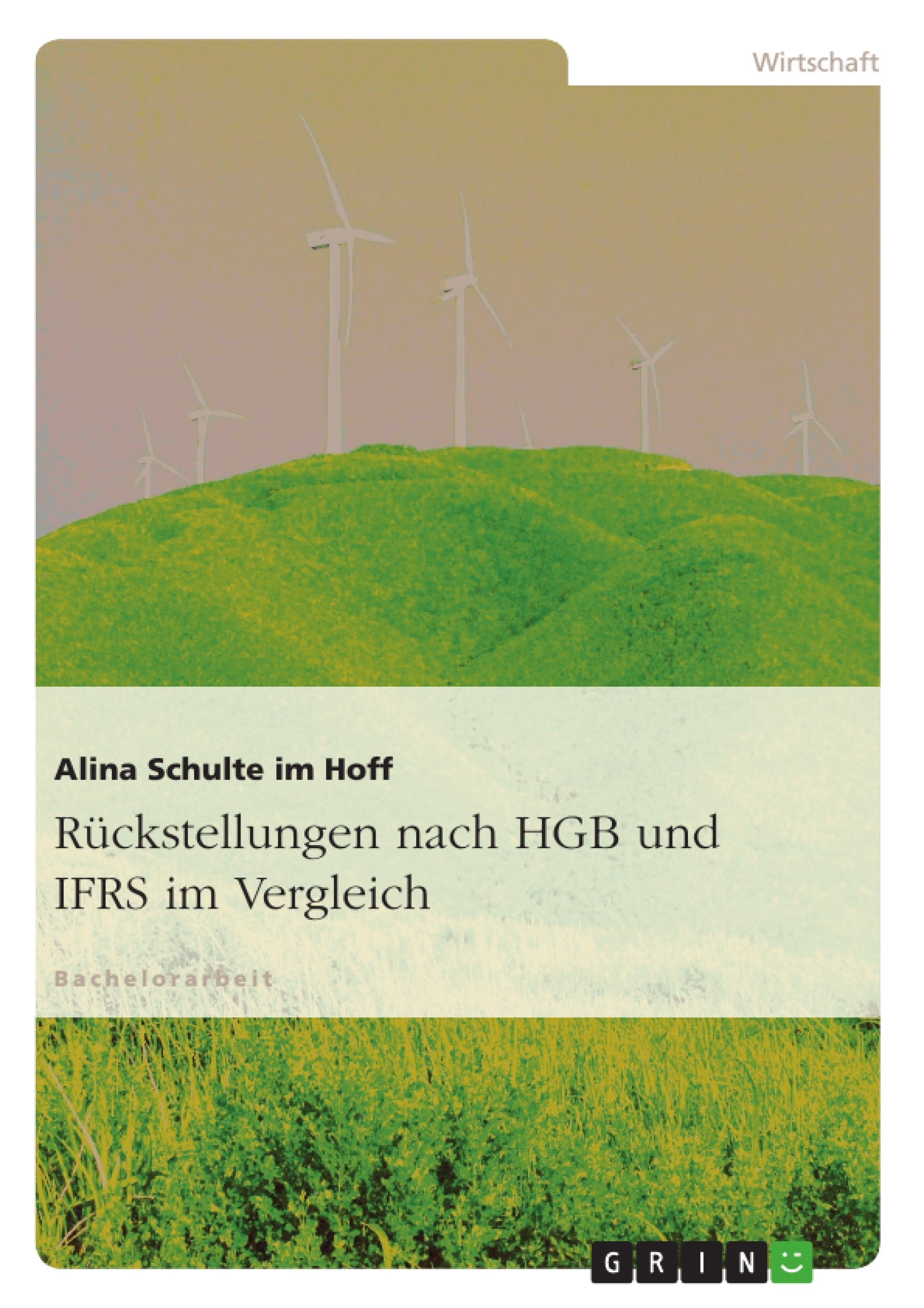Zu den größten Herausforderungen unserer Zeit gehört es, den Wohlstand zu sichern, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Um dies zu erreichen, setzen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und auch Unternehmen weltweit auf das Prinzip der Nachhaltigkeit.
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, international unter dem Stichwort sustainable development bekannt, hat sich zu einem zentralen Begriff entwickelt, anhand dessen über die zukünftige Entwicklung der Menschheit diskutiert wird. Es bezeichnet einen Prozess gesellschaftlicher Veränderung, bei dem der Begriff der Nachhaltigkeit, der als sustainability bezeichnet wird, das Ende eines solchen Prozesses, also einen Zustand beschreibt.
Nach der heute überwiegend akzeptierten Definition ist nachhaltige Entwicklung dann realisiert, wenn die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Das Konzept ist ein weltweit anerkanntes Leitbild in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Es zielt auf eine Umsteuerung auf globaler, nationaler und lokaler Ebene ab, um die Lebenssituation der heutigen Generation und die kommender Generationen zu verbessern. Gleichzeitig sollen die Lebens- und Entwicklungschancen erhöht werden.
Für Unternehmen bietet diese Entwicklung eine Vielzahl an Chancen und Herausforderungen. Ihr Blick richtet sich nicht mehr allein auf Produktionsprozesse, Produkte und technische Innovationen, sondern in zunehmenden Maße auf die Art und Weise, wie Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus genutzt werden und auf die Frage, inwieweit Produkte und Dienstleistungen global und dauerhaft übertragbare Konsum- und Lebensstile unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil A: Rückstellungen nach HGB
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung und Bedeutsamkeit der Thematik
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Statische und dynamische Bilanzinterpretation
- 2.1.1 Statische Bilanzinterpretation
- 2.1.2 Dynamische Bilanzinterpretation
- 2.1.3 Vergleich beider Bilanzinterpretationen
- 2.2 Allgemeine Definition einer Rückstellung
- 2.3 Gründe für die Bildung einer Rückstellung
- 2.4 Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Passivposten der Bilanz
- 2.4.1 Abgrenzung von Rückstellungen zu Verbindlichkeiten u. Eventualverbindlichkeiten
- 2.4.2 Abgrenzung von Rückstellungen zu Rechnungsabgrenzungsposten
- 2.4.3 Abgrenzung von Rückstellungen zu Rücklagen
- 2.4.4 Abgrenzung von Rückstellungen zu Wertberichtigungen
- 3. Ansatz von Rückstellungen nach dem HGB
- 3.1 Der Rückstellungskatalog des § 249 HGB
- 3.2 Ansatzkriterien für (Verbindlichkeits-) Rückstellungen nach dem HGB
- 3.2.1 Verpflichtung gegenüber einem Dritten
- 3.2.2 Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme
- 3.2.3 Wirtschaftliche Belastung am Bilanzstichtag
- 3.2.4 Quantifizierbarkeit der Rückstellungshöhe
- 3.3 Zeitpunkt der Rückstellungsbildung
- 4. Rückstellungsarten nach § 249 HGB
- 4.1 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 4.1.1 Schwebende Geschäfte
- 4.1.2 Relevanz von Drohverlustrückstellungen
- 4.1.3 Umfang des Saldierungsbereichs u. Reichweite des Einzelbewertungsgrundsatzes
- 4.2 Rückstellungen für Gewährleistungen, die mit und ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden
- 4.3 Aufwandsrückstellungen
- 4.3.1 Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung
- 4.3.2 Rückstellungen für Abraumbeseitigung
- 5. Auswirkungen und Beurteilung der novellierten Rechnungslegung
- 5.1 Kritik an der Passivierung von Aufwandsrückstellungen
- 5.1.1 Vorwurf der Auflösung von Aufwandsrückstellungen aufgrund von Planänderungen
- 5.1.2 Aufwandsrückstellungen sind als nicht GoB- konform anzusehen
- 5.1.3 Nicht hinzureichend nachprüfbare Sachverhalte
- 5.2 Argumente für die Passivierung von Aufwandsrückstellungen
- 5.2.1 Komponentenansatz nach IAS 16
- 5.2.2 Bilanzierung und Aufwandsverrechnung der unterschiedlichen Rechnungslegungssysteme anhand des Beispiels der Generalüberholung
- 6. Bewertung von Rückstellungen
- 6.1 Bewertung zum Erfüllungsbetrag unter Einbeziehung zukünftige Preis- und Kostenverhältnisse
- 6.2 Bewertungsgrundsätze bei Rückstellungen
- 6.3 Diskontierungsgebot
- 6.3.1 Durchschnittlicher Marktzins als Diskontierungsfaktor
- 6.3.2 Ausweis der Auf- und Abzinsung in der GuV
- Teil B: International Accounting Standard 37
- 7. Grundlagen des IAS 37
- 7.1 Zielsetzung und Anwendungsbereich des IAS 37
- 7.2 Einschränkungen des Anwendungsbereiches des IAS 37
- 7.3 Definition des Rückstellungsbegriffs des IAS 37.10
- 7.4 Abgrenzung von provisions zu other liabilities, accruals, contingent liabilities sowie contingent assets
- 7.4.1 Abgrenzung von Rückstellungen zu sonstigen Schulden
- 7.4.2 Abgrenzung von Rückstellungen zu abgegrenzten Schulden
- 7.4.3 Abgrenzung von Rückstellungen zu Eventualverbindlichkeiten
- 7.4.4 Abgrenzung von Rückstellungen zu Eventualforderung
- 8. Ansatz von Rückstellungen nach IAS 37
- 8.1 Einführung
- 8.2 Ansatzkriterien für (Verbindlichkeits)- Rückstellungen nach IAS 37
- 8.2.1 Verursachung einer gegenwärtigen Verpflichtung gegenüber Dritten durch ein Ereignis in der Vergangenheit
- 8.2.1.1 Gegenwärtige Verpflichtung
- 8.2.1.2 Außenverpflichtungen
- 8.2.1.3 Verpflichtung aufgrund eines Ereignisses in der Vergangenheit
- 8.2.1.4 Ansatzverbot für künftige betriebliche Verluste
- 8.2.2 Wahrscheinlicher Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen
- 8.2.3 Verlässliche Schätzbarkeit bzw. Ermittlung der Rückstellungshöhe
- 9. Ausgewählte Rückstellungsarten im Überblick
- 9.1 Restrukturierungsrückstellungen
- 9.1.1 Verkauf von Geschäftsbereichen
- 9.1.2 Bewertung von Restrukturierungsrückstellungen
- 9.2 Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen
- 9.3 Drohverlustrückstellungen
- 9.4 Aufwandsrückstellungen
- 10. Bewertung von Rückstellungen nach IAS 37
- 10.1 Bestmögliche Schätzung
- 10.1.1 Die Ermittlung der bestmöglichen Schätzung bei einmaligen Verpflichtungen
- 10.1.2 Die Ermittlung der bestmöglichen Schätzung bei einer Vielzahl gleichartiger Verpflichtungen mit gleichwahrscheinlichen Werten
- 10.1.3 Die Ermittlung der bestmöglichen Schätzung bei einer Vielzahl gleichartiger Verpflichtungen mit einer Bandbreite von nicht gleichwahrscheinlichen Werten
- 10.2 Weitere in die Schätzung einzubeziehende Faktoren
- 10.2.1 Zu berücksichtigende Risiken und Unsicherheiten bei der Bewertung
- 10.2.2 Künftige Ereignisse
- 10.2.3 Veräußerungsgewinne
- 10.2.4 Rückgriffs- und Erstattungsansprüche
- 10.3 Barwert
- 10.3.1 Risikoberücksichtigung
- 10.3.2 Fortlaufende Anpassung der Rückstellung
- 11. Geplante Neuregelungen bei der Bilanzierung von Rückstellungen nach IAS 37
- 11.1 Terminologie
- 11.2 Ansatzkriterien
- 11.3 Bewertung
- 11.4 Fazit
- 12. Fazit und kurze kritische Würdigung
- Definition und Abgrenzung von Rückstellungen
- Ansatzkriterien und Bewertungsgrundsätze nach HGB und IFRS
- Ausgewählte Rückstellungsarten wie Aufwandsrückstellungen und Restrukturierungsrückstellungen
- Kritik und Diskussion der aktuellen Rechnungslegungsvorschriften
- Geplante Neuregelungen im Bereich der Rückstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Rückstellungen nach HGB und IFRS. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungskriterien beider Rechnungslegungssysteme zu vergleichen und herauszustellen, welche Auswirkungen diese Unterschiede auf die Bilanzierung und Gewinnentwicklung von Unternehmen haben.
Zusammenfassung der Kapitel
In Teil A der Arbeit werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Rückstellungen nach HGB beleuchtet. Hierbei wird auf die statische und dynamische Bilanzinterpretation sowie auf die Abgrenzung von Rückstellungen zu anderen Passivposten eingegangen. Anschließend werden die Ansatzkriterien für Rückstellungen nach dem HGB erläutert, wobei insbesondere auf die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme und die Quantifizierbarkeit der Rückstellungshöhe eingegangen wird. Abschließend werden die wichtigsten Rückstellungsarten nach § 249 HGB dargestellt, darunter die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und die Aufwandsrückstellungen.
Teil B behandelt die Bilanzierung von Rückstellungen nach dem International Accounting Standard 37 (IAS 37). Nach der Einführung der Grundlagen des IAS 37 werden die Ansatzkriterien für Rückstellungen nach diesem Standard erläutert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der gegenwärtigen Verpflichtung gegenüber Dritten und der Wahrscheinlichkeit des Abflusses von Ressourcen. Anschließend werden verschiedene Rückstellungsarten im Überblick vorgestellt, darunter Restrukturierungsrückstellungen, Entsorgungs- und Rekultivierungsverpflichtungen sowie Aufwandsrückstellungen. Abschließend werden die Bewertungsgrundsätze nach IAS 37 dargestellt und die geplante Neuregelung im Bereich der Rückstellungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Rückstellungen im deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IFRS), insbesondere mit dem International Accounting Standard 37 (IAS 37). Wichtige Schlagwörter sind: Bilanzierung, Rückstellungen, HGB, IFRS, IAS 37, Ansatzkriterien, Bewertung, Aufwandsrückstellungen, Restrukturierungsrückstellungen, GoB-Konformität, Diskontierung, bestmögliche Schätzung, Eventualverbindlichkeiten.
- Quote paper
- Alina Schulte im Hoff (Author), 2010, Rückstellungen nach HGB und IFRS im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/161693