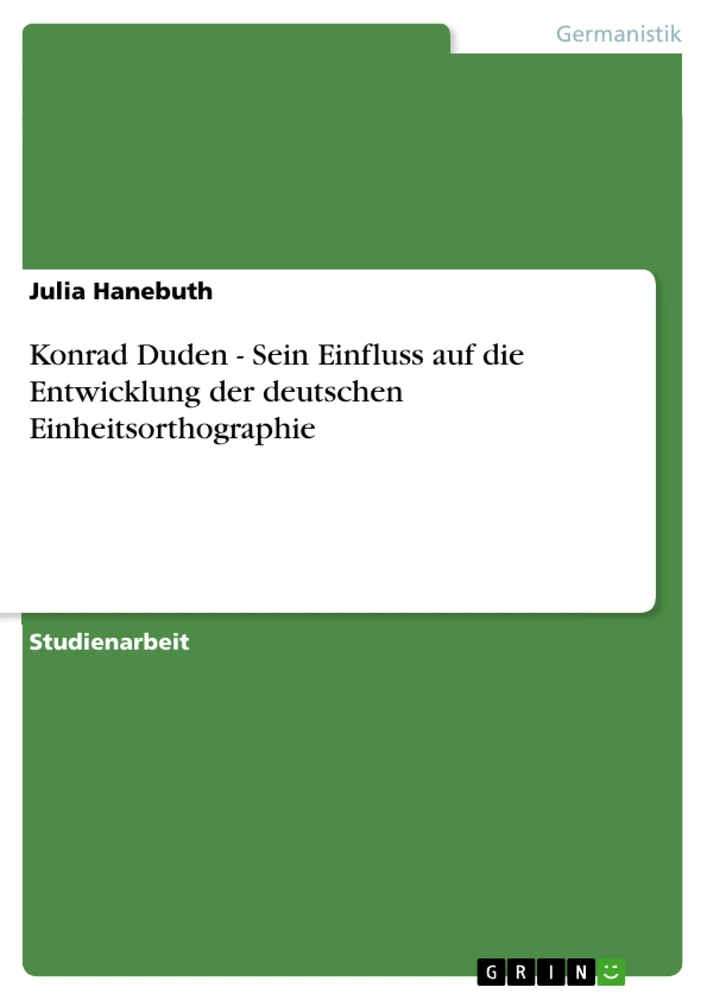Die geschriebene Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Kultur und aus der modernen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. In dieser Schriftlichkeit trägt nun eine einheitliche Orthographie erheblich zur Ökonomisierung der Kommunikation bei. In diesem Zusammenhang ist es beachtlich, dass erst seit dem Jahr 1901 eine amtlich normierte Rechtschreibung für den deutschen Sprachraum existiert, die ab 1903 für den Schulunterricht und den amtlichen Schriftverkehr als verbindlich erklärt wurde. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts lässt sich somit der Entwicklungsprozess zu einer deutschen Einheitsorthographie beschreiben, dessen Abschluss die sogenannte II. Orthographische Konferenz von 1901 bildet.
Bis in die heutige Gegenwart ist mit der deutschen Rechtschreibung der Name Konrad Duden (1829-1911) sehr eng verbunden. So schreibt Nerius (2007, S. 366), dass der Duden „das bekannteste und einflussreichste Orthographiewörterbuch der deutschen Sprache ist.“ Einige Autoren gehen sogar so weit, die einheitliche deutsche Orthographie als „sein Lebenswerk“ (Goldberg 2007, S. 93) zu bezeichnen, „die wir ihm verdanken“ (Drosdowski 1996, S. 16). Es wird also deutlich, dass Konrad Duden einen erheblichen Einfluss bei der Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie gehabt haben muss. Allerdings stellen sich folgende Fragen, die im Verlauf der vorliegenden Arbeit beantwortet werden sollen:
1.Welche Stellung nimmt Konrad Duden in der deutschen Orthographiegeschichte ein?
2.Konnte Konrad Duden seine eigenen Ziele erreichen, die er sich im Bereich der Orthographie gesetzt hat?
Um diese Untersuchung vornehmen zu können, werden in einem ersten Schritt Dudens orthographische Ziele dargestellt. Von diesem Punkt aus kann Dudens Mitwirken im Entwicklungsprozess zur deutschen Einheitsorthographie analysiert werden. In diesem Abschnitt der Arbeit soll auf der einen Seite der Weg sowie die letztendliche Durchsetzung der Einheitsorthographie orthographiehistorisch resümiert werden, auf der anderen Seite soll dieses Kapitel aber gleichzeitig Dudens Stellung innerhalb dieser Entwicklung und Abläufe zeigen. Das dritte Kapitel zielt also darauf ab, Dudens Wirken in die einzelnen Ereignisse der Orthographiegeschichte einzuordnen. Um beurteilen zu können, ob Duden seine orthographischen Ziele erreicht hat, wird darüber hinaus Dudens eigene Beurteilung der erreichten Einheitsorthographie dargestellt. In einem Fazit sollen die beiden Ausgangsfragen beantworten werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Konrad Dudens orthographische Ziele
- 3 Dudens Mitwirken im Entwicklungsprozess zur deutschen Einheitsorthographie
- 3.1 Auf dem Weg zu einer deutschen Einheitsorthographie
- 3.2 Erreichen der deutschen Einheitsorthographie
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss Konrad Dudens auf die Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie. Die Hauptfragestellungen sind: Welche Rolle spielte Duden in der deutschen Orthographiegeschichte, und konnte er seine orthographischen Ziele erreichen?
- Dudens orthographische Ziele und seine theoretischen Beiträge
- Der Entwicklungsprozess der deutschen Einheitsorthographie im 19. Jahrhundert
- Dudens Rolle in den orthographischen Konferenzen und Debatten
- Die Rezeption von Dudens Werk und seine langfristige Wirkung
- Bewertung von Dudens Erfolg bei der Durchsetzung seiner orthographischen Vision
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Einheitsorthographie und die zentrale Bedeutung Konrad Dudens ein. Sie stellt die Forschungsfragen nach Dudens Stellung in der Orthographiegeschichte und dem Erreichen seiner Ziele in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung einer einheitlichen Orthographie für die Kommunikation und verortet die Entwicklung der amtlich normierten Rechtschreibung im Kontext des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der Dudens orthographische Ziele darstellt und sein Mitwirken im Entwicklungsprozess zur Einheitsorthographie analysiert. Der Fokus liegt auf der Einordnung Dudens in die orthographiehistorischen Abläufe und der Beurteilung seines Erfolgs anhand seiner eigenen Bewertung der erreichten Einheitsorthographie.
2 Konrad Dudens orthographische Ziele: Dieses Kapitel beschreibt die orthographischen Ziele Dudens. Es analysiert seine Bemühungen um die Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung, ausgehend von seinen Erfahrungen am Schleizer Gymnasium, wo er 1869 begann, verbindliche Rechtschreibregeln zu formulieren. Die Veröffentlichung seiner Regeln im Jahresbericht des Gymnasiums und später sein Werk "Die deutsche Rechtschreibung" werden beleuchtet, wobei der Fokus auf der Darstellung der konkurrierenden Ansatzpunkte zur Regelung der deutschen Rechtschreibung liegt. Dudens Kritik am bestehenden "Übergangszustand" und seinen Lösungsansätzen wird ausführlich dargestellt und eingeordnet.
Schlüsselwörter
Konrad Duden, Einheitsorthographie, deutsche Rechtschreibung, Orthographiegeschichte, Orthographische Konferenzen, Rechtschreibregeln, Sprachvereinheitlichung, Philologie, 19. Jahrhundert.
FAQ: Konrad Dudens Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss Konrad Dudens auf die Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie. Sie befasst sich mit Dudens orthographischen Zielen, seiner Rolle im Entwicklungsprozess der Einheitsorthographie, seiner Beteiligung an orthographischen Konferenzen und Debatten, der Rezeption seines Werkes und der Bewertung seines Erfolgs bei der Durchsetzung seiner Vision.
Welche Fragestellungen stehen im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentralen Fragen sind: Welche Rolle spielte Duden in der deutschen Orthographiegeschichte, und konnte er seine orthographischen Ziele erreichen?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 beschreibt Dudens orthographische Ziele und analysiert seine Bemühungen um die Vereinheitlichung der deutschen Rechtschreibung. Kapitel 3 untersucht Dudens Mitwirken im Entwicklungsprozess zur deutschen Einheitsorthographie, inklusive der Weg zur und das Erreichen der Einheitsorthographie. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Konrad Duden, Einheitsorthographie, deutsche Rechtschreibung, Orthographiegeschichte, Orthographische Konferenzen, Rechtschreibregeln, Sprachvereinheitlichung, Philologie, 19. Jahrhundert.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Dudens orthographische Ziele und sein Mitwirken im Entwicklungsprozess zur Einheitsorthographie. Der Fokus liegt auf der Einordnung Dudens in die orthographiehistorischen Abläufe und der Beurteilung seines Erfolgs anhand seiner eigenen Bewertung der erreichten Einheitsorthographie.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die konkrete Quellenangabe ist nicht im bereitgestellten Text enthalten. Es wird jedoch auf Dudens eigene Werke ("Die deutsche Rechtschreibung" und der Jahresbericht des Schleizer Gymnasiums) und seine Beteiligung an orthographischen Konferenzen und Debatten hingewiesen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Geschichte der deutschen Rechtschreibung, die Rolle von Konrad Duden und den Prozess der Sprachvereinheitlichung interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen zu Konrad Duden und der Einheitsorthographie?
Weitere Informationen können in wissenschaftlichen Datenbanken, Bibliotheken und Fachliteratur zur Sprachgeschichte und Orthographie gefunden werden.
- Quote paper
- Julia Hanebuth (Author), 2009, Konrad Duden - Sein Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Einheitsorthographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160775