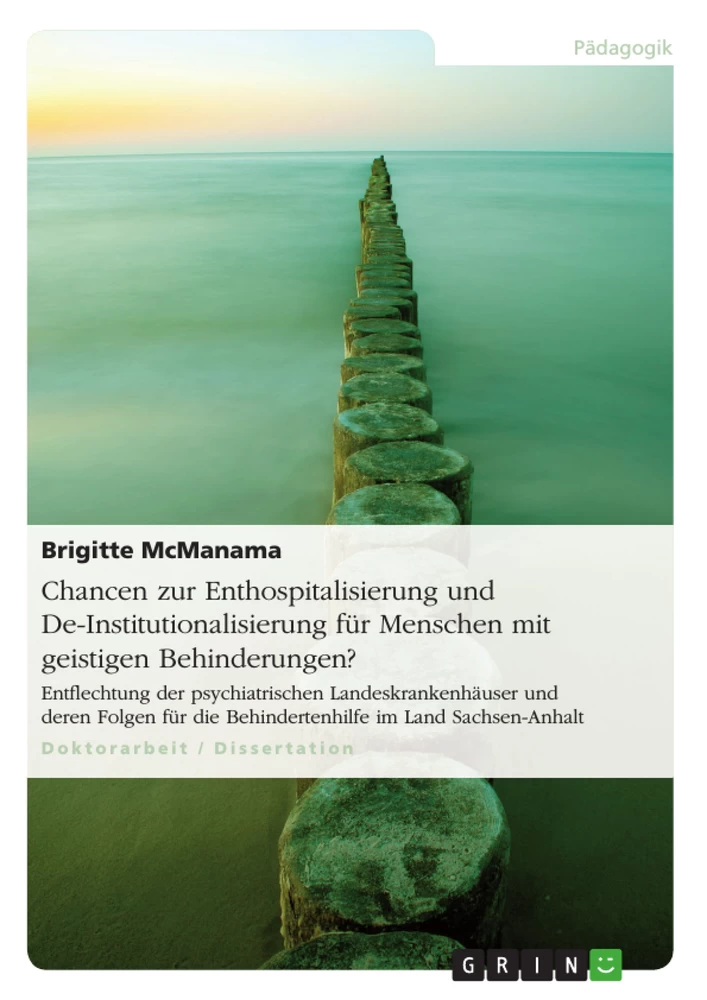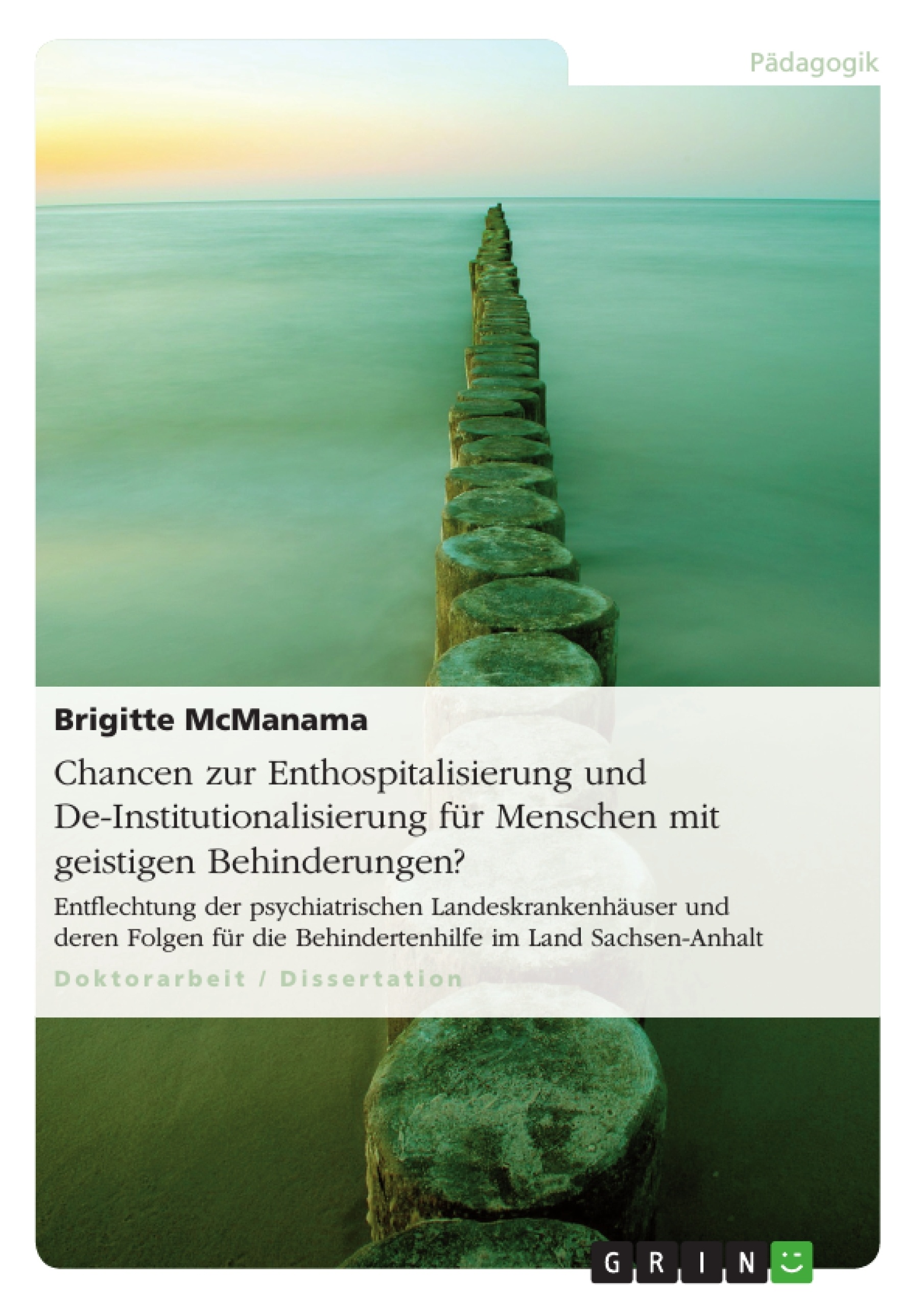Diese Arbeit ist ein Beitrag zur Dokumentation der Sozialgeschichte des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt von seiner Gründung 1991 bis 2006, in deren Mittelpunkt ehemalige DDR-BürgerInnen mit geistigen Behinderungen und das sie pflegende und betreuende Personal in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern nach der Wende stehen.
Es handelt sich um eine Epoche der Einführung des westdeutschen Sozialhilfesystems in Ablösung des DDR-Gesellschaftssystems, in der eigentlich die seit den 1960er Jahren propagierten Paradigmen der Behindertenhilfe umgesetzt werden sollten. Hierzu zählten vor allem individuelle und strukturelle Entpsychiatrisierungs-, De-Institutionalisierungs- und Enthospitalisierungsmaßnahmen, die zur Verwirklichung der Normalisierungsprinzipien und zur Integration behinderter Menschen beitragen sollten.
Es werden Faktoren beschrieben, die diesen Landesprozess - und den im LKH Uchtspringe im besonderen - beeinflusst und verhindert und welche Auswirkungen diese auf die betroffenen behinderten Menschen haben.
Neben einer Gegenstandsrelevanten Gegenüberstellung der historischen Momente zur Situation von Menschen mit geistigen Behinderungen in der DDR und der BRD, der Beleuchtung des Subsidiaritätsprinzips im Zusammenhang mit Reformen in der Behindertenhilfe und weiteren grundlegenden sozialwissenschaftlichen Grundlagen handelt sich um eine sehr differenzierte Dokumentation des Aufbaus der Sozialverwaltung mit dem Schwerpunkt der Behindertenhilfe in dem neuen Bundesland, der Auseinandersetzung mit der Psychiatriereform im Landtag und anderen politischen Gremien sowie des Verhaltens der Träger der Freien Wohlfahrtspflege. Letzteres wird explizit in der Beschreibung der Rolle der Diakonie in den dann letztlich gescheiterten Verhandlungen zur Übernahme des Heimbereiches am LKH Uchtspringe deutlich.
Neben einer Analyse des Prozesses erfolgt ein Ausblick auf die Konsequenzen der bisherigen Behindertenpolitik für die kommenden Jahre, in denen nun - zur Erfüllung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen - erneut Reformen eingeleitet werden müssen, die man bereits vor 20 Jahren hätte berücksichtigen müssen. Das Buch beinhaltet wichtige Hinweise, die für diese anstehenden Aufgaben dienlich sein können.
Es handelt sich um ein einzigartiges Werk zu dem Thema "Enthospitalisierung" und "De-Institutionalisierung", da von einer Autorin geschrieben, die sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich und praktisch mit diesem Anliegen befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Gegenstand und theoretischer Rahmen
- I.1 Forschungsmethoden und Betrachtungsansätze
- I.1.1 Personale Ebene
- I.1.2 Forschungsebene
- I.2 Klärung von Begrifflichkeiten und relevanten Paradigmen
- I.2.1 Enthospitalisierung, Entflechtung, Entpsychiatrisierung, De-Institutionalisierung
- I.2.2 Empowerment und Normalisierungsprinzipien versus Totale Institution
- I.3 Subsidiaritätsprinzip und Föderalismus – Auswirkungen auf die Behindertenhilfe
- I.4 Strukturelle Gewalt – Faktoren in der Behindertenhilfe
- I.5 Menschen mit geistigen Behinderungen
- I.5.1 Ausgangsdefinition
- I.5.2 Menschen mit geistigen Behinderungen in Abhängigkeit von Begrifflichkeiten, Diagnosen und kategorialen Einstufungen
- I.5.3 Einstufungsverfahren geistig behinderter Menschen in Sachsen-Anhalt:
- I.6 Historischer Hintergrund
- I.6.1 Institutionalisierung und Psychiatrisierung von Menschen mit Behinderungen im historischen Wandel, in der DDR und der BRD
- I.6.2 Exkurs über die gesellschaftspolitischen Epochen der DDR
- I.6.3 Der geistig behinderte Mensch in der DDR und in der BRD
- I.6.3.1 Die Versorgung von geistig behinderten Menschen in der DDR
- I.6.3.2 Übertragungsprozess des westdeutschen Sozialversicherungssystems
- I.6.3.3 Sozialrechtliche Absicherung von Menschen mit geistigen Behinderungen in der DDR und der BRD und Konsequenzen der Vereinigung der beiden deutschen Staaten für die Behindertenhilfe
- I.6.3.4 Das Gesundheitswesen der DDR in seiner Relevanz für Menschen mit geistigen Behinderungen
- I.6.3.5 Die Rolle der Diakonie in der Behindertenhilfe der DDR
- I.6.3.6 Betrachtung von „Geistiger Behinderung“ in Gesellschaft und Wissenschaft in der BRD und der DDR unter dem Aspekt der Bildung
- I.6.3.6.1 Wissenschaft, Bildung, Förderung
- I.6.3.6.2 Arbeit für Menschen mit geistigen Behinderungen
- I.6.3.7 Unterbringung von Menschen mit geistigen Behinderungen
- I.6.3.7.1 Unterbringung von Menschen mit geistigen Behinderungen in der BRD
- I.6.3.7.2 Einleitung von Enthospitalisierungsprozessen in Westdeutschland
- I.6.3.7.3 Die Lebensumstände in stationären Einrichtungen der DDR
- I.7 Empfehlungen der Psychiatrie-Enquête und weitere staatliche Leitgedanken zur „Enthospitalisierung“
- I.7.1 Psychiatrie-Enquête 1975
- I.7.1.1 Kommissionsverfahren und Entstehung der Psychiatrie-Enquête
- I.7.1.2 Zum Inhalt und Empfehlungen der „Psychiatrie-Enquête“
- I.7.1.3 Zur Umsetzung der Psychiatrie-Enquête
- I.7.2 Empfehlungen der Expertenkommission und Stellungnahme der Bundesregierung 1990
- I.7.3 Bericht (und Empfehlungen) der Bundesregierung über die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation von 1994
- I.7.4 Psychiatrieplan, 1992 und Leitlinien der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt von 1995
- I.8 Zusammenfassung Kapitel I im ausblickenden Zusammenhang mit den Kapiteln II und III
- II. Enthospitalisierungsprozess in Sachsen-Anhalt
- II.0 Die ersten ministeriellen subjektiven Eindrücke und Ansatzäußerungen
- II.1 Die für die Entflechtungs- und Enthospitalisierungsprozesse verantwortlichen Instanzen und Entscheidungskompetenzen
- II.1.1 Das Ministerium für Gesundheit und Soziales und seine nachgeordneten Behörden
- II.1.1.1 Akteure unter besonderen Aufbaubedingungen
- II.1.1.2 Enthospitalisierungsauftrag, administrative Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen
- II.1.1.3 Landesamt und Ämter für Versorgung und Soziales, Sozialämter
- II.1.2 Die für die Entflechtung und Enthospitalisierung wesentlichen politischen Organe und Gremien
- II.1.2.1 Landtag
- II.1.2.2 Petitionsausschuss
- II.1.2.3 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales / Sozialausschuss des Landtags
- II.1.3 Ausschuss für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung
- II.1.4 Träger der Freien Wohlfahrtspflege
- II.2 Programmatische Aussagen der Landesregierung zur psychiatrischen Versorgung im Land Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des „Enthospitalisierungsauftrages“
- II.2.1 1992: Programm und Bericht der Landesregierung zur psychiatrischen Versorgung im Land Sachsen-Anhalt
- II.2.1.1 Planungsäußerungen der Abteilung „Soziales“ Anfang der 1990er Jahre
- II.2.2 Leitlinien zur Entflechtung / Enthospitalisierung der Landeskrankenhäuser Haldensleben, Uchtspringe und Jerichow von 1995
- II.2.3 Prozessgestaltungsplanungen
- II.2.4 Besetzung von Leitungsstellen in den vorläufigen Heimbereichen
- II.3 Wissenschaftliche Begleitung
- II.3.1 Der Auftrag der wissenschaftlichen Begleitung
- II.3.2 Die von ISIS verwandte Definitionsgrundlage und herangezogenen Ansätze zur „Enthospitalisierung“
- II.3.3 Das Leistungsspektrum der wissenschaftlichen Begleitung durch ISIS
- II.3.3.1 Liste der „Analyse deutscher Enthospitalisierungsprozesse“
- II.3.3.2 BewohnerInnen-Erhebung
- II.3.3.3 MitarbeiterInnenbefragung:
- II.3.4 Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung durch ISIS
- II.3.4.1 Enthospitalisierungsplan nach ISIS
- II.3.4.2 Abschließende Faziterklärung durch ISIS (1998):
- II.3.5 Einschätzung der Auswirkungen der wissenschaftlichen Begleitung
- II.4 Ausgangssituation und Bestandsaufnahme in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern Sachsen-Anhalts 1990 - 1992
- II.4.1 Grundlagendaten zur Entflechtung und Enthospitalisierung im Land Sachsen-Anhalt
- II.4.2 Zur Anfangssituation in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern Bernburg, Haldensleben, Jerichow und Uchtspringe
- II.4.2.1 Selektion als erster Schritt zur Entflechtung und „Enthospitalisierung“
- II.5 Entflechtungsprocedere in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern in den Jahren 1991-1995
- II.5.1 Die Landeskrankenhäuser – ein Kurzüberblick
- II.5.1.1 LKH Uchtspringe
- II.5.1.2 LKH Bernburg
- II.5.1.3 LKH Haldensleben
- II.5.1.4 LKH Jerichow
- II.5.2 Die Landeskrankenhäuser zu Beginn der Entflechtungsprozesse
- II.5.2.1 Liegenschaften und Gebäudebestand
- II.5.2.2 Bettenanzahl und -verteilung
- II.5.3 Entflechtungsbedingungen und Konsequenzen für die Zugehörigen der vorläufigen Heimbereiche
- II.5.3.1 Personalsituation
- II.5.3.2 Planlose Umverlegungen von Langzeitpatientinnen und Personalkonsequenzen
- II.5.4 Übertragungsprozess der psychiatrischen Landeskrankenhäuser an Träger der Freien Wohlfahrtspflege
- II.5.4.1 Verhandlungen Ministerium – Liga der Freien Wohlfahrtsverbände
- II.5.4.1.1 Verhandlungsspezifika der einzelnen Landeskrankenhäuser
- II.5.4.2 Verhandlungskomplex: Personal und Trägerwechsel
- II.6 Entwicklungen der Behindertenhilfe außerhalb der Landeskrankenhäuser in Sachsen-Anhalt
- II.6.1 Schloß Hoym
- II.6.1.1 Entstehungsgeschichte und Trägerschaften
- II.6.1.2 Schloß Hoym im Nationalsozialismus und in der DDR
- II.6.1.3 Entflechtungs- und Enthospitalisierungsprozesse im Schloß Hoym
- II.6.1.3.1 Konzeptionelle Leitsätze
- II.6.1.3.2 Praktische Umsetzungsprozesse
- II.6.1.3.3 Personalentwicklung
- II.6.1.3.4 Platzabbau
- II.6.1.3.5 Entwicklungen auf dem Stammgelände
- II.6.1.3.6 Institutionelle Entwicklungen
- II.6.1.3.7 Resümee zu den Entwicklungen „Schloss Hoym“
- II.6.2 Neinstedter Anstalten
- II.6.2.1 Geschichtlicher Hintergrund
- II.6.2.2 Die Neinstedter Anstalten nach der Wende
- II.6.2.3 Resümee zu den Entwicklungen der Neinstedter Anstalten
- II.6.3 Entwicklungen weiterer Einrichtungen der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt
- II.6.3.1 Stationäre Unterbringung versus Betreutes Wohnen
- II.7 Kosten-Nutzen
- II.7.1 Finanzielle Förderung von Enthospitalisierungsmaßnahmen
- II.7.2 Regelfinanzierung – Novellierung des § 93 Abs.6 BSHG
- II.7.3 Der Rahmenvertrag gem. § 93d Abs.2 BSHG – Sachsen-Anhalt
- II.8 Entflechtungs- und Enthospitalisierungsprozesse in den ehemaligen psychiatrischen Landeskrankenhäusern Sachsen-Anhalts 1997 - 2006
- II.8.1 Datenerhebung der BewohnerInnen in den vorläufigen Heimbereichen an den psychiatrischen Krankenhäusern 1997
- II.8.2 Das Personal in den Heimbereichen der psychiatrischen Landeskrankenhäuser und in „Schloß Hoym“
- II.8.2.1 Personalentwicklungsmaßnahmen
- II.8.2.1.1 Hospitationsprogramm
- II.8.2.1.2 Weitere Fort-, Weiter- und Ausbildungsangebote
- II.9 Entwicklungen der Heimbereiche an den ehemaligen psychiatrischen Landeskrankenhäusern Jerichow und Haldensleben nach der Überleitung aus der Landesträgerschaft an Freie Träger
- II.9.1 Das psychiatrische Krankenhaus in Jerichow nach Übernahme durch die AWO Krankenhausbetriebsgesellschaft gGmbH Magdeburg
- II.9.2 Das psychiatrische Krankenhaus in Haldensleben nach der Übernahme durch das Dortmunder Christliche Sozialwerk GmbH und seine Nachfolger
- II.10 Kurzresümee
- III Entflechtungs- und Enthospitalisierungsprozesse am ehemaligen psychiatrischen Landeskrankenhaus Uchtspringe.
- III.1 Geschichte des Landeskrankenhauses Uchtspringe 1874-1990
- III.1.1 Von der Gründung bis zur Zeit des Nationalsozialismus 1894 – 1933
- III.1.2 Das Landeskrankenhaus Uchtspringe von 1933 bis 1949 und die interne Bewertung in der Zeit danach
- III.1.2.1 „Euthanasie“ im Landeskrankenhaus Uchtspringe
- III.1.3 Das Landeskrankenhaus Uchtspringe in der Zeit der DDR 1949 – 1990
- III.2 Das Landeskrankenhaus Uchtspringe nach der Wende
- III.2.1 Organisation und Zuständigkeiten 1991 – 1997
- III.2.2 Gebäudeverteilung auf dem Krankenhausgelände Uchtspringe
- III.2.2.2 Baulicher Zustand der Heimstationshäuser
- III.3 Das Diakonische Werk als potentieller Träger des vorläufigen Heimbereiches am psychiatrischen Landeskrankenhaus Uchtspringe
- III.4 Der Umstrukturierungs- und Überleitungsprozess Phase I: 1993 bis 1996
- III.4.1 Verhandlungen und Auseinandersetzungen mit der Diakonie
- III.4.1.1 Pädagogische Leitung - Enthospitalisierungsbeauftragte
- III.4.2 Erster Öffentlicher Protest der Uchtspringer Mitarbeiterschaft
- III.4.3 Aus der Not erwachsene Tugend: Erste Enthospitalisierungsmaßnahme durch Entstehung der ersten Wohngruppen im Heimbereich am Landeskrankenhaus Uchtspringe
- III.4.4 Weitergehende Protestaktionen und ihre Konsequenzen
- III.5 Übergangsphase 1996 – 1997
- III.5.1 Projektgruppe Uchtspringe
- III.5.2 „Kommissarische Übergangsphase“ im Heimbereich Uchtspringe
- III.5.2.1 Zeitplanung aufgrund grober statistischer Bewohnerdaten im Juli 1996
- III.5.3 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- III.5.3.1 Kinder und Jugendliche ziehen in eine WG der Caritas in Letzlingen
- III.5.3.2 Erwachsene ziehen in ein Wohnheim der Caritas nach Gardelegen
- III.5.3.3 Erste Erwachsene ziehen ins Schloss Vinzelberg der Stiftung Uhlebüll
- III.5.3.4 Kritikäußerungen zur Trägerauswahl
- III.6 Der Umstrukturierungsprozess Teil II: 1997 – 2006
- III.6.1 Rechtsformänderung – Gründung der SALUS
- III.6.1 Reaktionen auf die Rechtsformänderung
- III.7 Entwicklungen des SALUS-Heimverbundes in der Nachfolge des „vorläufigen Heimbereiches am Landeskrankenhaus Uchtspringe“
- III.8.1 Bildung weiterer Wohngruppen, Außenwohngruppen und eines dezentralen Wohnheimes sowie Erweiterung des Leistungsspektrums
- III.8.2 Selbstbestimmung – Mitbestimmung der HeimbewohnerInnen
- III.8.3 Personalentwicklung im SALUS-Heimverbund
- III.9 Reflektiver Erfahrungsaustausch 10 Jahre nach dem Auszug aus Uchtspringe
- III.9.1 Frauen der ersten Uchtspringer WG im Intensiv betreuten Wohnen in Gardelegen
- III.9.2 Ehemalige Uchtspringer BewohnerInnen im Wohnheim Vinzelberg, Caritaswohnheim „Friedrich Lorenz“, Beetzendorf und Chausseehaus Hassel
- III.9.2.1 Wohnheim Vinzelberg
- III.9.2.2 Caritaswohnheim „Friedrich Lorenz“, Beetzendorf
- III.9.2.3 Chausseehaus Hassel
- III.9.2.4 MitarbeiterInnen-Berichte über die BewohnerInnenentwicklungen nach dem gemeinsamen Wechsel in Heime anderer Träger
- III.9.3 Wie MitarbeiterInnen ihren eigenen Arbeitsplatzwechsel im Rahmen der Entflechtungsprozesse des Heimbereiches Uchtspringe erlebt haben und bewerten
- III.9.4 Wie langjährige Uchtspringer MitarbeiterInnen die Entwicklungen des SALUS-Heimverbundes bewerten
- III.9.5 Außenwohngruppe Jävenitz - Ergebnisse einer Begleituntersuchung durch ISIS
- III.10 Zusammenfassende Bewertung des 15 jährigen Entflechtungsprozesse „Heimbereich am psychiatrischen Krankenhaus Uchtspringe“
- IV. Bewertende Analyse und Resümee
- IV.1 Betrachtungsschwerpunkte
- IV.2 Handlungsdruck und Übertragung des westdeutschen Systems auf die neuen Bundesländer
- IV.3 Zum Vorwurf der westdeutschen Kolonialisierung
- IV.4 Auswirkungen der „Wende“ auf das Personal in den Landeskrankenhäusern
- IV.5 Verwaltungsstrukturen und Kompetenzen
- IV.6 Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip und die Rolle der Träger der Freien Wohlfahrtsverbände
- IV.7 Resumee und Ausblick
- Die Auswirkungen der 1:1-Übertragung des westdeutschen Psychiatriesystems auf Sachsen-Anhalt.
- Die Rolle des Subsidiaritätsprinzips und der Freien Wohlfahrtsverbände bei der Enthospitalisierung.
- Die Herausforderungen der Personalentwicklung und -qualifizierung im Kontext des Wandels.
- Die Bedeutung struktureller Gewalt und ihre Auswirkungen auf Menschen mit geistigen Behinderungen.
- Der Vergleich der Versorgungsstrukturen in der DDR und der BRD.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert und analysiert die ersten 15 Jahre der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt nach der Wende, mit Fokus auf die Enthospitalisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Erfolge des Prozesses zu beleuchten und die Faktoren zu identifizieren, die den Übergang von Großinstitutionen zu dezentralen Wohnformen beeinflusst haben.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die Motivation der Autorin, ihre Erfahrungen im Aufbau der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt zu dokumentieren und zu reflektieren. Es skizziert ihren Werdegang in verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland, und hebt die Herausforderungen und die besonderen Bedingungen des Wandels nach der Wende hervor.
I. Gegenstand und theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel beschreibt den Gegenstand der Arbeit, die Entwicklung der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt nach der Wende, mit besonderem Fokus auf die Enthospitalisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Es stellt die Forschungsmethoden und den theoretischen Rahmen dar, einschließlich der Klärung von Begrifflichkeiten wie Enthospitalisierung, Entflechtung und De-Institutionalisierung.
II. Enthospitalisierungsprozess in Sachsen-Anhalt: Dieses Kapitel beschreibt den Enthospitalisierungsprozess in Sachsen-Anhalt von 1990 bis 2006, einschließlich der beteiligten Instanzen, Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen. Es analysiert die programmatischen Aussagen der Landesregierung, die Herausforderungen der wissenschaftlichen Begleitung und die konkreten Entwicklungen in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern und anderen Einrichtungen.
III. Entflechtungs- und Enthospitalisierungsprozesse am ehemaligen psychiatrischen Landeskrankenhaus Uchtspringe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Prozesse am Landeskrankenhaus Uchtspringe. Es beschreibt die Geschichte der Einrichtung, die Herausforderungen des Umstrukturierungsprozesses, die Rolle der Diakonie, die Konflikte mit dem Personalrat und die Entwicklung von alternativen Wohnformen.
Schlüsselwörter
Enthospitalisierung, De-Institutionalisierung, Sachsen-Anhalt, geistige Behinderung, Psychiatrie-Reform, freie Wohlfahrtspflege, Subsidiaritätsprinzip, strukturelle Gewalt, DDR, BRD, Integration, Normalisierung, Personalentwicklung, Wohnformen, Qualitätssicherung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Enthospitalisierungsprozesse in Sachsen-Anhalt
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit dokumentiert und analysiert die ersten 15 Jahre der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt nach der Wende, mit besonderem Fokus auf die Enthospitalisierung von Menschen mit geistigen Behinderungen. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge dieses Prozesses und identifiziert die Einflussfaktoren auf den Übergang von Großinstitutionen zu dezentralen Wohnformen.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum von 1990 bis 2006, also die ersten 15 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt.
Welche konkreten Aspekte der Enthospitalisierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Übertragung des westdeutschen Psychiatriesystems auf Sachsen-Anhalt, die Rolle des Subsidiaritätsprinzips und der Freien Wohlfahrtsverbände, die Herausforderungen der Personalentwicklung und -qualifizierung, die Bedeutung struktureller Gewalt und den Vergleich der Versorgungsstrukturen in der DDR und der BRD.
Welche Institutionen und Akteure werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit beinhaltet eine Analyse verschiedener Institutionen, darunter das Ministerium für Gesundheit und Soziales, das Landesamt für Versorgung und Soziales, der Landtag, der Petitionsausschuss, Träger der Freien Wohlfahrtspflege (z.B. Diakonie, AWO, Caritas) sowie die psychiatrischen Landeskrankenhäuser (Bernburg, Haldensleben, Jerichow, Uchtspringe) und Einrichtungen wie Schloss Hoym und die Neinstedter Anstalten.
Welche konkreten Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine umfassende Literaturrecherche mit der Auswertung von Dokumenten, Statistiken und Berichten. Sie stützt sich auf Interviews und Erfahrungsberichte von Betroffenen und Mitarbeitern. Die wissenschaftliche Begleitung durch ISIS spielte dabei eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Enthospitalisierung, De-Institutionalisierung, geistige Behinderung, Psychiatrie-Reform, freie Wohlfahrtspflege, Subsidiaritätsprinzip, strukturelle Gewalt, DDR, BRD, Integration, Normalisierung, Personalentwicklung, Wohnformen, und Qualitätssicherung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel I behandelt den theoretischen Rahmen und die methodischen Ansätze. Kapitel II beschreibt den Enthospitalisierungsprozess in Sachsen-Anhalt im Allgemeinen. Kapitel III konzentriert sich auf den konkreten Fall des Landeskrankenhauses Uchtspringe. Kapitel IV bietet eine zusammenfassende Bewertung und einen Ausblick.
Welche Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit liefert detaillierte Einblicke in den komplexen Prozess der Enthospitalisierung in Sachsen-Anhalt. Sie analysiert die Herausforderungen und Erfolge, die positiven und negativen Folgen der 1:1 Übernahme des westdeutschen Systems und die Rolle verschiedener Akteure. Die konkreten Schlussfolgerungen werden im letzten Kapitel zusammengefasst.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studenten, Praktiker in der Behindertenhilfe, politische Entscheidungsträger und alle, die sich für die Geschichte und Entwicklung der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt interessieren.
Wo kann man die vollständige Arbeit einsehen?
Die genaue Verfügbarkeit der vollständigen Arbeit ist nicht aus dem HTML-Fragment ersichtlich. Weitere Informationen hierzu müssten beim jeweiligen Verlag oder der Autorin eingeholt werden.
- Quote paper
- Brigitte McManama (Author), 2010, Chancen zur Enthospitalisierung und De-Institutionalisierung für Menschen mit geistigen Behinderungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/160092