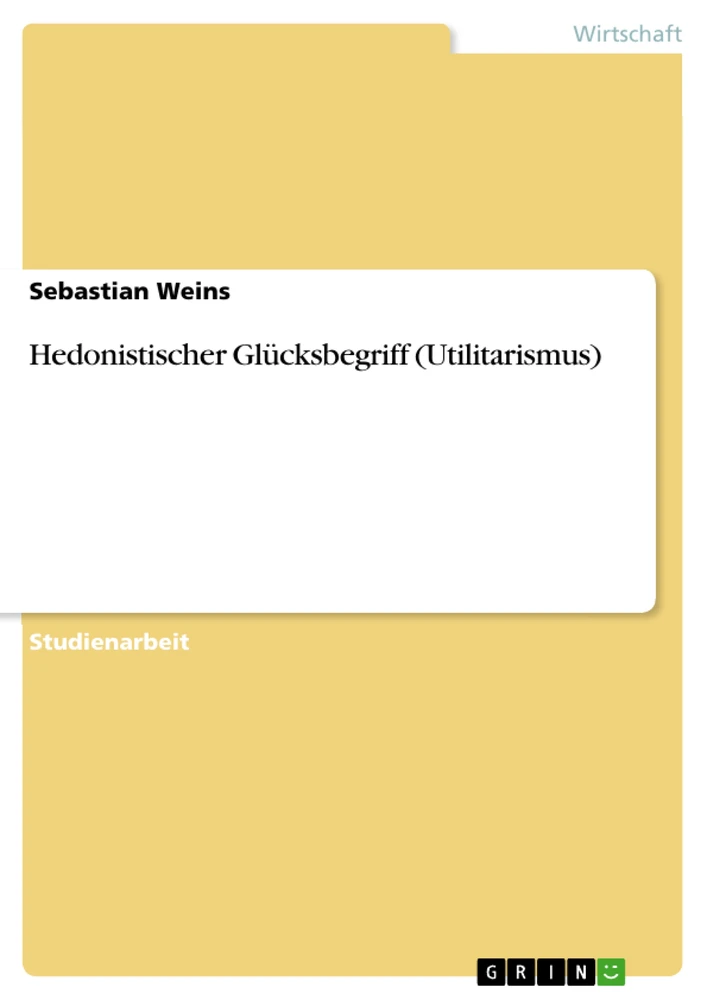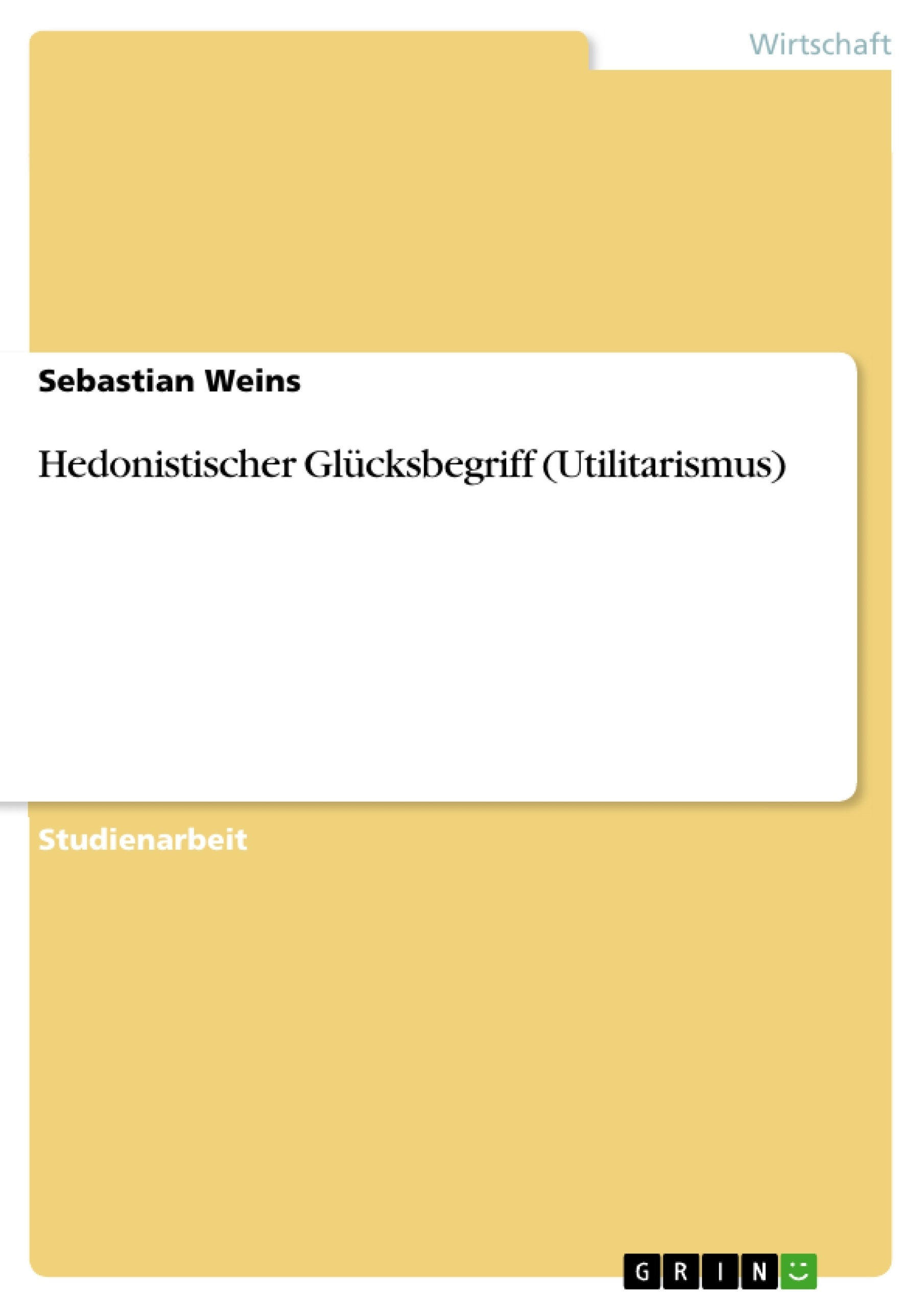Schon seit jeher wird das Glück als zentraler Gegenstand der Philosophie betrachtet, weshalb diese über Jahrhunderte als Lehre vom und Anweisung zum glücklichen Leben verstanden wurde. Es ist allgemein anerkannt, dass Glück das höchste durch eigenständiges Handeln erreichbare Gut darstellt und deshalb als Endzweck menschlichen Handelns anzusehen ist.
Hierauf wurde schon vor gut 2300 Jahren von Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik hingewiesen. Allerdings existierten damals wie heute unterschiedlichste Vorstellungen von der genauen Bedeutung des Glücks. Aristoteles entwickelte den sog. eudämonistischen Glücksbegriff. Seiner Meinung nach steht das Glück in enger Verbindung mit Autarkie. Es besteht in einem genügsamen Leben, das keine Mängel offenbart. Er wendet sich gegen ein Streben nach mehr Gütern beziehungsweise weniger Leid, da das Glück durch das Zuviel oder das Zuwenig zerstört wird.
Eine vergleichsweise moderne Interpretation des Glücksbegriffes erfolgte im Rahmen der utilitaristischen Ethik.
Ziel der Arbeit ist es, ausgehend von den Grundlagen des Utilitarismus den utilitaristischen Glücksbegriff im Sinne der beiden Hauptvertreter dieser Ethik, Jeremy Bentham und John Stuart Mill, auszuarbeiten und kritisch zu betrachten. Abschließend werden Gemeinsamkeiten zwischen dem Utilitarismus und der Ökonomie dargestellt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die utilitaristische Ethik
- Grundmerkmale des Utilitarismus
- Definition des Utilitarismus
- Wesentliche Merkmale des Utilitarismus
- Richtungen des Utilitarismus
- Kurzbiographie Jeremy Bentham
- Der quantitative Utilitarismus
- Der utilitaristische Glücksbegriff nach John Stuart Mill
- Kurzbiographie John Stuart Mill
- Der qualitative Utilitarismus
- Kritische Würdigung
- Grundmerkmale des Utilitarismus
- Das Verhältnis von utilitaristischer Ethik und Ökonomie
- Nutzenverständnis
- Wohlfahrtsökonomie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den utilitaristischen Glücksbegriff, ausgehend von den Grundlagen des Utilitarismus. Sie beleuchtet die Ansichten der Hauptvertreter Jeremy Bentham und John Stuart Mill und unterzieht diese einer kritischen Betrachtung. Abschließend werden Gemeinsamkeiten zwischen Utilitarismus und Ökonomie aufgezeigt.
- Grundlagen des Utilitarismus
- Der utilitaristische Glücksbegriff nach Bentham
- Der utilitaristische Glücksbegriff nach Mill
- Qualitative vs. quantitative Betrachtung des Glücks
- Verbindung zwischen Utilitarismus und Ökonomie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Glücksbegriffs in der Philosophie ein und hebt die unterschiedlichen Interpretationen hervor, insbesondere den Unterschied zwischen dem Eudämonismus des Aristoteles und dem hedonistischen Ansatz des Utilitarismus. Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Ausarbeitung und kritische Betrachtung des utilitaristischen Glücksbegriffs bei Bentham und Mill sowie die Darstellung der Gemeinsamkeiten mit der Ökonomie.
Die utilitaristische Ethik: Dieses Kapitel erörtert die Grundmerkmale des Utilitarismus, beginnend mit seiner Definition als normative Ethik, die Handlungsanweisungen auf Basis des Prinzips der Nützlichkeit liefert. Es werden die wesentlichen Merkmale des Utilitarismus als teleologische Ethik (Konsequenzen-Prinzip), die Betonung des Nutzens (Utilitätsprinzip) und der Fokus auf das in sich Gute, nicht subjektive Ziele, erläutert. Die Kapitelteile zu Bentham und Mill bieten einen biographischen Abriss und führen in deren unterschiedliche Ausprägungen des Utilitarismus ein (quantitativ bei Bentham und qualitativ bei Mill), ohne jedoch in detaillierte Analysen der jeweiligen Philosophien einzutauchen.
Das Verhältnis von utilitaristischer Ethik und Ökonomie: Dieses Kapitel untersucht die Überschneidungen zwischen utilitaristischer Ethik und Ökonomie, insbesondere im Verständnis von Nutzen und Wohlfahrt. Es analysiert, wie die Prinzipien des Utilitarismus in ökonomischen Modellen und Theorien zur Wohlfahrtsökonomie Anwendung finden und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen. Die detaillierte Betrachtung des Nutzenverständnisses in beiden Bereichen bildet den Kern dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Hedonismus, Glücksbegriff, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Nutzenmaximierung, eudämonistischer Glücksbegriff, normative Ethik, teleologische Ethik, Wohlfahrtsökonomie, quantitative und qualitative Utilitarismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Utilitaristische Ethik und Ökonomie
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Utilitarismus, insbesondere den utilitaristischen Glücksbegriff. Er behandelt die Grundlagen des Utilitarismus, die Ansichten von Jeremy Bentham und John Stuart Mill, und untersucht kritisch deren unterschiedliche Ausprägungen (quantitativer vs. qualitativer Utilitarismus). Zusätzlich wird das Verhältnis zwischen utilitaristischer Ethik und Ökonomie beleuchtet, wobei der Fokus auf dem Nutzenverständnis in beiden Bereichen liegt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind: Definition und Grundmerkmale des Utilitarismus, der quantitative Utilitarismus nach Bentham, der qualitative Utilitarismus nach Mill (inkl. Kurzbiografien beider Philosophen), eine kritische Würdigung des Utilitarismus und die Gemeinsamkeiten zwischen utilitaristischer Ethik und Ökonomie (insbesondere im Kontext der Wohlfahrtsökonomie).
Wer sind die wichtigsten Vertreter des Utilitarismus im Text?
Der Text konzentriert sich auf Jeremy Bentham und John Stuart Mill als Hauptvertreter des Utilitarismus. Ihre unterschiedlichen Ansätze zum utilitaristischen Glücksbegriff werden detailliert dargestellt und verglichen.
Wie unterscheidet sich der Utilitarismus von Bentham und Mill?
Bentham vertritt einen quantitativen Utilitarismus, der das Glück durch die Maximierung von Lust und Minimierung von Schmerz misst. Mill hingegen plädiert für einen qualitativen Utilitarismus, der zwischen höheren und niederen Freuden unterscheidet und die Qualität des Glücks betont.
Welche Verbindung besteht zwischen Utilitarismus und Ökonomie?
Der Text untersucht die Überschneidungen zwischen utilitaristischer Ethik und Ökonomie, vor allem im Verständnis von Nutzen und Wohlfahrt. Es wird analysiert, wie utilitaristische Prinzipien in ökonomischen Modellen und Theorien der Wohlfahrtsökonomie Anwendung finden.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die utilitaristische Ethik (inkl. Unterkapitel zu Bentham und Mill), Das Verhältnis von utilitaristischer Ethik und Ökonomie, und Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Utilitarismus, Hedonismus, Glücksbegriff, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Nutzenmaximierung, eudämonistischer Glücksbegriff, normative Ethik, teleologische Ethik, Wohlfahrtsökonomie, quantitativer und qualitativer Utilitarismus.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist für Leser geeignet, die sich einen umfassenden Überblick über den Utilitarismus und seine Beziehung zur Ökonomie verschaffen möchten. Er ist besonders hilfreich für Studierende der Philosophie und Wirtschaftswissenschaften.
- Quote paper
- Sebastian Weins (Author), 2010, Hedonistischer Glücksbegriff (Utilitarismus), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/159407