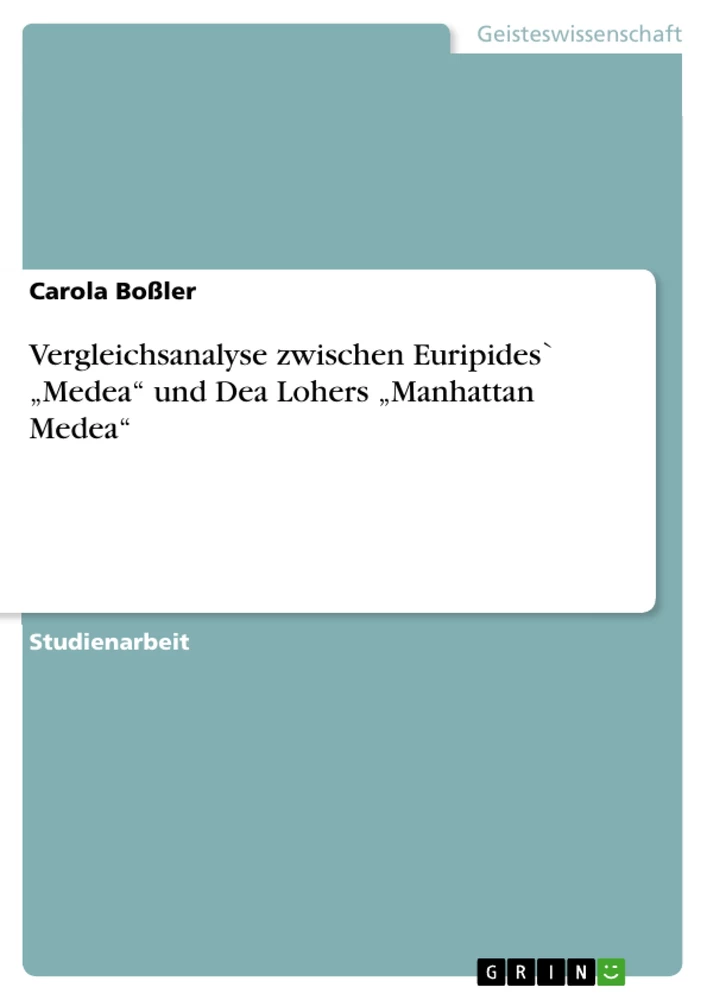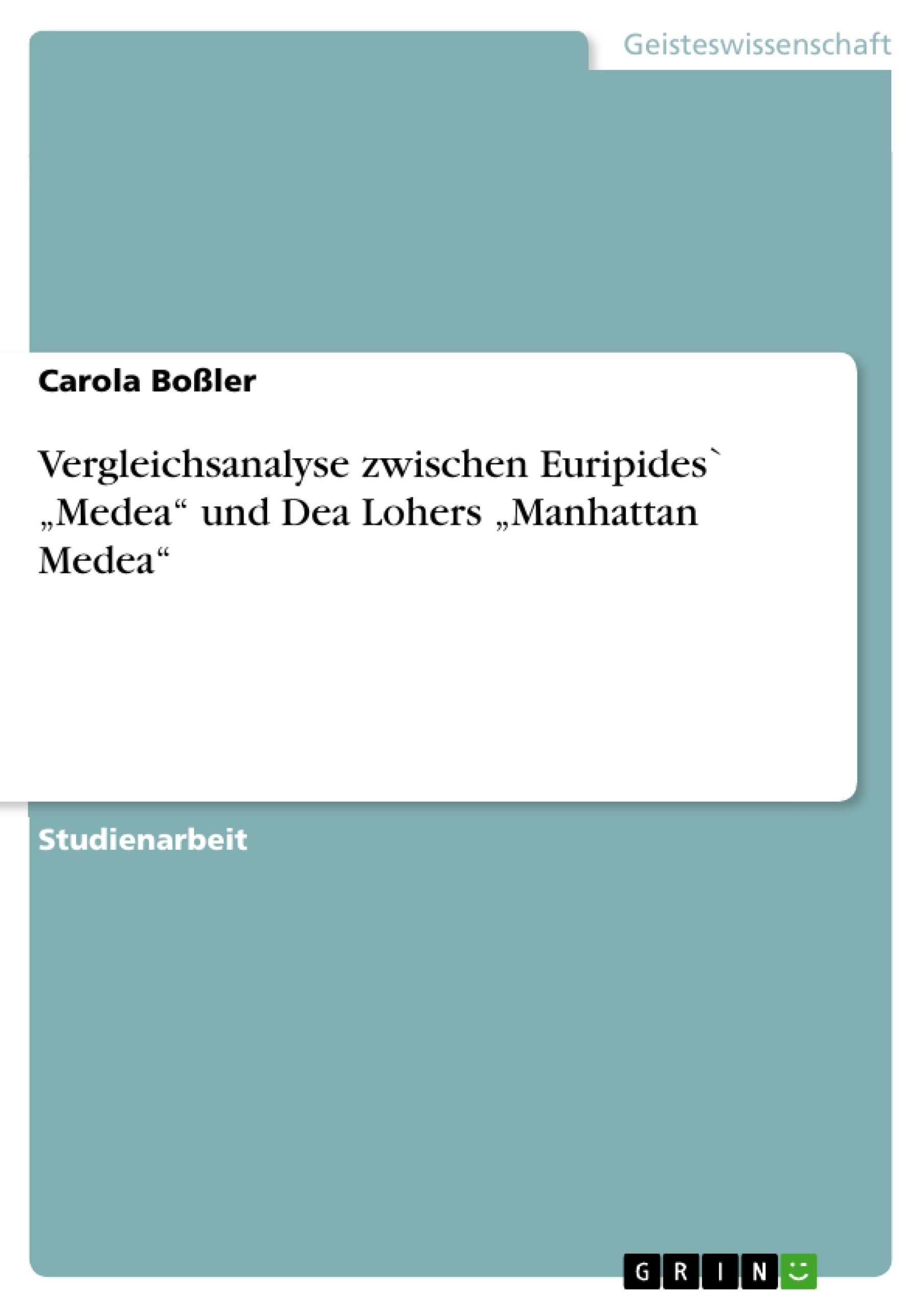Die „Medea“ des Euripides ist die erste überlieferte Bearbeitung des Stoffes, die allerdings nicht den Weg der Flucht (also der Argonautensage) nachzeichnet, sondern beginnt, als Jason sich mit Glauke verheiraten will und Medea deswegen bereits verlassen hat. Im Gegensatz zu dem seinerzeit herrschenden Frauenbild, das besagte, dass Frauen dem Mann „gehören“ und ihnen untertan sein müssen, hat Euripides seine Figur Medea zur Hauptfigur eines eigentlich männlich dominierten Abenteuermythos gemacht und erzählt das Ende dieser Beziehung aus Sicht der Frau. Er legt den Schwerpunkt seiner Tragödie auf die inneren Beweggründe einer betrogenen Frau, die ehemals alle Heldentaten, für die ihr Mann gerühmt wurde, beging, und nun von ihm verlassen und erneut zur flüchtigen Ausgestossenen gemacht wird – zu einem Flüchtling ohne Ziel, da sie nirgendwo hin kann, wo sie nicht um Jasons Willen Verrat oder Unheil begangen hätte (Euripides: 501-515).
Dea Lohers Medeabearbeitung legt den Schwerpunkt nicht auf eine neue inhaltliche Sicht, sondern auf einen strukturellen Diskurs: durch Lohers Bezüge zur Malerei und die daraus resultierende Kraft zur Verwandlung im doppelten künstlerischen Sinne (sowohl inhaltlich durch z. B. die Figuren Velazquez und Deaf Daisy, die sich explizit über ihre jeweiligen Verwandlungen definieren , die Verwandlung der Gemälde, die Verwandlung des ermordeten Bruders in den Sohn - also der Verwendung einer im Mythos oder der Bearbeitung von Euripides nicht vorhandenen Thematik -, als auch formal durch die Bildhaftigkeit der Szenen und den fast vollständige Verzicht auf Handlung - was als Theaterstück die Grundlage für eine Inszenierung legt, den Text als Schnittstelle eines interdisziplinären Diskurses der bildenden Kunst zu benutzen, zwischen Gemälde, Text und Aufführung) wird das Stück als Metamorphose im „ovidschen Verständnis“ interpretierbar und eröffnet damit eine mythenkritische Perspektive, die den Mythos „...in seiner festschreibenden und enthistorisierenden Wirkung zersetzt.“
Inhaltlich orientiert sich Lohers Bearbeitung ebenfalls an den Beweggründen Medeas, auch hier wird der Zeitraum kurz vor der Hochzeit gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Medea-Mythos (die Argonauten/das goldene Vlies)
- Die Autoren und ihre historisch-künstlerische Einordnung
- Vergleich der dramaturgischen Mittel
- Schwerpunkte der Bearbeitungen
- Szenen-Unterteilung
- Funktion der Szenen
- Handlungsort
- Figuren und ihre Entsprechungen
- Sprache/Grammatik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht Euripides' "Medea" mit Dea Lohers "Manhattan Medea", um die dramaturgischen Mittel und die Schwerpunkte beider Bearbeitungen des Medea-Mythos zu analysieren. Die Untersuchung beleuchtet die Unterschiede in der Darstellung der Figur Medea und die jeweiligen künstlerischen Entscheidungen der Autorinnen.
- Der Medea-Mythos und seine verschiedenen Interpretationen
- Vergleich der dramaturgischen Strukturen in beiden Stücken
- Die Rolle der Frau in der Antike und in der Moderne
- Die Entwicklung der Figur Medea von der Neben- zur Hauptrolle
- Die Verwendung künstlerischer Mittel wie Malerei in der modernen Adaption
Zusammenfassung der Kapitel
Der Medea-Mythos (die Argonauten/das goldene Vlies): Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung des Medea-Mythos im Kontext der Argonauten-Sage. Es beleuchtet Medeas Rolle als Nebenfigur, die durch Euripides zur Hauptfigur erhoben wurde. Die Darstellung von Medea als Tochter des Königs Aites, ihre Kenntnisse in Pharmakologie und ihre entscheidende Rolle bei Jasons Erlangung des Goldenen Vlieses werden ausführlich erläutert. Der Fokus liegt auf Medeas Handlungen, ihren Beweggründen und den Konsequenzen ihrer Taten, insbesondere dem Mord an ihrem Bruder Apsyrtos und ihrer Beteiligung am Tod des Pelias. Die Darstellung ihrer Beziehung zu Jason legt den Grundstein für das Verständnis ihrer späteren Racheakte. Die Vielzahl an Bearbeitungen des Mythos wird erwähnt, was die anhaltende Relevanz der Thematik unterstreicht.
Die Autoren und ihre historisch-künstlerische Einordnung: Dieses Kapitel stellt Euripides und Dea Loher als Autorinnen der jeweiligen Medea-Bearbeitungen vor. Euripides wird als bedeutender Tragödiendichter der Antike positioniert, dessen Werk "Medea" die feministische Perspektive auf den Mythos in den Mittelpunkt stellt. Im Gegensatz dazu wird Dea Lohers "Manhattan Medea" als zeitgenössische Adaption präsentiert. Die Kapitel beschreibt die künstlerischen Hintergründe der Autorinnen, deren Einflüsse und deren individuellen Schreibstile. Der Abschnitt hebt die Kontraste zwischen der antiken Tragödie und dem modernen Theaterstück hervor und legt damit den Grundstein für den anschließenden Vergleich der dramaturgischen Mittel.
Vergleich der dramaturgischen Mittel: Dieser Abschnitt analysiert die unterschiedlichen Schwerpunkte und dramaturgischen Mittel in Euripides' "Medea" und Lohers "Manhattan Medea". Während Euripides' Fokus auf Medeas inneren Beweggründen und der Darstellung einer betrogenen Frau liegt, betont Lohers Bearbeitung den strukturellen Diskurs und die Metaphorik, insbesondere durch die Einbeziehung von Malerei. Die Kapitel beleuchtet den Unterschied in der Schwerpunktsetzung der beiden Werke. Euripides konzentriert sich auf die psychologischen Aspekte, während Loher die Erzählstruktur und die künstlerische Metaphorik als zentrale Elemente einsetzt. Die unterschiedlichen Behandlungen der Thematik werden durch ausführliche Beispiele aus beiden Werken belegt. Der Verzicht auf Handlung und der Fokus auf bildliche Szenen in "Manhattan Medea" werden explizit als wesentlicher Unterschied zur klassischen Tragödie herausgestellt.
Schlüsselwörter
Medea-Mythos, Euripides, Dea Loher, Tragödie, Dramaturgie, Frauenrolle, Moderne Adaption, Vergleichsanalyse, Mythosinterpretation, künstlerische Mittel, Malerei, Struktur, Handlung, Betrug, Rache.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Vergleichsanalyse von Euripides' "Medea" und Dea Lohers "Manhattan Medea"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht Euripides' "Medea" mit Dea Lohers "Manhattan Medea". Der Fokus liegt auf der Analyse der dramaturgischen Mittel und der Schwerpunkte beider Bearbeitungen des Medea-Mythos. Dabei werden die Unterschiede in der Darstellung der Figur Medea und die künstlerischen Entscheidungen der Autorinnen untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Medea-Mythos und seine verschiedenen Interpretationen, vergleicht die dramaturgischen Strukturen beider Stücke, untersucht die Rolle der Frau in der Antike und Moderne, beleuchtet die Entwicklung der Figur Medea von der Neben- zur Hauptrolle und analysiert die Verwendung künstlerischer Mittel (wie Malerei in Lohers Stück).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zum Medea-Mythos im Kontext der Argonauten-Sage, zur historisch-künstlerischen Einordnung von Euripides und Dea Loher, und einem ausführlichen Vergleich der dramaturgischen Mittel in beiden Stücken. Zusätzlich gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Wie wird der Medea-Mythos dargestellt?
Das Kapitel zum Medea-Mythos beschreibt den Ursprung des Mythos, Medeas Rolle als Nebenfigur, ihre Entwicklung zur Hauptfigur bei Euripides, ihre Fähigkeiten in der Pharmakologie und ihre entscheidenden Handlungen (Mord an ihrem Bruder, Beteiligung am Tod des Pelias). Die Beziehung zu Jason und die Motive für ihre Racheakte werden ebenfalls beleuchtet.
Wie werden Euripides und Dea Loher eingeordnet?
Euripides wird als bedeutender antiker Tragödiendichter vorgestellt, dessen "Medea" eine feministische Perspektive bietet. Dea Loher wird als Autorin einer modernen Adaption präsentiert. Der Abschnitt vergleicht die künstlerischen Hintergründe, Einflüsse und Schreibstile beider Autorinnen und hebt die Unterschiede zwischen antiker Tragödie und modernem Theater hervor.
Wie werden die dramaturgischen Mittel verglichen?
Der Vergleich der dramaturgischen Mittel analysiert die Schwerpunkte und Mittel in beiden Stücken. Er betont den Unterschied zwischen Euripides' Fokus auf Medeas innere Beweggründe und Lohers Betonung des strukturellen Diskurses und der Metaphorik (insbesondere durch Malerei). Der Unterschied in der Schwerpunktsetzung (psychologische Aspekte bei Euripides, Erzählstruktur und künstlerische Metaphorik bei Loher) wird mit Beispielen aus beiden Werken belegt. Der Verzicht auf Handlung in "Manhattan Medea" wird als wesentlicher Unterschied hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medea-Mythos, Euripides, Dea Loher, Tragödie, Dramaturgie, Frauenrolle, Moderne Adaption, Vergleichsanalyse, Mythosinterpretation, künstlerische Mittel, Malerei, Struktur, Handlung, Betrug, Rache.
- Arbeit zitieren
- Carola Boßler (Autor:in), 2010, Vergleichsanalyse zwischen Euripides` „Medea“ und Dea Lohers „Manhattan Medea“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/158180