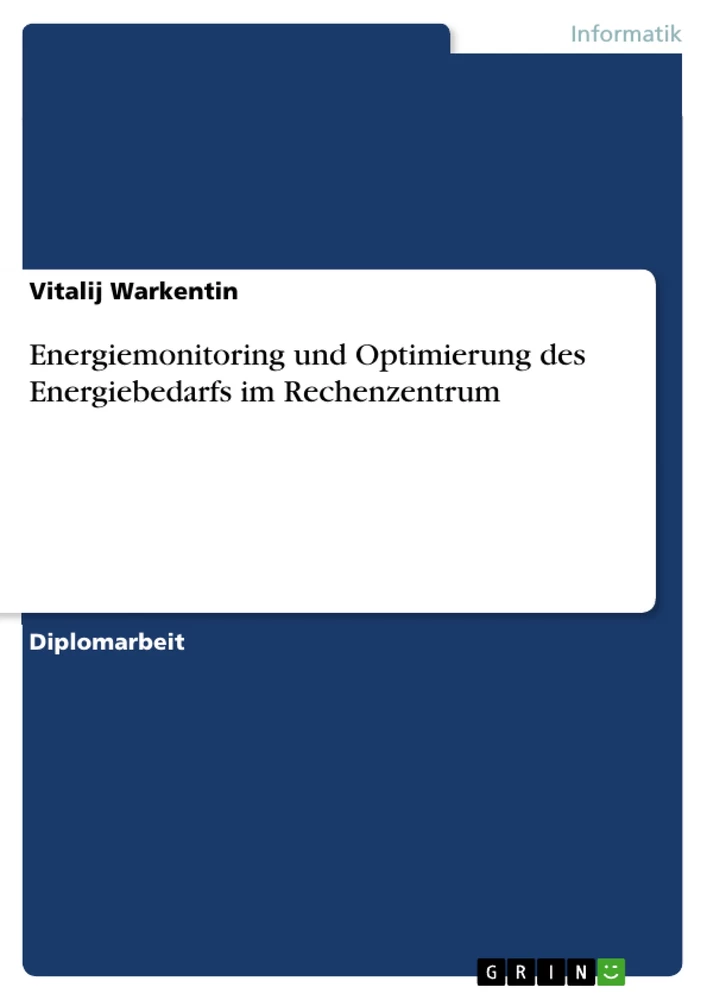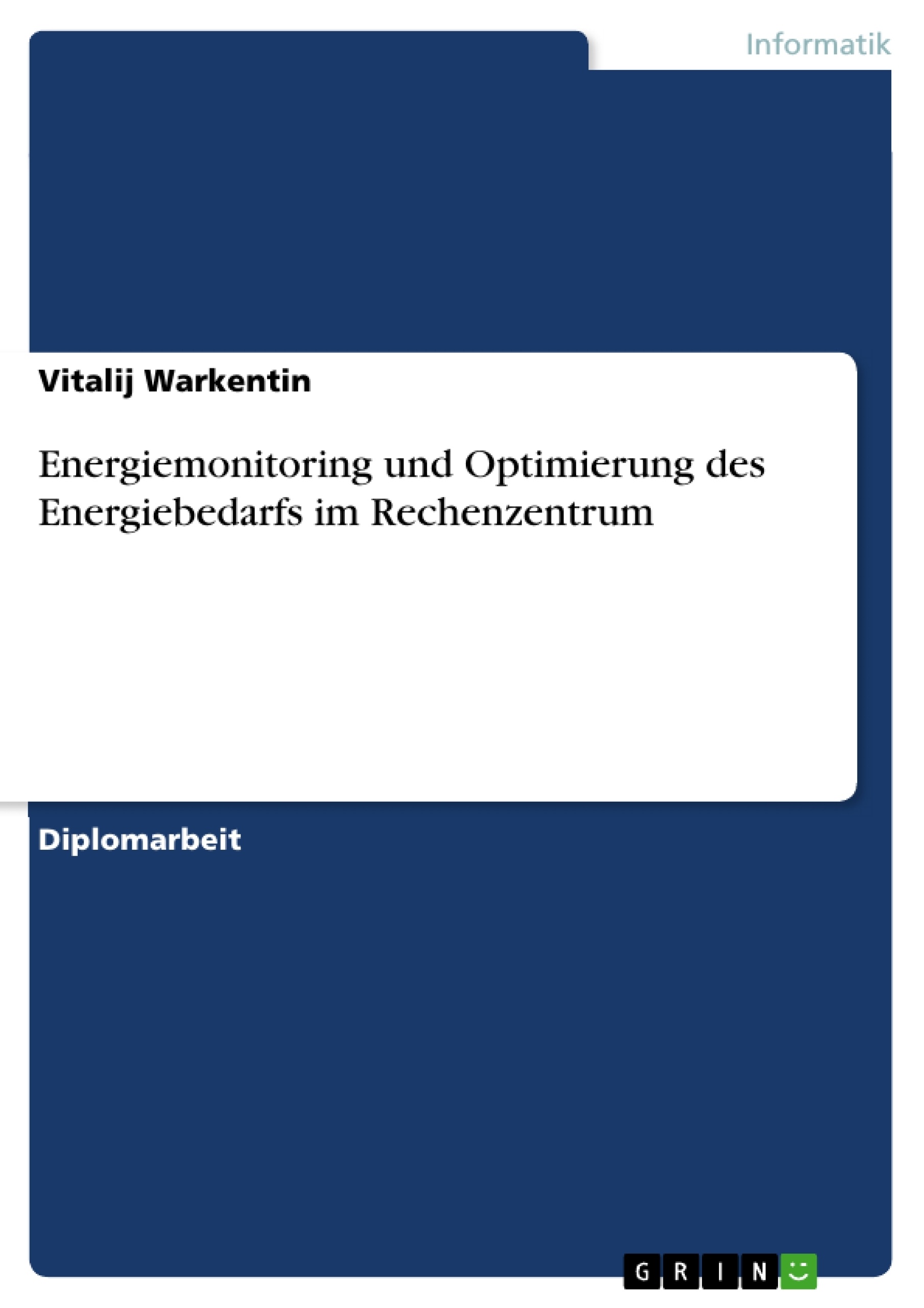Der CO2-Ausstoß der Informations- und Telekommunikationstechnologie-Branche wird mit dem Niveau des weltweiten Flugverkehrs verglichen, der immerhin ca. 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes ausmacht. Um diese Belastung kompensieren zu können, müssten 60 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Zehn Terawatt, soviel Energie verbrauchten alle deutschen Server- und Rechenzentren im Jahr 2008 (Franz, et al., 2009).
Der stetig ansteigende Speicherplatzbedarf und der zunehmende Leistungsverbrauch immer leistungsfähigerer IT-Systeme führen zu einem deutlichen Anstieg der Strom- und damit der Betriebskosten.
Bis zum Jahr 2004 waren die Anschaffungskosten und die Betriebskosten aneinander gekoppelt. Seit dem Jahr 2004 sind die Betriebskosten entkoppelt und stiegen seitdem jährlich um mehr als 20 Prozent an. Ohne Zweifel steht fest, dass die Rechenleistung weiterhin steigen wird und mit ihr auch der Energieverbrauch.
Der mittlere Leistungsbedarf betrug im Jahr 2001 durchschnittlich 100 Watt pro Server, im Jahr 2006 waren es schon 400 Watt. Die Anzahl der installierten Server hat sich vom Jahr 2000 bis 2005 verdoppelt (Koomey, 2007). Neuerdings wird die hohe Energiedichte durch die so genannte Blade-Center-Technologie verursacht, die bis zu 30 kWatt pro Rack ausmachen kann.
Die Weltwirtschaftskrise brachte neue Herausforderungen mit sich, wie Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Erhöhung der betrieblichen Effizienz. Noch nie waren die Rechenzentrumsmanager so sehr gezwungen, ihnen zur Verfügung stehende Budgets möglichst effizient zu nutzen. Laut einer Umfrage des Aperture Research Institute (ARI), prognostizieren mehr als die Hälfte der befragten Manager eine Stagnation des ihnen zur Verfügung stehenden Budgets (Aperture Research Institute, 2009). Das hat den indirekten Vorteil, dass das Bestreben nach Lösungen, welche laufende Betriebskosten senken sollen, umso größer ist. Durch den geringeren Stromverbauch sinken die Betriebsausgaben.
Aufgrund der fehlenden Messtechnik in Rechenzentren lässt sich nicht genau feststellen, wo der heißeste Serverschrank steht und ob die Umgebungstemperaturverläufe im Sollwertbereich liegen. Das erschwert nicht nur den Klimatechnikingenieuren, Maßnahmen für einen optimalen Betrieb zu finden, sondern auch den Rechenzentrumsbetreibern einen optimalen Betrieb für das Klimaprogramm zu fahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Ziele der Diplomarbeit
- Grundlagen
- Das Rechenzentrum und seine Infrastruktur
- Empfehlungen, Normen und Richtlinien
- Roh- und Innenausbau
- Die Stromversorgung
- Elektrische Energieversorgung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Sicherheits- und Brandmeldetechnik
- IT-Technik
- Serverschrank
- Leistungsverbrauch der IT-Infrastruktur
- Server
- Storage
- Network
- Thin-Clients
- Einsparpotentiale im Rechenzentrum
- Klima- und Lüftungsanlage
- Optimierung auf der IT-Ebene
- Leistungsfähigere IT
- Virtualisierung
- Cloud Computing
- Power Capping
- Managementsysteme der IT
- Kapitelaufbau
- Konfigurationssoftware für die EDV-Ausstattung
- Die Funktionalität des Programms
- Begriffserklärung zu den Programmparametern
- Vorstellung der drei unterschiedlichen Tools von HP
- Praxisbeispiel anhand des HP Power Calculators
- SPECpower_ssj2008
- Weitere Konfigurationsprogramme
- Integriertes Systemmonitoring
- Funktionsbeschreibung
- Herstellerabhängige Überwachung der Server
- Energieüberwachungssysteme
- Allgemeine Beschreibung
- Messstellenverteilung
- Vorstellung der Messgeräte nach Messstellen
- Management-Software
- Konzepte und Anforderungen
- Kurzvorstellung ausgewählter Management-Software
- Merkmalübersicht
- Bewertung bestehender Messsysteme
- Gegenüberstellung
- Kostenvergleich für ein Demorechenzentrum
- Lösung zur Optimierung des Energiebedarfs
- Allgemeine Vorgaben des Rechenzentrums
- Analyse aus klimatechnischer Sicht
- Möglichkeiten der Luftmengenanpassung
- Zusammenfassung
- Allgemeine Schlussfolgerung aus der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Energiemonitoring und der Optimierung des Energiebedarfs im Rechenzentrum. Ziel ist es, eine effiziente Energieverwaltung im Rechenzentrum zu ermöglichen, indem verschiedene Aspekte des Energieverbrauchs analysiert und Lösungsansätze zur Optimierung des Energiebedarfs vorgestellt werden.
- Analyse des Energieverbrauchs im Rechenzentrum
- Bewertung bestehender Messsysteme und -software
- Entwicklung von Konzepten zur Optimierung des Energiebedarfs
- Einfluss von IT-Technologien auf den Energieverbrauch
- Kosten- und Umweltaspekte der Energieoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Energiemonitoring im Rechenzentrum einführt und die Ziele der Arbeit definiert. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des Rechenzentrums und seiner Infrastruktur, einschließlich der IT-Technik und der Einsparpotentiale.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Managementsysteme der IT, die für die Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs eingesetzt werden. Hier werden Konfigurationssoftware, integriertes Systemmonitoring, Energieüberwachungssysteme und Management-Software vorgestellt und analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Bewertung bestehender Messsysteme und führt einen Kostenvergleich für ein Demorechenzentrum durch.
Kapitel 5 präsentiert Lösungsansätze zur Optimierung des Energiebedarfs im Rechenzentrum, wobei allgemeine Vorgaben und klimatechnische Aspekte betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Energiemonitoring, Rechenzentrum, IT-Infrastruktur, Energieverbrauch, Energieeffizienz, Managementsysteme, Messsysteme, Optimierung, Virtualisierung, Cloud Computing.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. (FH) Vitalij Warkentin (Author), 2010, Energiemonitoring und Optimierung des Energiebedarfs im Rechenzentrum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/158017