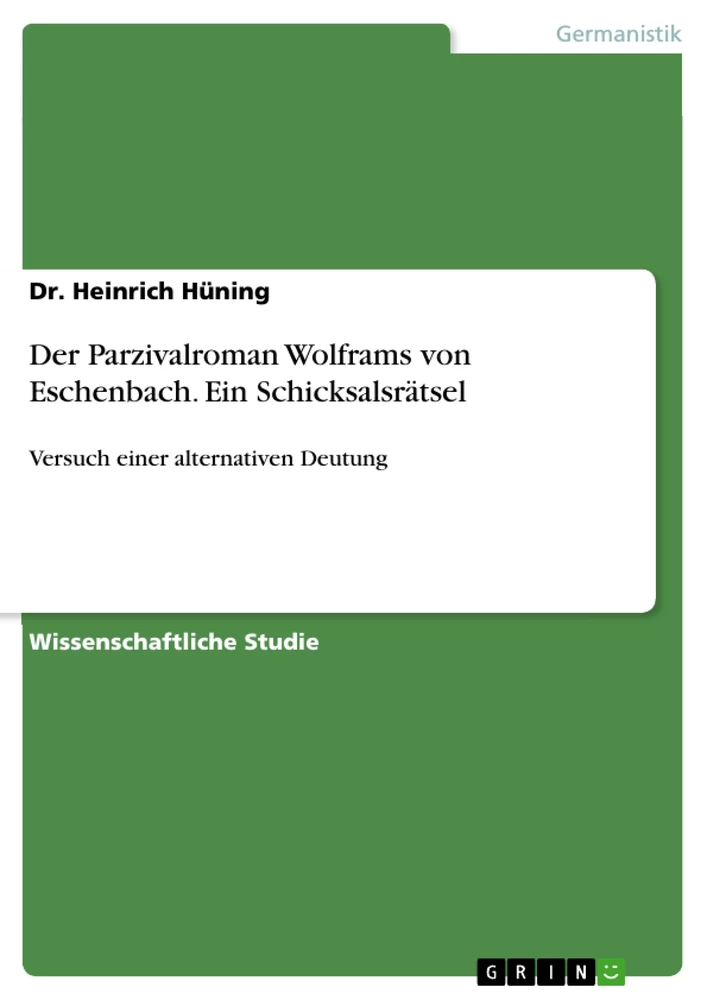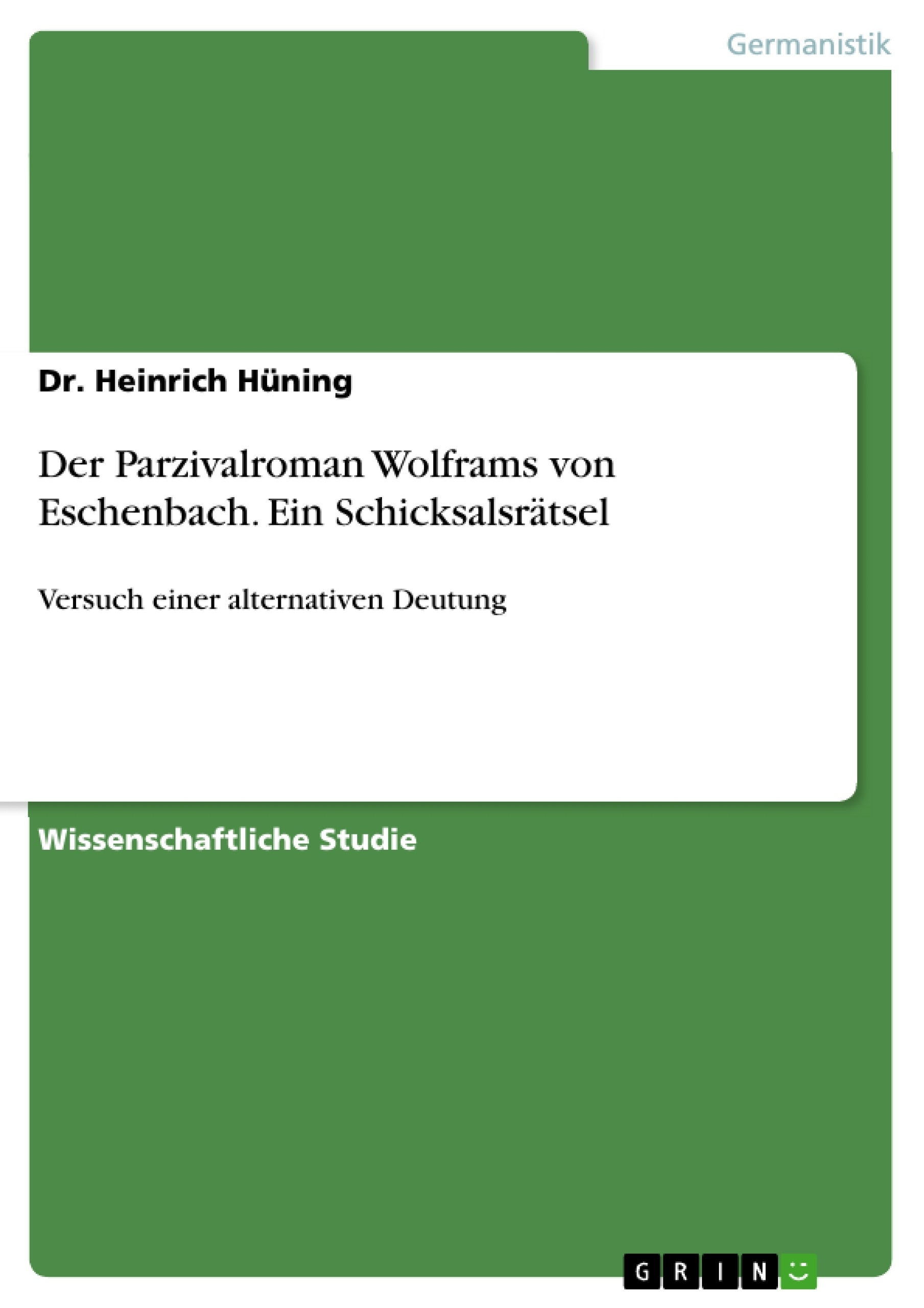Die Rätselhaftigkeit des Parzivalprologs war der explizite Gegenstand meiner Dissertation mit dem Titel: „Würfelwörter und Rätselbilder im Parzivalprolog Wolframs von Eschenbach“ (2000, Köln).
Das Ergebnis der folgenden Untersuchung führt zu der Erkenntnis, dass es sich bei diesem außergewöhnlichen Prolog der Form nach um ein Schicksalsrätsel handelt. Diese These möchte ich anhand des Textes belegen und mich dabei auf die Deutung des ersten Teil des Parzivalprologs, das „vliegende bîspel“ und den „Hasenvergleich“ beschränken.
In Form der „bickelwort“-Metapher erlangten Würfel - im historischen Literaturstreit zwischen Gottfried und Wolfram um literarische Konzepte - eine schicksalhafte Bedeutung. Durch eine wissenschaftliche Analyse von Formen und Funktionen der historischen Würfel konnte Einblick in die Verrätselungstechnik Wolframs bei der Konzeption des Parzivalprologs gewonnen werden. So ließ sich erklären, was mit der Verwendung von „bickelwörtern“, dem Vorwurf Gottfrieds v. Strassburg an die Adresse Wolframs, gemeint war, nämlich die Verwendung von Wörtern mit sich wandelnder Bedeutung (Äquivokationen), die Wolfram bewusst als literarisches Mittel benutzt hatte, um den Text des Parzivalprologs als Zugangsrätsel zum Roman zu konzipieren.
Würfelwörter dienen als Mittel des verstehenden Umgangs mit Sprache - etwa zum Zweck der Verrätselung des Prologtextes - andererseits zugleich als literarische Motive, die den Text wegen ihrer „Zweideutigkeit“ konzeptionell bestimmen, d. h. ihm eine bestimmte poetische Struktur, Sinnrichtung und künstlerische Gestalt geben.
Zu den Leitwörtern dieser Art, die als „kleinste literarische Motive“ eine Mehrschichtigkeit des Textes verursachen, gehören unter anderen „zwîvel, nâchgebûr, parrieret, unstaete, stiure“ u.a. Die meisten dieser Wörter befinden sich im „vliegenden bîspel“, dem Schicksalsrätsel des Parzivalprologs im engeren Sinne. Das Wort „stiure“ heißt beispielsweise „Gang der maere in eine bestimmte Richtung“, zugleich aber auch „subjektiv zu leistender Beitrag (des Zuhörers) zum Verständnis des Textes“.
Die Sinnrichtung bestimmter Verse oder Textpassagen lässt sich dadurch nicht mehr nur in einer Richtung fixieren. Eine daraus resultierende Mehrschichtigkeit bzw. Rätselhaftigkeit des Textes ist bewusst kalkuliert und gehört zum Konzept der Dichtung.
Das gilt für den Prolog, aber auch für den gesamten Roman als die rätselhafte Biographie einer höfischen christlichen Existenz mit dem Namen „Parzival“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der Parzivalprolog
- Rückblick
- Eine „Neue Lektüre des Parzivalprologs“?
- Ein neues Forschungsprofil?
- „Zwîvel“-Metapher versus „bast“-Konzept - Erinnerung an einen alten Streit um literarische Konzepte
- Warum entzieht sich der Parzivalprolog dem „Zugriff“ der traditionellen Forschung?
- Unreflektierte Prämissen in der heutigen Literaturwissenschaft des Mittelalters
- Gründe des Scheiterns
- Der „Hasenvergleich“ im Verhältnis zum „vliegenden bîspel“
- Die „Kunst des Jagens“ und Dichtens
- Die Pointe des Hasenvergleichs
- Folgerungen
- Vom Eingang zum Höhepunkt des Romangeschehens
- Die Probe auf´s Exempel und Deutung einiger Hauptmotive des Textes auf diesem Hintergrund
- Interpretation des vliegenden bîspels aus lebensweltlicher Sicht
- Deutung des „zwîvel“ aus vorreformatorischer Perspektive
- Das Menschenbild des Parzivalromans
- Das dichterische Bild einer schweren Schuld
- Parzival und seine Brüder
- Das fiktive Konzept einer „dreifältigen“ Existenz in seiner naturgeschichtlichen, geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Dimension durch die Gestalten Feirefiz - Gawan - Parzival
- Dreiteiligkeit und Dreieinigkeit
- Das Bild der Frau im „Parzival“
- Orgeluse als Romangestalt - Eleonore von Aquitanien - historisches Vorbild für eine literarische Figur?
- Die Frau im Romankonzept nach biblischem Muster
- Das Bild des Mannes. Die drei Namen Parzivals
- Feirefiz
- Die Gestalt des Feirefiz in der bisherigen Forschungsgeschichte
- Feirefiz, der Bruder Parzivals; Heide - Anschevin - Mahdi
- Feirefiz, der „Messias“
- Gawan
- Gawan als Komplementärfigur - das „alter ego“ Parzivals
- Der Epilog von Buch VI - eine Szene vor dem Spiegel
- Die Kämpfe Gawans
- Gawan und das Schicksal der Menschen auf Schastel marveille oder die gesellschaftliche Perspektive der Schuld Parzivals
- Gawan und Orgeluse, die Frau seines Lebens
- Gawan und Parzival, Wiedervereinigung beider Figuren und Abgesang für Gawan
- Parzival
- Das dichterische Bild des Gralsgeschlechtes vor seinem konzeptionellen Hintergrund
- Das Gralsgeschlecht und die Lehre der Väter
- Deutungsversuch der Gralsfrage auf dem Hintergrund der Väterlehre: Die Erneuerung des Urstandes durch die Taufe
- Die „Positivierung des Sündenfalles“
- Die Erneuerung des Urstandes durch die Taufe und die Teilhabe am Corpus Christi Mysticum
- Natur und Übernatur bei Feirefiz und Parzival
- Feirefiz
- Dichterische Bilder - literarische Metamorphosen
- Die Entstehung des Geschlechternamens der „Anschevin“ mit den literarischen Mitteln der Satire, Parodie und Travestie
- Parzival - Feirefiz - Amfortas - und die Erlösungsfrage
- Eine alternative Deutung der zweiten Gralsszene
- Der Gral - ein sonderbares „dinc“!
- „gemach“ - ein Schlüsselwort der zweiten Gralsszene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie verfolgt das Ziel, einen alternativen Zugang zum Parzivalroman Wolframs von Eschenbach zu ermöglichen. Sie hinterfragt etablierte Forschungsansätze und bietet neue Interpretationen wichtiger Motive und Figuren. Die Arbeit konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse des Prologs und ausgewählter Kapitel, um ein tieferes Verständnis des komplexen Werkes zu ermöglichen.
- Interpretation des Parzivalprologs und seiner zentralen Metaphern
- Analyse des Menschenbildes im Roman und der Darstellung von Schuld und Erlösung
- Untersuchung der Darstellung von Frauen und Männern im Kontext des Werkes
- Deutung der Schlüsselfiguren Parzival, Feirefiz und Gawan
- Analyse literarischer Mittel und Metamorphosen im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort dient vermutlich der Einleitung und der Vorstellung der Forschungsarbeit, ihrer Zielsetzung und Methodik. Es wird eine kurze Übersicht über die zentralen Themen und den methodischen Ansatz der Studie geben.
Der Parzivalprolog: Dieses Kapitel analysiert den Prolog des Parzivalromans eingehend. Es untersucht die Schwierigkeiten, die der Prolog für traditionelle Forschungsmethoden darstellt, und beleuchtet unreflektierte Prämissen in der modernen Mittelalterforschung. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen der „Zwîvel“-Metapher und dem „bast“-Konzept sowie die Interpretation des „Hasenvergleichs“ und des „vliegenden bîspels“. Die Analyse zielt darauf ab, neue Interpretationsansätze für den Prolog zu entwickeln und die Bedeutung des Prologs für das Verständnis des gesamten Romans zu erhellen.
Das Menschenbild des Parzivalromans: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verständnis des Menschen im Parzivalroman. Es untersucht das dichterische Bild der schweren Schuld und analysiert die Figuren Parzival, Feirefiz und Gawan im Kontext ihrer jeweiligen „dreifältigen“ Existenz. Die Konzepte von Dreiteiligkeit und Dreieinigkeit spielen hier eine zentrale Rolle, um die komplexe Darstellung des Menschen im Roman zu beleuchten. Das Kapitel verknüpft die individuellen Schicksale der Figuren mit übergeordneten theologischen und philosophischen Fragen.
Das Bild der Frau im „Parzival“: Hier wird die Darstellung von Frauen im Roman untersucht, wobei Orgeluse als zentrale Figur und ihr mögliches historisches Vorbild, Eleonore von Aquitanien, im Fokus steht. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Frauen im Romankonzept und setzt sie in Beziehung zum biblischen Muster. Es wird analysiert, wie weibliche Figuren die Handlung beeinflussen und welche Bedeutung sie im Gesamtkontext des Werkes einnehmen.
Das Bild des Mannes. Die drei Namen Parzivals: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die männlichen Figuren, insbesondere auf die drei Namen Parzivals – Parzival, Feirefiz und Gawan – und analysiert ihre individuellen Rollen und ihre Beziehung zueinander. Die Kapitel untersuchen die Figuren im Kontext der bisherigen Forschung und setzen sie in Beziehung zueinander, um ihre komplementäre Bedeutung herauszuarbeiten. Es werden die Bedeutungen von Feirefiz als „Messias“ und Gawans Rolle als Parzivals „alter ego“ erläutert. Die Kapitel erforschen auch die Bedeutung des Gralsgeschlechtes, die Väterlehre und die Gralsfrage.
Dichterische Bilder - literarische Metamorphosen: Das Kapitel befasst sich mit den literarischen Stilmitteln und Metamorphosen im Roman. Es analysiert die Entstehung des Geschlechternamens „Anschevin“ und untersucht die Figuren Parzival, Feirefiz und Amfortas im Kontext der Erlösungsfrage. Eine alternative Deutung der zweiten Gralsszene und die Bedeutung des Wortes „gemach“ werden ebenfalls behandelt. Das Kapitel analysiert die literarischen Techniken, um die Erzählung und die zentralen Themen des Romans zu gestalten.
Schlüsselwörter
Parzivalroman, Wolfram von Eschenbach, Prologanalyse, Menschenbild, Schuld, Erlösung, Frauendarstellung, Männliche Figuren, Feirefiz, Gawan, Parzival, Gralsfrage, Väterlehre, Literarische Metamorphosen, mittelalterliche Literaturwissenschaft, Interpretationsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Parzivalroman
Was ist der Inhalt dieser Studie zum Parzivalroman?
Diese Studie bietet einen alternativen Zugang zum Parzivalroman Wolframs von Eschenbach. Sie hinterfragt etablierte Forschungsansätze und präsentiert neue Interpretationen wichtiger Motive und Figuren. Die Arbeit konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse des Prologs und ausgewählter Kapitel, um ein tieferes Verständnis des komplexen Werkes zu ermöglichen. Die Analyse umfasst das Menschenbild, die Darstellung von Frauen und Männern, die Schlüsselfiguren Parzival, Feirefiz und Gawan, sowie literarische Mittel und Metamorphosen.
Welche Themen werden im Parzivalroman behandelt?
Die Studie beleuchtet zentrale Themen wie das Menschenbild im Roman (Schuld und Erlösung), die Darstellung von Frauen und Männern, die Interpretation der Schlüsselfiguren Parzival, Feirefiz und Gawan, sowie die Analyse literarischer Mittel und Metamorphosen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Prolog und dessen Interpretation gewidmet.
Wie wird der Prolog des Parzivalromans analysiert?
Der Prolog wird eingehend untersucht, wobei die Schwierigkeiten für traditionelle Forschungsmethoden und unreflektierte Prämissen in der modernen Mittelalterforschung beleuchtet werden. Der Vergleich der „Zwîvel“-Metapher mit dem „bast“-Konzept, sowie die Interpretation des „Hasenvergleichs“ und des „vliegenden bîspels“ spielen eine zentrale Rolle. Das Ziel ist es, neue Interpretationsansätze für den Prolog zu entwickeln und dessen Bedeutung für das Verständnis des gesamten Romans zu erhellen.
Wie wird das Menschenbild im Parzivalroman dargestellt?
Das Kapitel zum Menschenbild untersucht das dichterische Bild der schweren Schuld und analysiert die Figuren Parzival, Feirefiz und Gawan im Kontext ihrer „dreifältigen“ Existenz. Dreiteiligkeit und Dreieinigkeit werden als zentrale Konzepte verwendet, um die komplexe Darstellung des Menschen im Roman zu beleuchten und die individuellen Schicksale der Figuren mit übergeordneten theologischen und philosophischen Fragen zu verknüpfen.
Wie werden Frauen und Männer im Parzivalroman dargestellt?
Die Darstellung von Frauen wird anhand von Orgeluse und ihrem möglichen historischen Vorbild, Eleonore von Aquitanien, untersucht. Die Rolle der Frauen im Romankonzept im Vergleich zum biblischen Muster wird analysiert. Bei der Darstellung der Männer liegt der Fokus auf den drei Namen Parzivals (Parzival, Feirefiz und Gawan) und deren Beziehungen zueinander. Die Rollen von Feirefiz als „Messias“ und Gawan als Parzivals „alter ego“ werden erläutert.
Welche Rolle spielen die Figuren Parzival, Feirefiz und Gawan?
Die Studie untersucht die Schlüsselfiguren Parzival, Feirefiz und Gawan eingehend. Sie analysiert ihre individuellen Rollen und ihre Beziehungen zueinander. Besonders die Bedeutung von Feirefiz als „Messias“ und Gawans Rolle als Parzivals „alter ego“ werden erläutert. Die Analyse umfasst auch die Bedeutung des Gralsgeschlechtes, die Väterlehre und die Gralsfrage.
Welche literarischen Mittel und Metamorphosen werden im Roman verwendet?
Dieses Kapitel analysiert die literarischen Stilmittel und Metamorphosen. Es untersucht die Entstehung des Geschlechternamens „Anschevin“, die Figuren Parzival, Feirefiz und Amfortas im Kontext der Erlösungsfrage, eine alternative Deutung der zweiten Gralsszene und die Bedeutung des Wortes „gemach“. Der Fokus liegt auf den literarischen Techniken, die zur Gestaltung der Erzählung und der zentralen Themen des Romans eingesetzt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Parzivalroman in dieser Studie?
Schlüsselwörter sind: Parzivalroman, Wolfram von Eschenbach, Prologanalyse, Menschenbild, Schuld, Erlösung, Frauendarstellung, Männliche Figuren, Feirefiz, Gawan, Parzival, Gralsfrage, Väterlehre, Literarische Metamorphosen, mittelalterliche Literaturwissenschaft, Interpretationsansätze.
- Quote paper
- Dr. Heinrich Hüning (Author), 2010, Der Parzivalroman Wolframs von Eschenbach. Ein Schicksalsrätsel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157925