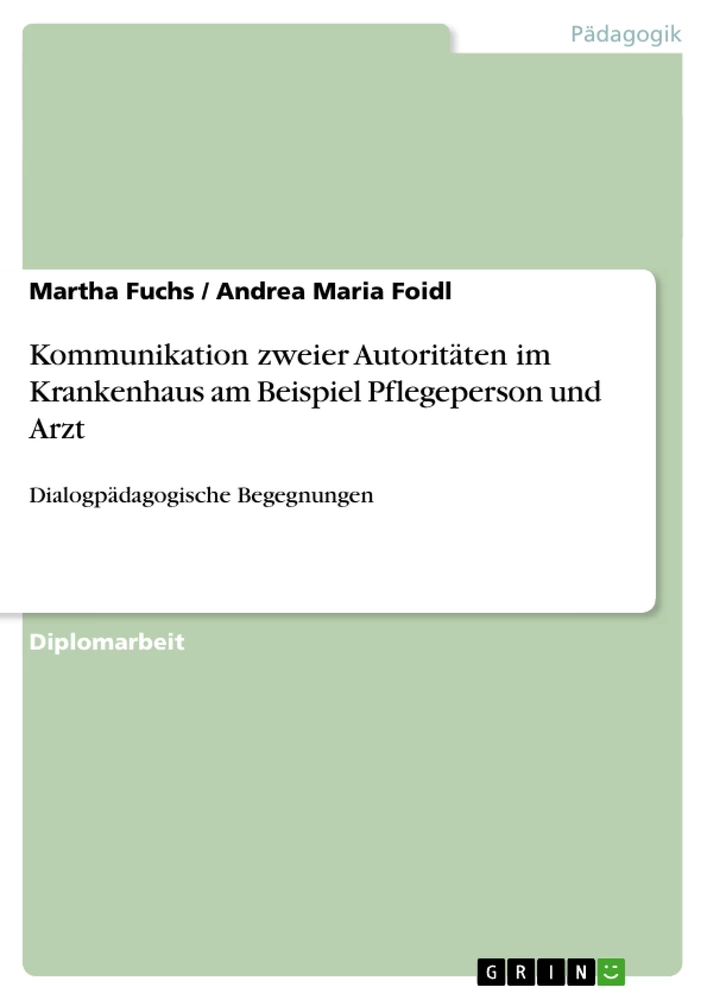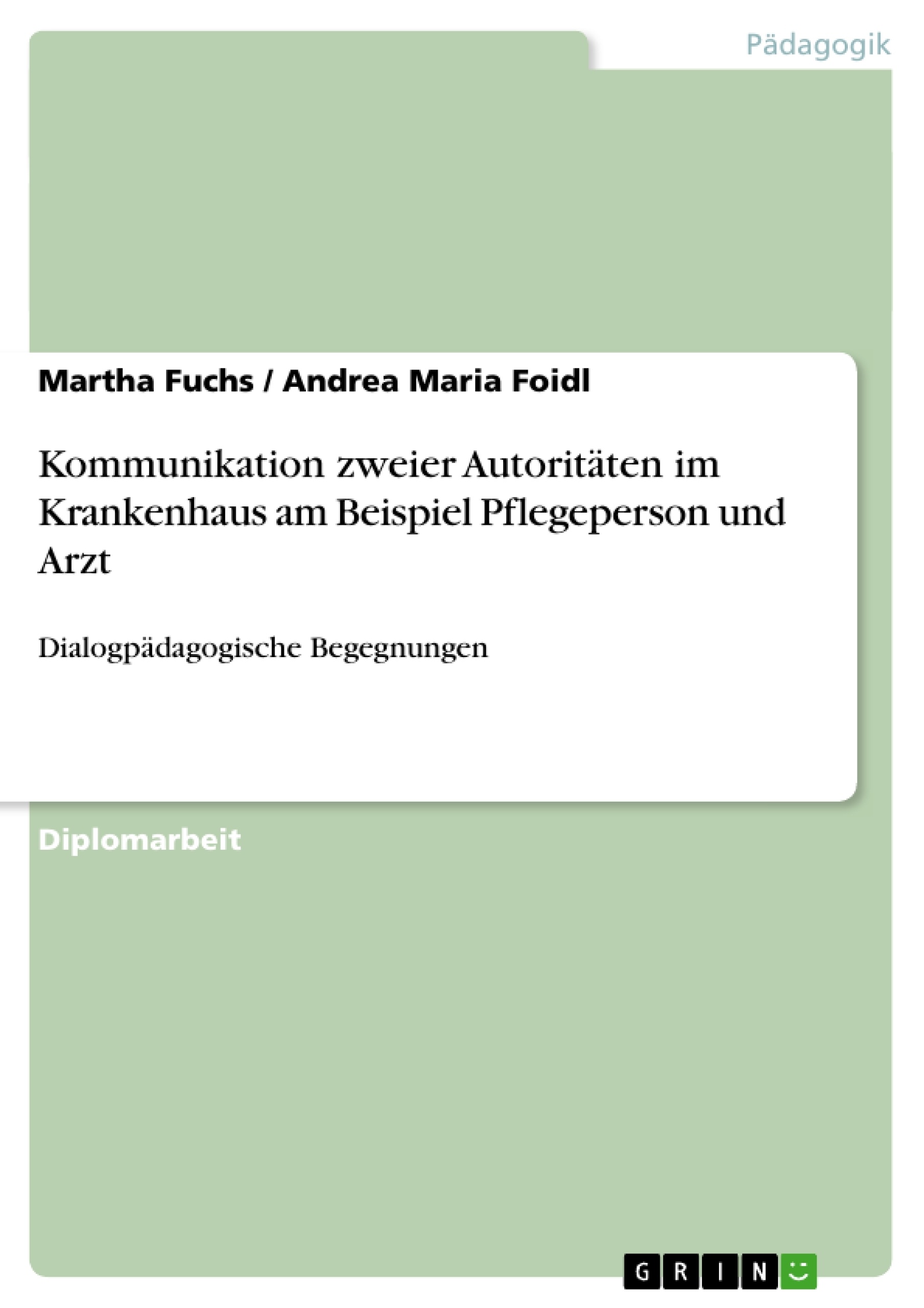Diese Diplomarbeit betrachtet das Thema Kommunikation am Arbeitsplatz Krankenhaus durch unterschiedlichste Brillen. Umfangreiche kommunikationswissenschaftliche als auch dialogpädagogische und betriebssoziologische Literatur bilden das grundlegende Material, mit dem gearbeitet wurde. Durch neue, zum Teil ungewohnte Herangehensweisen an die Thematik entstand eine breit angelegte Arbeit, die ein komplexes Bild der möglichen Kommunikationsformen zwischen Arzt und Pflegeperson gibt. Den Übergang vom theoretischen zum empirischen Teil bildet der Text "The Doctor-nurse-game revisited" von Stein et. al. Drei amerikanische Ärzte beschreiben darin die Beziehung zw. Pflegepersonen und Ärzten als eine Art Spiel mit klar definierten Hierarchien, das zum Ziel hat, offene Konflikte zu vermeiden. Das Vertrauen von Patienten in die allmächtige Profession Medizin soll damit gestützt werden. Durch immer stärker spürbare Professionalisierungsbestrebungen von Pflegepersonen bekommt das "Doctor-nurse-game" neue Spielregeln. Solche Neuorientierungen gehen zwangsläufig mit dem Aufdecken von Statuskonflikten einher und zeigen sich am deutlichsten in veränderten Kommunikationsformen. Die zum Teil bedrückenden Forschungsergebnisse bestätigen die Vermutung, dass nach wie vor starke Machtstrukturen am Arbeitsplatz Krankenhaus existieren. Weder Pflegenden noch Ärzten gelint es, Konflikte aus einer Metaperspektive heraus zu betrachten. Da Interessenskonflikte meist mit Statuskonflikten verknüpft sind, ist es notwendig, auch die Beziehungsebene miteinzubeziehen. Erst dann kann symmetrische Kommunikation gelingen. Das Betrachten der Sachebene alleine wird der Komplexität dieser Konflikte nicht gerecht. Anhand qualitativer Leitfadeninterviews konnten etliche interessante Ergebnisse entschlüsselt werden. Diese wurden nicht nur der klassischen kommunikationswissenschaftlichen Literatur sondern auch philosophischen Überlegungen gegenübergestellt. Die Schwerstarbeit Kommunikation, die Pflegende jeden Tag erbringen, wird noch nicht als Arbeitsleistung anerkannt. Mittels Lewis Hyde und seiner Theorie des Gabentauschs wird zu dieser Problematik ein ungewohnter Bogen gespannt, der in der Dialogphilosophie Bubers seine Fortsetzung findet. Die Forschungsergebnisse sind insofern mit Vorsicht zu betrachten, da nur Diplomiertes Pflegepersonal interviewt wurde. Die Sicht der Ärzte zu diesem Thema fehlt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Der Weg zum Thema
- Die Pflegeperson leistet kommunikative Schwerstarbeit
- Verwendete Literatur
- Web 2.0 und Atlas.ti - hilfreiche Werkzeuge
- Forschungsdesign
- Das Forschungsziel
- Stichprobe und Feldzugang - Datenaufbereitung und -auswertung
- Weitere Überlegungen
- Verwendete Theorien
- Allgemeines
- Wir reden miteinander – die Theorie von Schulz von Thun
- Anatomie der Nachricht - vom Sender zum Empfänger
- Die vier Ohren des Empfängers
- Die Interaktion von Sender und Empfänger
- Metakommunikation
- Die vier Seiten (Quadratur) der Nachricht
- Selbstoffenbarungsseite
- Sachseite
- Beziehungsseite
- Appellseite
- Kommunikationsstile
- Der helfende Stil
- Der aggressiv-entwertende Stil
- Der sich beweisende Stil
- Der bestimmend-kontrollierende Stil
- Richtige Kommunikation in jeder Situation
- Das Innere Team
- Das Oberhaupt
- Konflikte im Team
- Stammspieler vs. Antipoden
- Die Aufstellung
- Stimmige Kommunikation
- Kommunikationstheorie nach Watzlawick
- Die Axiome Watzlawicks und dazugehörige Störungen der Kommunikation
- Struktur von Kommunikationsprozessen
- Das dialogische Prinzip nach Martin Buber
- Einleitung
- Vom Ich zum Du
- Vom Ich zum Es
- Vergegnungen
- Authentizität
- Verantwortung und Sprache
- Das Zwischen
- Autorität - Macht
- Amtsautorität vs. personaler Autorität
- Macht
- Autoritäre und machtbehaftete Kommunikation
- Organisation
- Autorität in der Organisation
- Autoritätsbegriffe
- Der Legitimationsprozess
- Akzeptanz als Motor der Kooperation
- Gelungene Kommunikation als Grundlage zur Kooperation
- Die Pflege als Gabe – Kommunikation als Gabe?
- The Doctor-nurse game
- Zeit für ein neues Spiel
- 1967
- Veränderungen
- 1990
- Neue Spielregeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Ärzten im Krankenhaus. Ziel ist es, die Besonderheiten dieser Interaktion im Kontext von Autorität und Machtverhältnissen zu analysieren und dialogpädagogische Ansätze zur Verbesserung der Kommunikation aufzuzeigen.
- Kommunikation zwischen Autoritäten im Krankenhaus
- Dialogpädagogische Ansätze in der Arzt-Pflege-Kommunikation
- Theorie der Kommunikation nach Schulz von Thun und Watzlawick
- Das dialogische Prinzip nach Martin Buber
- Autorität und Macht in der Organisation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der Diplomarbeit einführt und die Forschungsmethodik erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die Kommunikationstheorie von Schulz von Thun und analysiert die vier Seiten einer Nachricht. Kapitel 3 widmet sich der Kommunikationstheorie nach Watzlawick und seinen Axiomen der Kommunikation. Kapitel 4 stellt das dialogische Prinzip nach Martin Buber vor und erörtert die Bedeutung von Dialog und Authentizität in der Kommunikation. Kapitel 5 befasst sich mit den Begriffen Autorität und Macht und deren Einfluss auf die Kommunikation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kommunikation, Autorität, Macht, Dialogpädagogik, Krankenhaus, Pflege, Arzt, Schulz von Thun, Watzlawick, Martin Buber, Organisation.
- Arbeit zitieren
- Martha Fuchs (Autor:in), Andrea Maria Foidl (Autor:in), 2010, Kommunikation zweier Autoritäten im Krankenhaus am Beispiel Pflegeperson und Arzt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157772