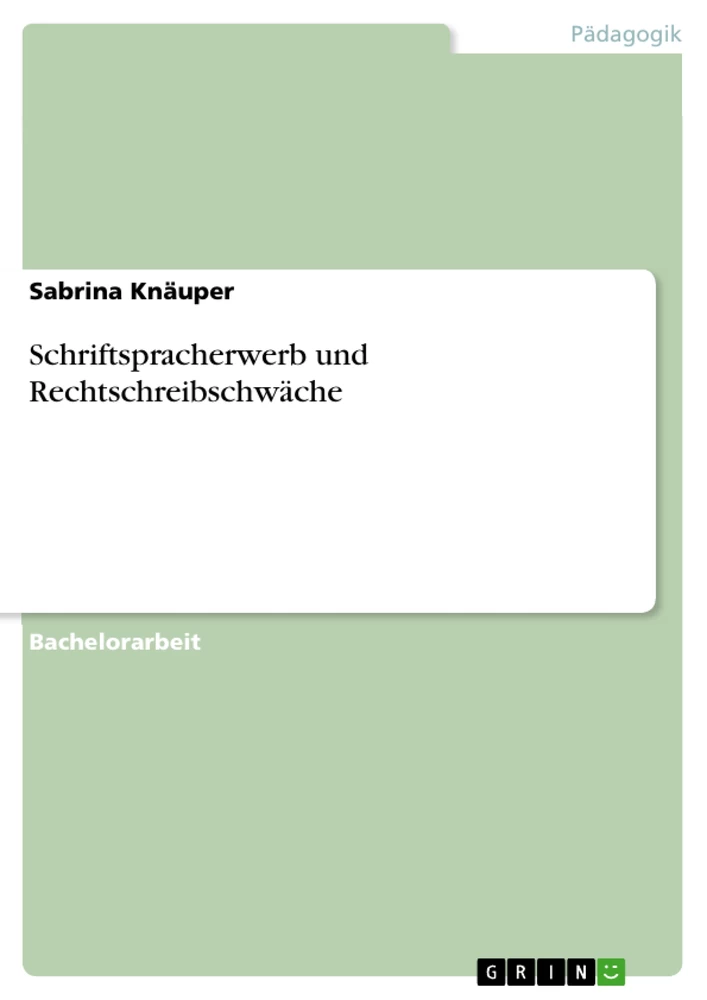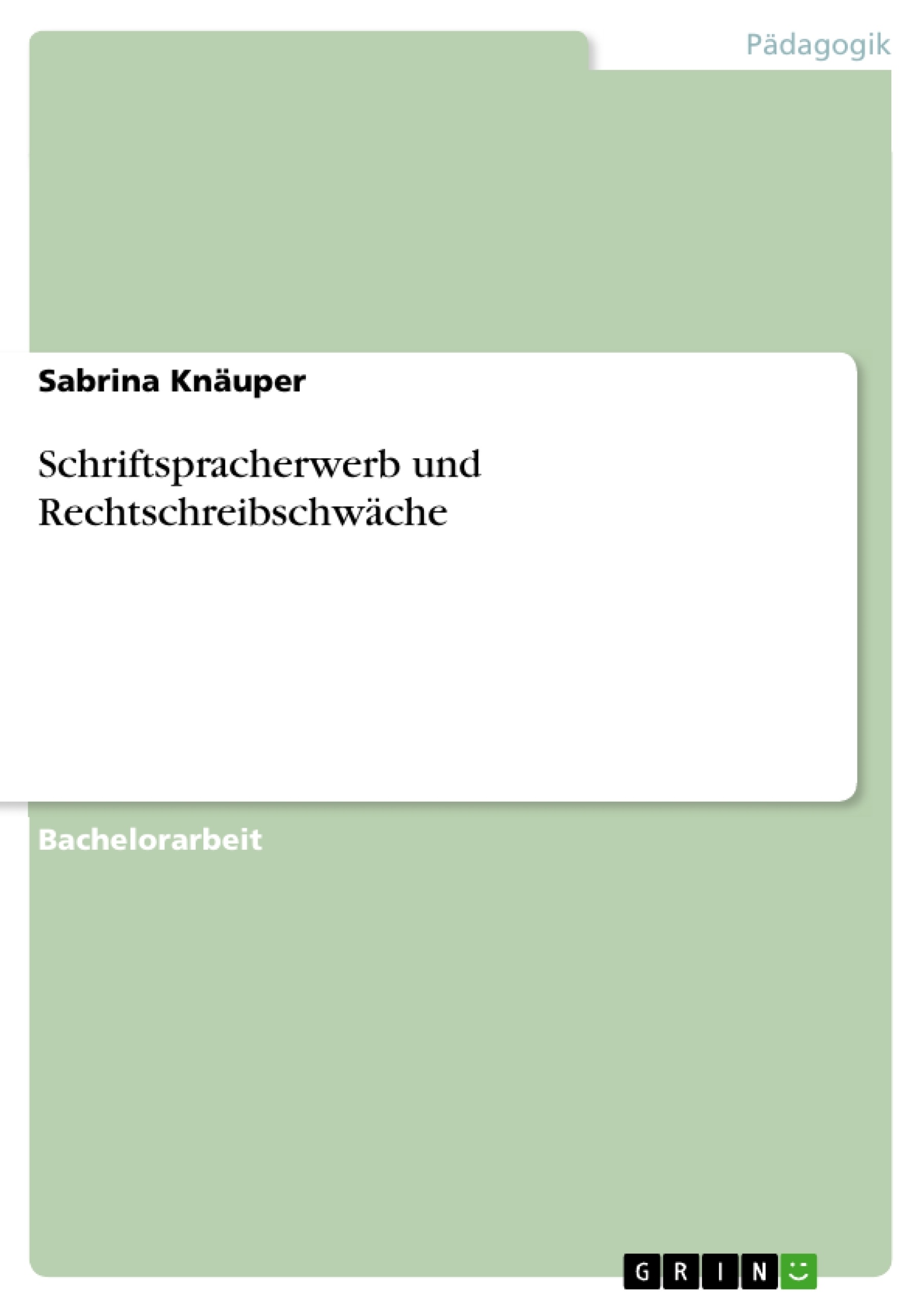Juni 2007 – wie immer zu dieser Jahreszeit starten in ganz Deutschland die Sommerferien. Einige Bundesländer haben schon die Ferienzeiten eingeläutet, in Niedersachen müssen die Kinder noch etwas bis zu den freien Tagen warten.
Für einige Schüler und Schülerinnen ist diese Vorfreude auf die sechswöchige Freizeit aber auch mit einem unguten Gefühl verbunden: Vorher müssen sie noch das Schuljahreszeugnis entgegen nehmen. Und dies fällt nicht immer gut aus. Auch in den Medien wird wieder über die guten, aber auch über die schlechten Noten der Schüler berichtet.
So tat es auch der Onlinedienst der Westfälischen Nachrichten am 20.06.2007:
„Zeugniszeit ist Leidenszeit für Kinder und Jugendliche, die sich mit Legasthenie quälen. Die Schulzeit ist gepflastert mit Misserfolgen, oft werden Betroffene von Mitschülern wegen ihrer Lese- und Rechtschreibstörung gehänselt. Geschriebene Wörter gleichen zuweilen einer wahllosen Aneinanderreihung von Buchstaben, die das gemeinte Wort bis zur Unkenntlichkeit entstellen “
Diese Berichterstattungen werfen natürlich die Frage auf, ob und wie man diesen Kindern helfen kann. Zuerst muss natürlich geklärt werden, ob das Kind an einer Lese-Rechtschreibschwäche leidet. In vielen Städten bieten Legasthenie-Zentren ihre Hilfe an. Diese Unterstützung findet in Form von außerschulischem Zusatzunterricht – und Training statt.
Doch ist es nur positiv zu bewerten, dass durch dieses „outsourcing“ die Arbeitsbelastung der Lehrer verringert wird? Sollten sich die Lehrer nicht persönlich und direkt mit den Problemen der Kinder befassen und selber einen Schreibtest durchführen und auswerten können?
In der Literatur sind unterschiedliche Schreibproben zu finden. Hierzu zählen u.a. die Münsteraner Rechtschreibanalyse (MRA), die Oldenburger Fehleranalyse (OLFA) und die Hamburger Schreibprobe (HSP).
In meiner Bachelor-Arbeit untersuche ich, inwieweit sich die Hamburger Schreibprobe im alltäglichen Schulleben einsetzen lässt. Hierbei wird u.a. auf den Zeitaufwand und die Einfachheit der Durchführung und Auswertung geachtet.
Zunächst wird der idealtypische Verlauf des Schriftspracherwerbs aufgezeigt, um im weiteren Verlauf auf den abweichenden Schriftspracherwerb und die damit verbundenen Rechtschreibschwierigkeiten der Kinder eingehen zu können. Auch die unterschiedlichen Folgen der Lernstörungen und die individuellen Förderungsmaßnahmen werden aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Idealtypischer Weg des Schriftspracherwerbs
- Wie Kinder die Schrift entdecken
- Entwicklungsstufen der Rechtschreibung
- Kritzelstufe: Vom ziellosen zum gerichteten Kritzeln
- Von der Linie zur Form
- Von der Buchstabenform zur Buchstabenfolge: Logographisches Schreiben
- Von der Buchstabenfolge zur lautorientierten „Skelettschreibung“: Halbphonetisches Stadium
- Von der lautorientierten „Skelettschreibung“ zur Lautschrift: Phonetische bzw. alphabetische Phase
- Von der Lautschrift zur Beherrschung von Rechtschreibregeln: Die orthographische Phase
- Zusammenwirken verschiedener Wahrnehmungsbereiche beim Schriftspracherwerb
- Lautanalysefähigkeit
- Auditive Diskriminationsfähigkeit
- Kinästhetische Diskriminationsfähigkeit
- Zusammenfassung und Kritik
- Abweichender Schriftspracherwerb
- Was ist überhaupt eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)?
- Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Kontext der Entwicklung
- Zur Definition von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS)
- Quantitative Definitionen
- Qualitative Ergänzungen durch die Entwicklungsanalyse
- Auswirkungen von Fehlfunktionen der Wahrnehmungsbereiche
- Besondere Schwierigkeiten bei der visuellen Wahrnehmung
- Besondere Schwierigkeiten beim Einprägen der Buchstaben-Laut-Zuordnung
- Besondere Schwierigkeiten beim Unterscheiden ähnlicher Laute und Buchstaben
- Zusammenfassung und Kritik
- Ermittlung der Rechtschreibkompetenzen – Die Hamburger Schreibprobe im Einsatz
- Die Hamburger Schreibprobe (HSP) im Einsatz: Was leistet diese Probe?
- Durchführung
- Auswertungen
- Ergebnisse
- Zusammenfassung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Schriftspracherwerb und Rechtschreibschwächen. Sie untersucht den idealtypischen Verlauf des Schriftspracherwerbs und analysiert die Ursachen und Folgen von abweichendem Schriftspracherwerb, insbesondere Lese-Rechtschreibschwächen (LRS). Die Arbeit zeigt die Funktionsweise der Hamburger Schreibprobe (HSP) auf und beleuchtet ihre Eignung für die Diagnose von Rechtschreibkompetenzen im Schulunterricht.
- Der idealtypische Verlauf des Schriftspracherwerbs
- Die Entstehung und Ausprägung von Rechtschreibschwierigkeiten
- Die Anwendung und Auswertung der Hamburger Schreibprobe
- Die Folgen von Lernstörungen und die Bedeutung gezielter Förderung
- Die Bedeutung der frühzeitigen Diagnose und Intervention bei Lese-Rechtschreibschwächen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz des Themas durch die Darstellung der Herausforderung, die Kinder mit Lese-Rechtschreibschwächen im Schulalltag erleben. Die Hamburger Schreibprobe wird als Instrument zur Erfassung der Rechtschreibkompetenzen vorgestellt.
Kapitel zwei beschreibt den idealtypischen Verlauf des Schriftspracherwerbs. Es werden die verschiedenen Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs erläutert, die Kinder durchlaufen, sowie die Bedeutung verschiedener Wahrnehmungsbereiche für den Schriftspracherwerb.
Kapitel drei analysiert den abweichenden Schriftspracherwerb und seine Ursachen, insbesondere die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS). Es werden verschiedene Definitionen und Ursachen von LRS diskutiert, sowie die Auswirkungen von Fehlfunktionen in den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen auf den Schriftspracherwerb.
Kapitel vier befasst sich mit der Hamburger Schreibprobe als Instrument zur Ermittlung der Rechtschreibkompetenzen. Es beschreibt die Durchführung und Auswertung der Schreibprobe und diskutiert ihre Einsatzmöglichkeiten im Schulunterricht.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Rechtschreibschwäche, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Hamburger Schreibprobe (HSP), Entwicklungsstufen, Wahrnehmungsbereiche, Diagnose, Förderung.
- Quote paper
- Sabrina Knäuper (Author), 2007, Schriftspracherwerb und Rechtschreibschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/157726