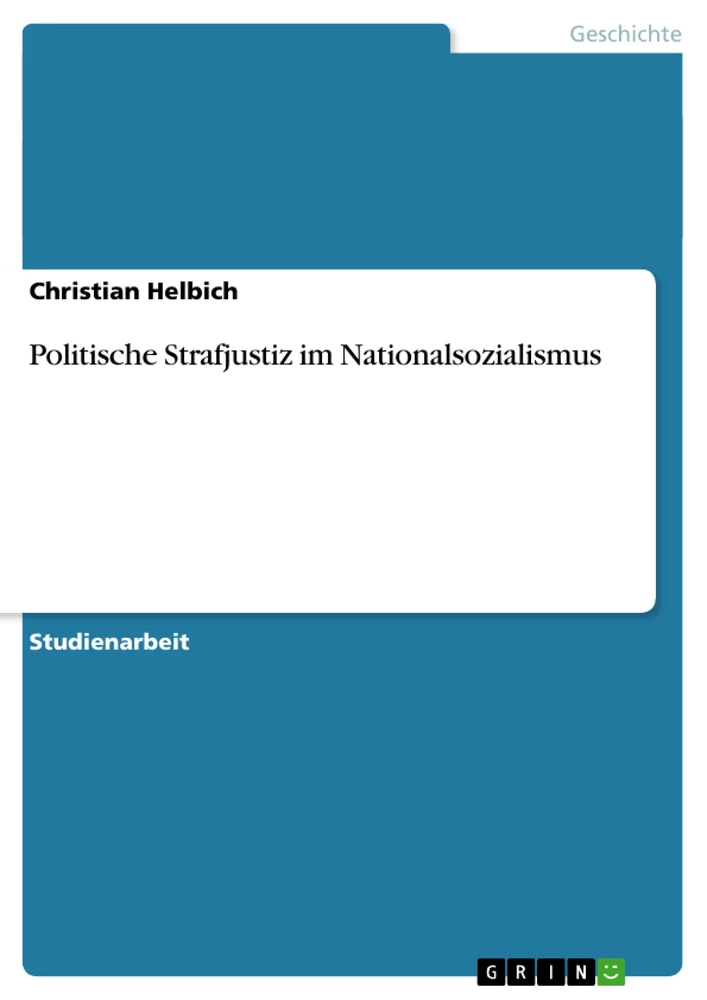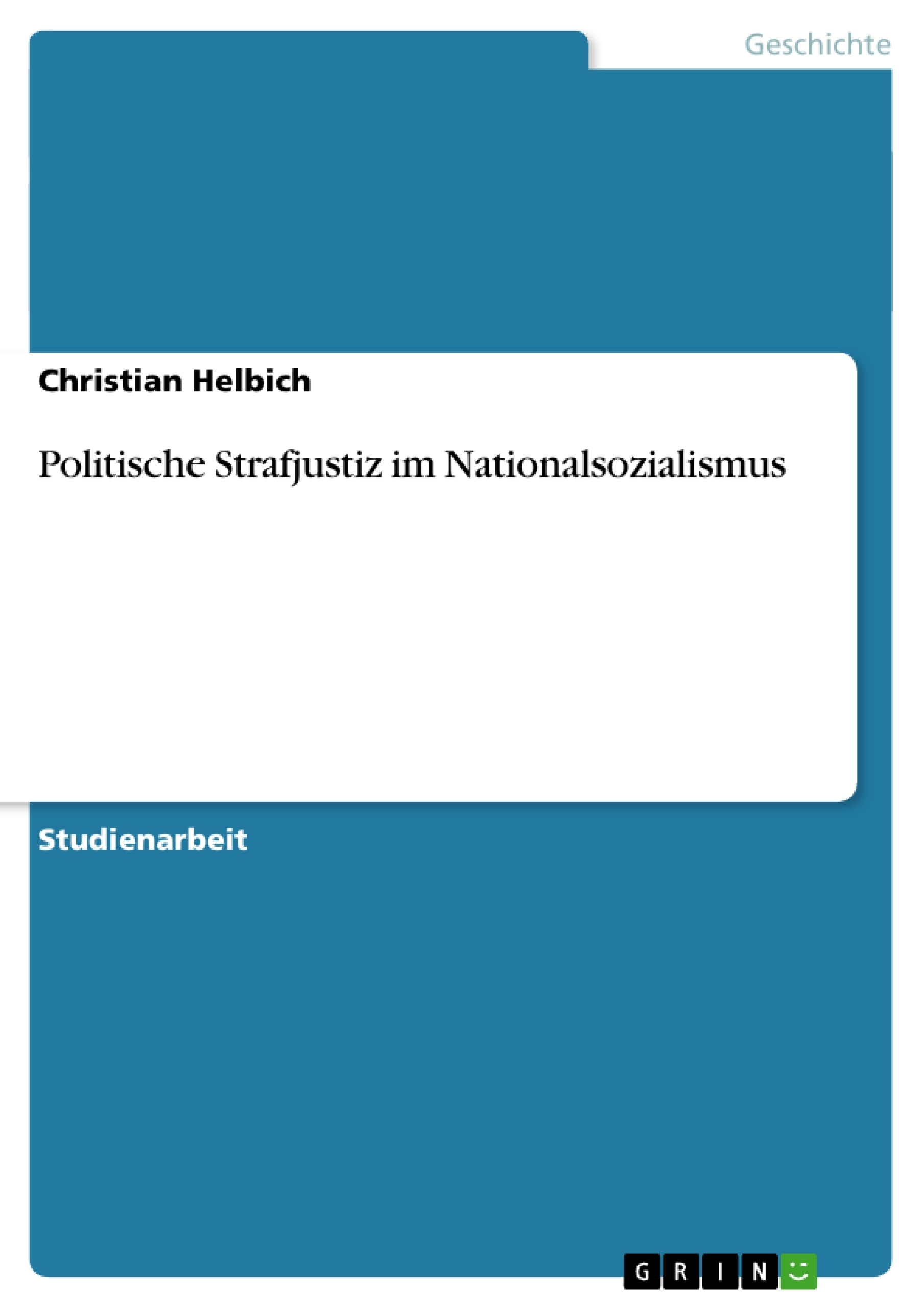In dieser Arbeit soll die nationalsozialistische Strafjustiz im Mittelpunkt stehen. Von den ca. 60.000
Todesurteilen im Nationalsozialismus wurden 16.000 durch die Ordentliche Justiz (z.B. Reichsgericht
und später auch durch den Volksgerichtshof, im Folgenden VGH) verhängt, über 40.000 durch die
Kriegsgerichte allein in den Jahren 1941-44. Dagegen kam es im 1. Weltkrieg zu „nur“ 300 Todesurteilen,
die nur zum Teil vollstreckt wurden.1
Im ersten Abschnitt soll die Justiz zur Zeit der Weimarer Republik kurz beleuchtet werden. Hier
stellte sich mir die Frage, wie die Richterschaft zur Demokratie eingestellt war und wie sie sich nach
der Machtergreifung Hitlers so schnell in das neue System einfügen konnte. Des Weiteren werde ich
hier auch die nationalsozialistische Strafrechtsideologie und die sich anschließenden Strafrechtsänderungen
und -neuerungen betrachten.
Im Hauptteil sollen dann Sondergerichte und der VGH analysiert werden. Hierbei werde ich jeweils
auf die Gründung, die Zusammensetzung, ihre jeweiligen Zuständigkeiten und Besonderheiten eingehen.
Anschließend soll der Weg eines Prozesses von der Ermittlung bis zur Urteilsvollstreckung betrachtet
werden. Hier war mir von Interesse, inwieweit die Geheime Staatspolizei (Gestapo) in die
Justiz involviert war, ob es Konflikte oder auch Zusammenarbeit mit der Justiz gab.
Abschließend werde ich den Umgang mit der NS-Justiz in der Nachkriegszeit betrachten, ob es eine
Aufarbeitung gab oder die eigene Vergangenheit von der Nachkriegsjustiz verdrängt wurde. Am Ende
sollen die Ergebnisse kurz zusammengefasst werden.
Im Anhang habe ich neben dem Literaturverzeichnis zur besseren Anschaulichkeit eine Übersicht
der wichtigsten Strafrechtsänderungen im Nationalsozialismus zusammengefasst. Zudem drucke ich
die wichtigsten Gesetze oder Gesetzespassagen ab.
1 Monika Frommel, Verbrechensbekämpfung im Nationalsozialismus, In: Franz Jürgen Säcker (Hg.), Recht
und Rechtslehre im Nationalsozialismus, Baden-Baden 1992, S. 185; Helmut Ortner, Der Hinrichter. Roland
Freisler – Mörder im Dienste Hitlers, Wien 1993, S. 304f.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Aufbau der Arbeit
- 1.2. Forschungsstand und Literaturlage
- 2. AUF DEM WEG ZUR NATIONALSOZIALISTISCHEN JUSTIZ
- 2.1. Justiz und Richterschaft in der Weimarer Republik
- 2.2. Gleichschaltung oder Selbstgleichschaltung?
- 2.3. NS-Strafrechtsideologie
- 2.4. Änderungen und Neuerungen im Strafrecht
- 3. VOLKSGERICHTSHOF UND SONDERGERICHTE
- 3.1. Volksgerichtshof
- 3.1.1. Gründung und Zweck
- 3.1.2. Zusammensetzung
- 3.1.3. Roland Freisler - Präsident des VGH
- 3.1.4. Zuständigkeiten
- 3.1.5. Besonderheiten
- 3.1.6. Bedeutung
- 3.2. Sondergerichte
- 3.2.1. Gründung und Zweck
- 3.2.2. Zusammensetzung
- 3.2.3. Zuständigkeiten
- 3.2.4. Besonderheiten
- 3.2.5. Bedeutung
- 3.1. Volksgerichtshof
- 4. VERFAHREN VOR GERICHT
- 4.1. Denunziation
- 4.2. Ermittlungen der Gestapo
- 4.3. Prüfung durch die Staatsanwaltschaft
- 4.4. Gerichtsverhandlung
- 4.5. Urteil
- 4.6. Außerordentlicher Einspruch und Gnadenverfahren
- 4.7. Strafvollzug
- 4.8. Zusammenarbeit und Kompetenzkonflikte der Justiz mit der Gestapo
- 5. AUFARBEITUNG IN DER NACHKRIEGSZEIT?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der politischen Strafjustiz im Nationalsozialismus und untersucht den Wandel des Rechtsystems von der Weimarer Republik bis zur NS-Diktatur. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Justiz unter dem Einfluss des nationalsozialistischen Regimes, insbesondere die Gründung und Funktionsweise des Volksgerichtshofes und der Sondergerichte, zu analysieren.
- Die Rolle der Justiz in der Weimarer Republik und ihre Anpassung an die NS-Ideologie
- Die Entwicklung der nationalsozialistischen Strafrechtsideologie und ihre Auswirkungen auf die Rechtspraxis
- Die Funktionsweise und Bedeutung des Volksgerichtshofes und der Sondergerichte
- Die Verfahren vor den NS-Gerichten, von der Denunziation bis zur Urteilsvollstreckung
- Die Aufarbeitung der NS-Justiz in der Nachkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung legt den Fokus auf den Aufbau der Arbeit und skizziert die Forschungslage zu den Themen nationalsozialistische Justiz und die Rolle der Richterschaft in der Weimarer Republik. Sie präsentiert Statistiken über die Zahl der Todesurteile in der NS-Zeit im Vergleich zum Ersten Weltkrieg und erläutert kurz die Themen der einzelnen Kapitel.
- Kapitel 2: Auf dem Weg zur nationalsozialistischen Justiz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Justiz von der Weimarer Republik zur NS-Herrschaft. Es analysiert die Einstellung der Richterschaft zur Demokratie und die Anpassungsprozesse nach der Machtergreifung Hitlers. Des Weiteren beleuchtet das Kapitel die Entwicklung der NS-Strafrechtsideologie und die daraus resultierenden Änderungen im Strafrecht.
- Kapitel 3: Volksgerichtshof und Sondergerichte: Dieses Kapitel analysiert die Gründung, Zusammensetzung, Zuständigkeiten und Besonderheiten des Volksgerichtshofes sowie der Sondergerichte. Es beleuchtet auch die Bedeutung dieser Gerichte im NS-System.
- Kapitel 4: Verfahren vor Gericht: Dieses Kapitel betrachtet den Prozessweg von der Denunziation bis zur Urteilsvollstreckung, insbesondere die Rolle der Gestapo und die Zusammenarbeit der Justiz mit der Polizei.
Schlüsselwörter
Politische Strafjustiz, Nationalsozialismus, Volksgerichtshof, Sondergerichte, Gestapo, Strafrechtsideologie, Gleichschaltung, Selbstgleichschaltung, Weimarer Republik, NS-Justiz, Aufarbeitung, Nachkriegszeit, Rechtsprechung, Todesurteile, Richterschaft, Rechtsstaat, Rechtswissenschaft, Prozess, Denunziation, Ermittlungen, Gerichtsverhandlung, Urteil, Strafvollzug.
- Quote paper
- Christian Helbich (Author), 2003, Politische Strafjustiz im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/15727