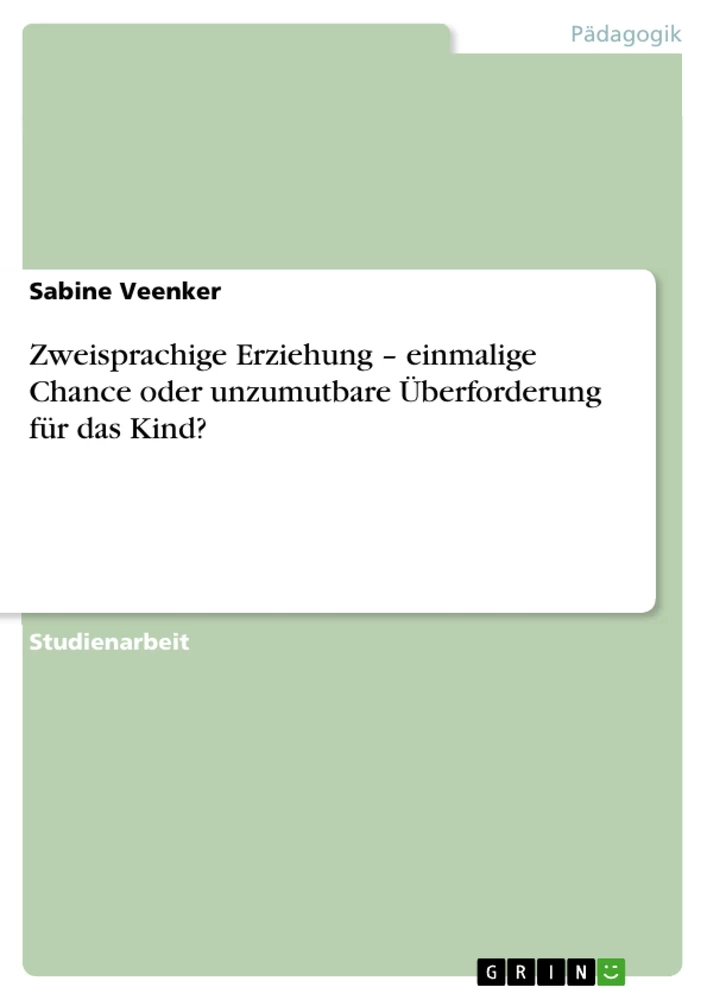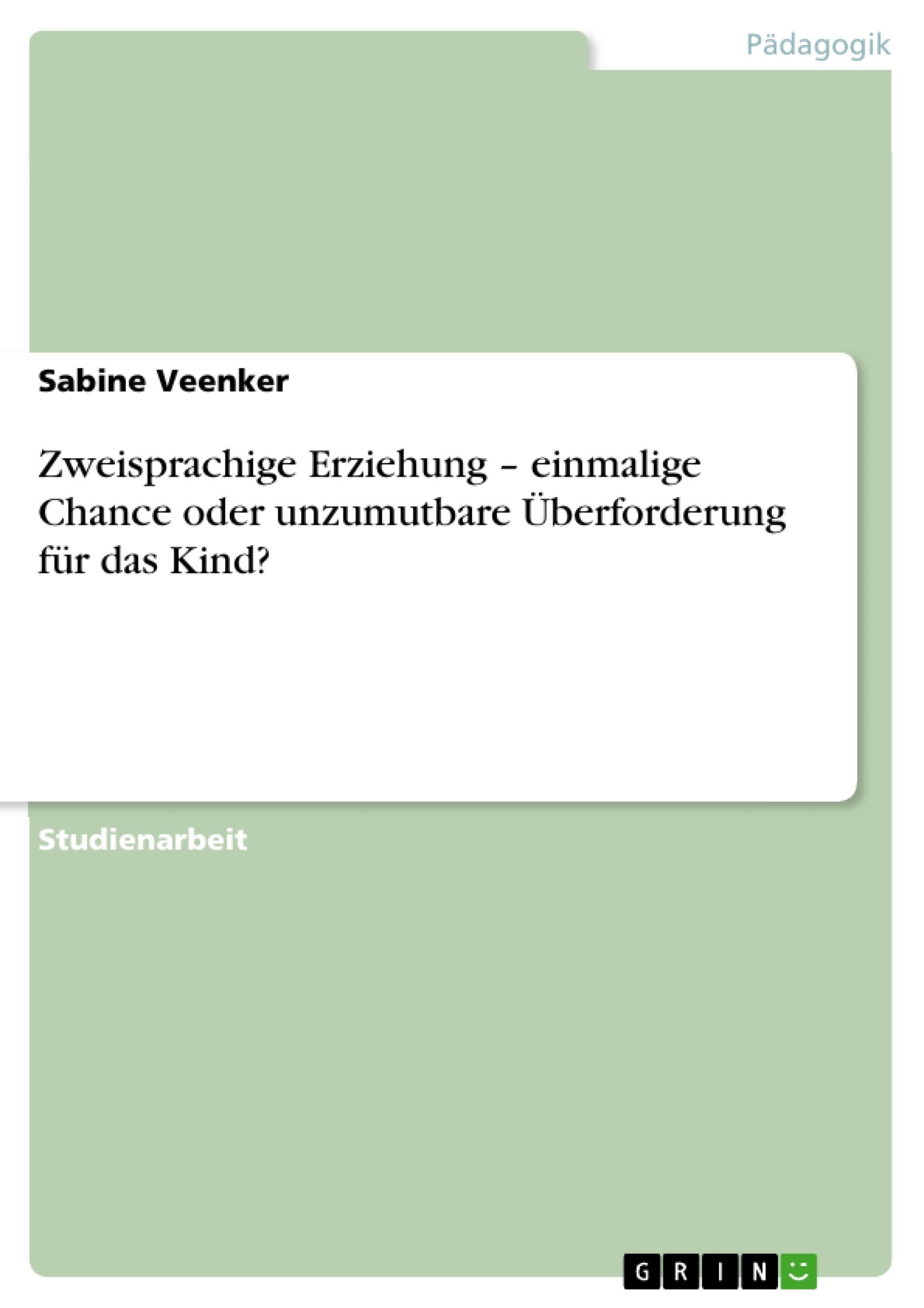3 Ziel- und Aufgabenstellung
Ziel- und Aufgabenstellung dieser Hausarbeit ist es, verschiedene As-pekte der bilingualen Erziehung näher zu beleuchten. Eltern, die ihre Kinder zweisprachig erziehen, sind oftmals vielen Vorurteilen ausgesetzt. Ihnen wird u.a. vorgeworfen, ihr Kind zu überfordern oder seiner Entwicklung durch die zweisprachige Erziehung entgegenzuwirken. Doch was stimmt denn eigentlich nun? Ist die zweisprachige Erziehung eine einmalige Chance, eine zweite Sprache auf muttersprachlichem Niveau zu erlernen oder ist es eine unzumutbare Überforderung, so dass das Kind am Ende keine der beiden Sprachen richtig spricht?
Daher liegt ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit auf den sprachlichen Problemen der zweisprachigen Erziehung. Welche Probleme haben bilinguale Kinder in ihren Sprachen? Sprechen sie beide Sprachen auf muttersprachlichem Niveau oder sprechen sie eine Mischsprache? Weiterhin sollen mögliche Ursachen für Probleme in den Sprachen näher erläutert und ggf. Vorschläge gemacht werden, wie man als Eltern mit diesen sprachlichen Problemen umgehen kann.
Natürlich spielen in bilingualen Familien auch die kulturellen Aspekte eine große Rolle. Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit aber nicht zu sprengen, soll sich lediglich auf die sprachlichen Aspekte der bilingualen Erziehung beschränkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel- und Aufgabenstellung
- Methodologisches Vorgehen
- Theoretische Ausgangsposition
- Vorurteile
- Probleme in den Sprachen
- Sprachmischung
- Interferenz
- Semilingualismus
- Sprachverweigerung
- Stottern
- Die sechs Typen des Zweitspracherwerbs
- Sprachförderung durch die Eltern
- Befragung bilingualer Personen oder deren Eltetern
- Ergebnisse der Befragung
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit verschiedenen Aspekten der bilingualen Erziehung. Ziel ist es, Vorurteile gegenüber der zweisprachigen Erziehung zu beleuchten und die sprachlichen Herausforderungen für bilinguale Kinder zu untersuchen. Dabei wird insbesondere auf die Frage eingegangen, ob die zweisprachige Erziehung eine einmalige Chance oder eine unzumutbare Überforderung für das Kind darstellt.
- Vorurteile gegenüber der bilingualen Erziehung
- Sprachliche Probleme bilingualer Kinder
- Mögliche Ursachen für sprachliche Probleme
- Strategien und Sprachförderung durch die Eltern
- Vergleich von Theorie und Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Bedeutung der zweisprachigen Erziehung im Kontext der Globalisierung und Migration.
- Ziel- und Aufgabenstellung: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und Fragestellungen der Hausarbeit, die sich auf die Untersuchung der Vorurteile und Herausforderungen der zweisprachigen Erziehung fokussieren.
- Methodologisches Vorgehen: Das Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammensetzt. Der theoretische Teil stützt sich auf die Analyse bestehender Literatur, während der praktische Teil eine Befragung bilingualer Personen oder deren Eltern umfasst.
- Theoretische Ausgangsposition: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der bilingualen Erziehung vor, indem es verschiedene Aspekte wie Vorurteile, sprachliche Probleme, Strategien und die Rolle der Eltern in der Sprachförderung beleuchtet.
- Befragung bilingualer Personen oder deren Eltetern: Das Kapitel erläutert die durchgeführte Befragung und präsentiert erste Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der vorliegenden Arbeit sind die zweisprachige Erziehung, Vorurteile, sprachliche Probleme, Sprachförderung, Sprachmischung, Interferenz, Semilingualismus, Sprachverweigerung, Stottern und die Vergleichbarkeit von Theorie und Praxis.
- Quote paper
- Sabine Veenker (Author), 2010, Zweisprachige Erziehung – einmalige Chance oder unzumutbare Überforderung für das Kind?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/153008