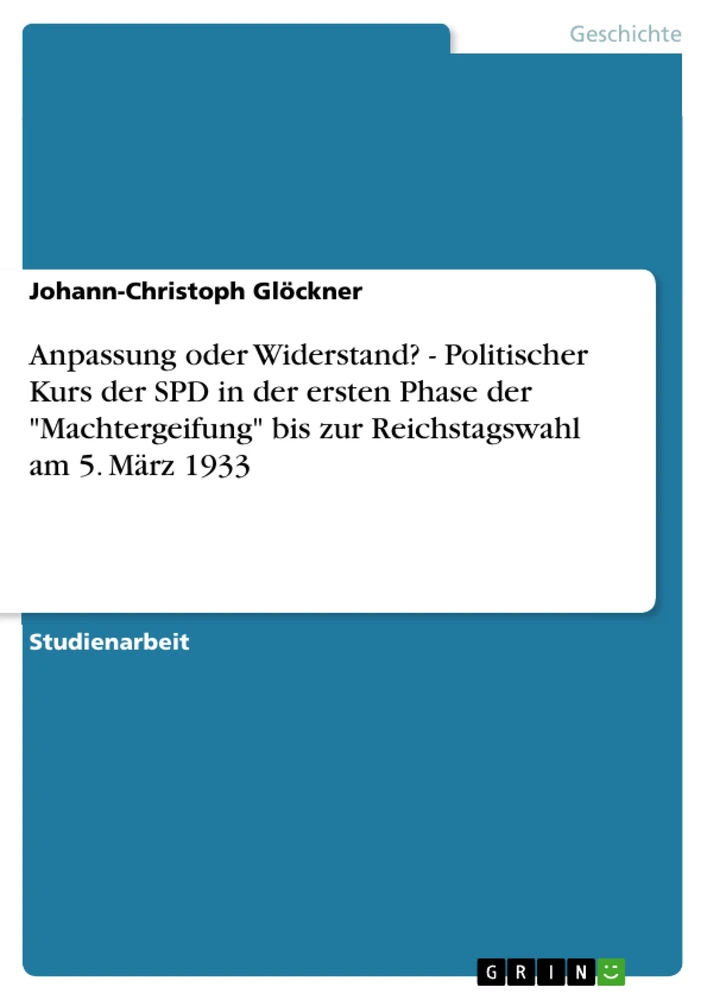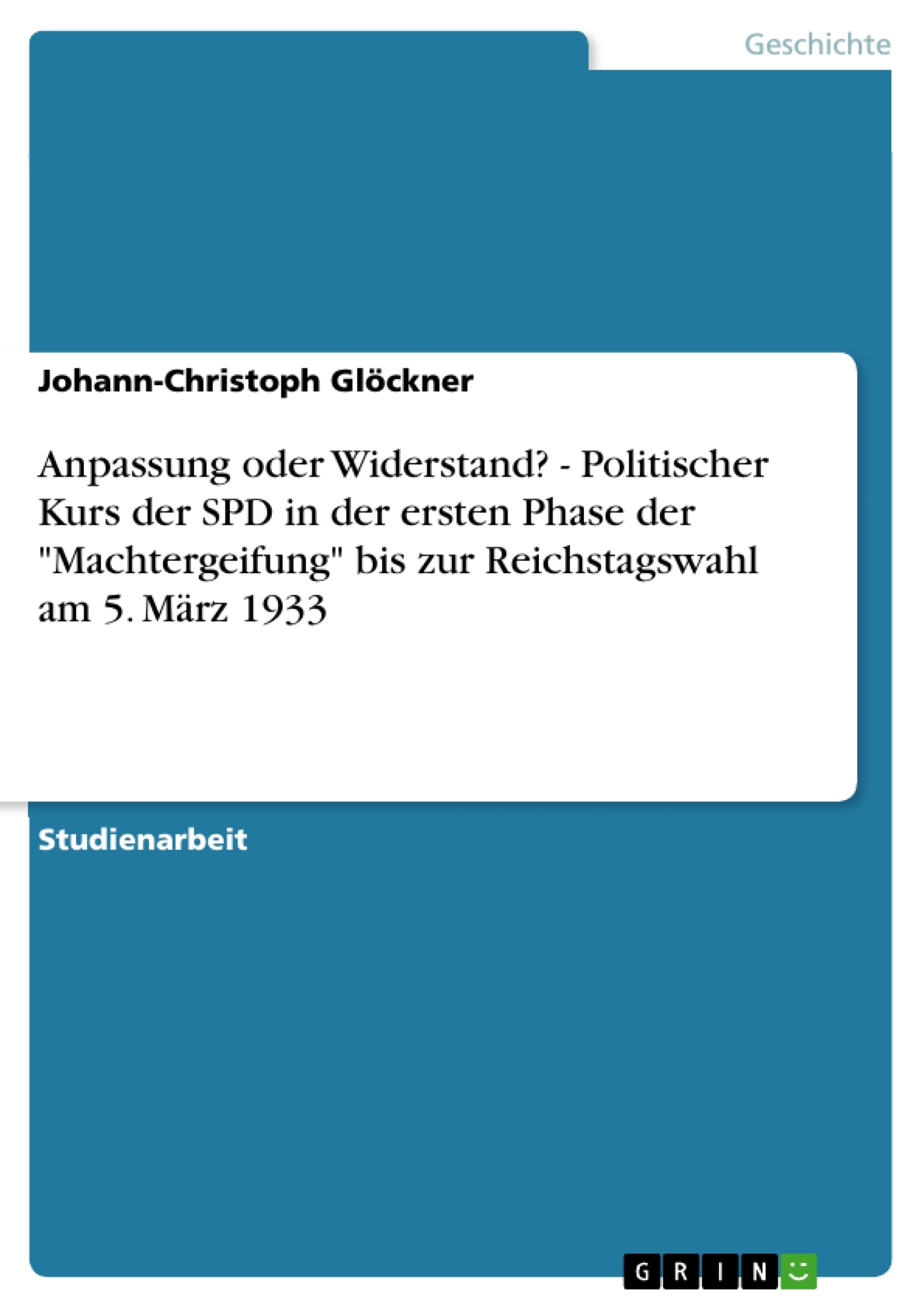„Wir stehen selbstverständlich zu der Regierung Hitler in der schärfsten Opposition, viel schärfer als zu der Regierung Papen und Schleicher“. Dieses Zitat des damaligen SPD-Vorstandsmitglieds Rudolf Breitscheid schildert die sozialdemokratische Reaktion auf die tags zuvor stattgefundene Ernennung Adolf Hitlers zum Kanzler durch Reichpräsident Hindenburg. Es entstammt einer vor dem Parteiausschuss gehaltenen Rede, die noch am selben Abend in etwas entschärfter Form in der Parteizeitung „Vorwärts“ veröffentlicht wurde.
Im Zentrum der vorliegenden Proseminararbeit steht die Frage, wie das Agieren der SPD-Führung in der ersten Phase der „Machtergreifung“ der NSDAP bis zu den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 zu beurteilen ist: Welche Momente im Reichstagswahlkampf der Arbeiterpartei deuten also auf eine Art von Widerstand gegen das Kabinett um Hitler, Franz von Papen (Zentrum) und Alfred Hugenberg (DNVP) hin, wo lässt sich eher eine Haltung der Anpassung an die rasch um sich greifende NS-Repression feststellen, und wie ist der sozialdemokratische Kurs am Beginn der sich errichtenden nationalsozialistischen Diktatur insgesamt einzuordnen.
Zunächst bildet die unmittelbare „freie“ Reaktion der Parteispitze auf die Vereidigung des Hitler-Kabinetts am 30. Januar 1933 einen Schwerpunkt der Arbeit, da bereits mit dem 3. Februar eine nationalsozialistische Welle von Verboten und Notverordnungen nach Art. 48 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung, gepaart mit einer Vielzahl an Terrorakten der SA, einsetzte, die den Aktionsradius der Arbeiterpartei im Wahlkampf zunehmend einschränkte. Im Bezug auf einzelne einschneidende, staatliche Maßnahmen, insbesondere die Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar, soll untersucht werden, inwieweit innerhalb der Partei der Wille zu aktivem Widerstand noch bestand. Anschließend wird die Bedeutung des Reichstagswahlergebnisses vom 5. März für die sozialdemokratische Entwicklung erörtert, bevor die Resultate dieser Hausarbeit im letzten Kapitel kurz zusammengefasst werden. Die Hauptliteratur, die für diese Proseminararbeit herangezogen wurde, sind Darstellungen von Lewis Joachim Edinger, Erich Matthias, Detlef Lehnert und Bärbel Hebel-Kunze.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Reaktion der SPD-Führung auf die Berufung Hitlers
- 2.1 „Bereit sein ist alles!“ - Die Rede Rudolf Breitscheids im Parteiausschuss
- 2.2 Parteiaufruf vom 2. Februar 1933
- 3. Taktieren der Parteispitze im Zuge der entstehenden NS-Repression
- 3.1 Die Reichstagsbrandverordnung als entscheidende Zäsur
- 4. Reichstagswahl vom 5. März 1933
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reaktion der SPD-Führung auf die Ernennung Hitlers zum Kanzler im Januar 1933 und deren Agieren in der ersten Phase der NS-Machtergreifung bis zu den Reichstagswahlen im März 1933. Es wird analysiert, inwieweit die SPD Widerstand leistete oder sich der NS-Repression anpasste. Die Arbeit konzentriert sich auf die ersten Wochen nach Hitlers Ernennung und die Reichstagswahl.
- Die unmittelbare Reaktion der SPD-Führung auf die Ernennung Hitlers.
- Die Rolle des Parteiaufrufs vom 2. Februar 1933 im Wahlkampf.
- Das Taktieren der Parteispitze angesichts der zunehmenden NS-Repression.
- Die Bedeutung der Reichstagsbrandverordnung für die SPD.
- Die Bewertung des sozialdemokratischen Kurses zu Beginn der NS-Diktatur.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bewertung des Agierens der SPD-Führung in der ersten Phase der NS-Machtergreifung. Sie umreißt den zeitlichen Fokus (bis zur Reichstagswahl vom 5. März 1933) und die methodische Vorgehensweise, die sich auf die Analyse von Widerstand und Anpassung konzentriert. Die Einleitung benennt die wichtigsten Sekundärliteraturquellen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die einleitende Zitation Breitscheids verdeutlicht die anfängliche Opposition der SPD gegen die Hitler-Regierung.
2. Reaktion der SPD-Führung auf die Berufung Hitlers: Dieses Kapitel analysiert die anfängliche Reaktion der SPD auf die Ernennung Hitlers. Es untersucht die defensive und abwartende Politik der SPD-Führung im Kontext der Präsidialkabinette und den Kontrast zum aktivistischen Widerstand der Eisernen Front. Die divergierenden Haltungen innerhalb der Partei werden beleuchtet, wobei die Notwendigkeit eines geänderten Parteikurses diskutiert wird. Die spontanen Arbeiterproteste nach Hitlers Ernennung werden als wichtiger Aspekt der Situation hervorgehoben.
2.1 „Bereit sein ist alles!“ - Die Rede Rudolf Breitscheids im Parteiausschuss: Die Zusammenfassung dieser Rede von Breitscheid zeigt den Appell an die Parteibasis zum Abwarten und die Vermeidung außerparlamentarischer Aktionen. Die Rede analysiert die Situation als Folge der Präsidialkabinette, warnt vor voreiligen Aktionen aufgrund der drohenden Unterdrückung und betont die Notwendigkeit, sich auf den entscheidenden Moment des Verfassungsbruchs vorzubereiten. Die Frage nach der Bereitschaft der Parteiführung zu aktivem Widerstand wird kritisch hinterfragt und die unterschiedlichen Interpretationen dieser Rede durch verschiedene Historiker werden erwähnt. Das Fehlen konkreter Handlungsanweisungen wird als Schwäche der Rede interpretiert.
2.2 Parteiaufruf vom 2. Februar 1933: Die Zusammenfassung dieses Kapitels analysiert den Wahlkampfaufruf der SPD vom 2. Februar 1933. Dieser Aufruf zeichnete sich durch scharfe Angriffe auf die Regierung und die Betonung sozialdemokratischer Ziele aus. Die Rückkehr zu den programmatischen Zielen von 1891 wird interpretiert und die möglichen Gründe hierfür, wie z. B. die Abgrenzung zum Kommunismus und der Versuch, unsichere Wähler zurückzugewinnen, werden besprochen. Die explizite Bekräftigung der Bereitschaft zum Widerstand gegen die Regierung wird hervorgehoben.
3. Taktieren der Parteispitze im Zuge der entstehenden NS-Repression: Dieses Kapitel behandelt die Reaktion der SPD auf die zunehmende NS-Repression, insbesondere nach dem Verbot des „Vorwärts“ und dem Inkrafttreten der Reichstagsbrandverordnung. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen der staatlichen Repressionsmaßnahmen auf die Handlungsmöglichkeiten der SPD und untersucht, inwieweit der Wille zu aktivem Widerstand innerhalb der Partei weiterhin bestand. Die Analyse befasst sich mit den konkreten Einschränkungen der Presse- und Versammlungsfreiheit und deren Folgen für die politische Arbeit der Sozialdemokraten. Die zunehmende Repression wird im Zusammenhang mit dem sozialdemokratischen Wahlaufruf analysiert.
Schlüsselwörter
SPD, Adolf Hitler, NS-Machtergreifung, Reichstagswahl 1933, Widerstand, Anpassung, Reichstagsbrandverordnung, Eiserne Front, Rudolf Breitscheid, Repression, Weimarer Republik, Parteiaufruf, „Vorwärts“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur SPD-Reaktion auf die NS-Machtergreifung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reaktion der SPD-Führung auf Hitlers Ernennung zum Kanzler im Januar 1933 und deren Handeln in der ersten Phase der NS-Machtergreifung bis zur Reichstagswahl im März 1933. Der Fokus liegt auf der Analyse von Widerstand und Anpassung der SPD gegenüber der zunehmenden NS-Repression.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die unmittelbare Reaktion der SPD-Führung, die Rolle des Parteiaufrufs vom 2. Februar 1933, das Taktieren der Parteispitze angesichts der Repression, die Bedeutung der Reichstagsbrandverordnung und die Bewertung des sozialdemokratischen Kurses zu Beginn der NS-Diktatur. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rede Rudolf Breitscheids und dem Wahlkampf der SPD.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Reaktion der SPD-Führung auf Hitlers Berufung (inkl. Analyse der Breitscheid-Rede und des Parteiaufrufs vom 2. Februar 1933), ein Kapitel zum Taktieren der Parteispitze unter NS-Repression, ein Kapitel zur Reichstagswahl vom 5. März 1933 und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Sekundärliteratur, die in der Einleitung genannt wird. Die Analyse basiert auf der Untersuchung der Reaktionen der SPD-Führung auf die Ereignisse der NS-Machtergreifung.
Welche zentrale Frage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie ist das Agieren der SPD-Führung in der ersten Phase der NS-Machtergreifung zu bewerten? Im Fokus steht dabei die Abwägung von Widerstand und Anpassung an die neue Situation.
Welche Rolle spielte die Rede Rudolf Breitscheids?
Breitscheids Rede im Parteiausschuss betonte Abwarten und die Vermeidung außerparlamentarischer Aktionen. Sie analysierte die Situation nach den Präsidialkabinetten und warnte vor voreiligen Aktionen. Die Interpretation dieser Rede und das Fehlen konkreter Handlungsanweisungen werden kritisch diskutiert.
Welche Bedeutung hatte der Parteiaufruf vom 2. Februar 1933?
Der Parteiaufruf vom 2. Februar 1933 enthielt scharfe Angriffe auf die Regierung und betonte sozialdemokratische Ziele. Die Rückkehr zu den programmatischen Zielen von 1891 wird interpretiert und die mögliche Motivation (Abgrenzung zum Kommunismus, Wählersicherung) wird diskutiert. Die Bereitschaft zum Widerstand wurde darin explizit bekräftigt.
Wie wirkte sich die Reichstagsbrandverordnung auf die SPD aus?
Die Reichstagsbrandverordnung und die zunehmende NS-Repression, einschließlich des Verbots des "Vorwärts", schränkten die Handlungsmöglichkeiten der SPD massiv ein und beeinflussten die politische Arbeit der Sozialdemokraten erheblich. Die Analyse untersucht den Einfluss dieser Maßnahmen auf den Willen zum aktiven Widerstand.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
SPD, Adolf Hitler, NS-Machtergreifung, Reichstagswahl 1933, Widerstand, Anpassung, Reichstagsbrandverordnung, Eiserne Front, Rudolf Breitscheid, Repression, Weimarer Republik, Parteiaufruf, „Vorwärts“.
- Quote paper
- Johann-Christoph Glöckner (Author), 2010, Anpassung oder Widerstand? - Politischer Kurs der SPD in der ersten Phase der "Machtergeifung" bis zur Reichstagswahl am 5. März 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/151303